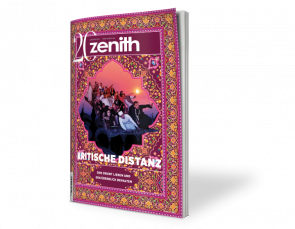Ein deutscher Top-Diplomat geht in den Ruhestand: Im Interview mit zenith verrät Martin Kobler, wie man mit Warlords verhandelt, warum ihn der Arabische Frühling nicht überraschte und wie er im Auswärtigen Dienst zum Twitter-König wurde.
zenith: Herr Kobler, der Umgang mit Warlords, Taliban und korrupten Politikern war jahrelang Ihr Tagesgeschäft. Wie kommt man mit problematischen Partnern ins Gespräch?
Martin Kobler: Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Erstens: zuhören. Und keinen missionarischen Eifer an den Tag legen, weniger fixe Positionen einnehmen, aber klare rote Linien ziehen. Zweitens: die Position des Gegenübers mit der eigenen Position abgleichen. Drittens: Falls die Positionen nicht deckungsgleich sind, in Dialog treten und versuchen, einen Ausweg zu finden. Falls die Positionen deckungsgleich sind, ist ja alles in Ordnung.
Was sind denn die fixen Positionen der deutschen Politik gegenüber der islamischen Welt?
Deutschlands Außenpolitik ist von dem Leitgedanken des Friedens und der Stabilität in der Nachbarschaft geprägt. Zypern und Malta sind gerade mal eine Flugstunde von Ägypten oder Libyen entfernt. Nach Lampedusa sind es nur knapp 300 Kilometer. Der Nahe Osten ist vor unserer Haustür. Wir wollen Abschottung vermeiden. Aber es ist schwer, wenn man Sicherheitsprobleme hat. Deswegen ist der Kampf gegen den Terror wichtig. Überall, wo der Terror herrscht, ist Dialog schwierig. Aber auch die sozialen Verhältnisse spielen natürlich eine Rolle, wenn wir an die Flüchtlingsproblematik denken. Insgesamt geht es uns um Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Nachbarschaft.
Dieser Dreiklang hört sich fast so an, als trauerten Sie der alten Garde arabischer Diktatoren wie Mubarak und Ben Ali nach, die ihren Partnern Stabilität versprachen, aber während des Arabischen Frühlings gestürzt wurden.
Im Gegenteil: Stabilität muss auf Werten wie Rechtsstaatlichkeit basieren. Diktaturen haben keine historische Perspektive. Wer Diktatoren in Schutz nimmt und kulturrelativistisch behauptet, dass das da unten eben schon immer so war, dem biete ich mit Vehemenz Paroli. Die Leute wollen keine Willkür, sondern Rechtssicherheit, Nahrung und für ihre Familien sorgen können. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gerne um 4 Uhr nachts von der Geheimpolizei aus dem Bett geholt wird. Von 2003 bis 2006 war ich Botschafter in Ägypten. Wir haben schon damals in einem internen Bericht die Machtübernahme durch die Muslimbrüder prognostiziert. Der Bericht ging in einem Exemplar nach Berlin. Beliebt war unsere Einschätzung vielleicht nicht, aber wir hatten den Eindruck, dass das Regime früher oder später stürzen würde.
Martin Kobler wurde 1953 in Stuttgart geboren und studierte Rechtswissenschaften, asiatische Philologie sowie indonesisches Staats- und Seerecht. Seit 1983 vertrat er die Bundesrepublik in verschiedenen Stationen im Nahen Osten (Ägypten, Palästinensische Gebiete, Irak) sowie in Südasien (Indien, Pakistan). Für die Vereinten Nationen war Kobler im Rahmen der Friedensmissionen in Afghanistan, dem Kongo und Libyen tätig. Seit 2019 ist der Diplomat im Ruhestand.
Die erste Geige spielt deutsche Außenpolitik selten.
Deutsche Außenpolitik heißt heute, in Europa eingebettet zu sein. Ich glaube aber doch, dass auch kleinere Staaten in der Diplomatie sehr viel erreichen können. Schauen Sie auf die Vermittlungsleistungen der Schweden oder Norweger. Die Oslo-Verträge Mitte der 1990er Jahre haben damals frischen Wind in den Nahost-Friedensprozess gebracht und die Vorarbeit für spätere Initiativen gelegt. Man muss also nicht immer ein großer Staat sein, um etwas zu bewirken. Je kleiner das eigene Interesse, desto eher wird man als Vermittler akzeptiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Deutschland als größeres Land ohne unmittelbare Kolonialvergangenheit und klar definierten Eigeninteressen wie einer wertebasierten Stabilität als Verhandlungspartner sehr respektiert wird. Das liegt auch daran, dass wir uns erst seit den 1990er-Jahren wieder militärisch engagiert haben. Ganz besonders wichtig für unsere Außenpolitik ist aber die europäische Einbindung.
Dennoch gibt es bisher kaum eine gemeinsame Außenpolitik. In Libyen etwa unterstützen einige EU-Länder die offizielle Regierung in Tripolis, andere den abtrünnigen General Haftar im Osten.
Traurig! Aber da sollte man nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Es zeigt vielmehr, dass wir mehr Europa brauchen und die Probleme nur lösen können, wenn wir an einem Strang ziehen. Und so ganz kann ich Ihnen nicht zustimmen: Wir sprechen uns auf europäischer Ebene eng miteinander ab.
Ist nationalstaatliche Diplomatie überhaupt noch zeitgemäß?
Nationalstaatliche Ansätze greifen meist zu kurz. Ich bin ein überzeugter, fast fanatischer Anhänger des Multilateralismus. Nur Multilateralismus gewährleistet die Einbindung aller Beteiligten. Außenminister Heiko Maas hat recht, wenn er davon spricht, dass wir eine Allianz der Multilateralisten brauchen. Bei Zukunftsthemen wie Klima und Migration kann es keine staatlichen Alleingänge geben. Wir sehen das gerade bei der Flüchtlingskrise: Manche Staaten in Europa verweigern sich einer Quotierung. Die Folge: der Tod von Flüchtlingen im Mittelmeer. Hier unterminieren nationalstaatliche Interessen einen multilateralen Ansatz. Donald Trump hat seine Geringschätzung für die UN kundgetan. »America First« wird der Menschheit aber zu keiner besseren Zukunft verhelfen.
»Niemand wird gerne um 4 Uhr nachts von der Geheimpolizei aus dem Bett geholt«
Ist das nur eine Frage unterschiedlicher Werte?
Die Geringschätzung des Multilateralismus zeigt sich auch darin, dass die Budgets für friedenserhaltene Missionen der UN stetig zurückgeschraubt wurden, von ursprünglich einmal 9 Milliarden US-Dollar auf 6,4 Milliarden US-Dollar heute. Das entspricht der Bilanzsumme der Stadtsparkasse in Freiburg. 6 Milliarden für 90.000 Soldaten, 10.000 Polizisten, 20.000 Zivilisten bei der UN – dass man da die Säge anlegt, finde ich unverantwortlich. Frieden zu erhalten kostet Geld. Für Rüstungsausgaben wurden 2018 laut Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) weltweit allein 1.800 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Allein der Afghanistan-Einsatz von 2001 bis heute hat 1.600 Milliarden US-Dollar gekostet. Die Gelder für friedenserhaltende Missionen zu kürzen ist angesichts dieser Zahlen ein Armutszeugnis und unverantwortlich.
Sie waren UN-Sondergesandter in Libyen und im Kongo. Haben Sie sich in Ihren Friedensmissionen manchmal eingeschränkt gefühlt von limitierten Mandaten?
Das war eigentlich nie das Problem. Die Mandate der UN sind eher zu weit gefasst, das schafft zwar viele Freiräume, ist aber oft überambitioniert. Wie soll man denn ein Land von der Größe eines Subkontinents wie den Kongo mit 20.000 Soldaten befrieden? Das geht gar nicht.
Wie geht man mit Interessenskonflikten um?
In meiner Zeit in Libyen standen formell alle hinter dem Mandat der Mission, aber einige Staaten unterstützten die Regierung in Tripolis, andere dagegen General Haftar im Osten. Was macht man da? Ich glaube, ich bin noch nie soviel gereist wie zu meiner Libyen-Zeit. Ich habe ständig die Entscheidungsträger in den arabischen Ländern, in Russland, in Europa besucht, um für Konsens zu werben. Ein UN-Mandat zu Nation Building, zur Vereinigung eines Landes, lässt sich ja nicht erfüllen, wenn die internationale Gemeinschaft in unterschiedliche Richtungen zieht. Ein UN-Sonderbeauftragter kann dann wenig machen, wenn hinter den Kulissen dagegengearbeitet wird.
In vielen postkolonialen Staaten existieren informelle parallel zu offiziellen Machtstrukturen. Entscheidungen werden oft über traditionelle Wege getroffen, zum Beispiel Stammesversammlungen. Mit wem redet man da eigentlich als UN-Sonderbeauftragter?
Wir gehen da zu oft mit dem westlich geprägten Blick heran: Ist die Bevölkerung beteiligt? Wahlen und Parlamentarismus, Stabilisierung, Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte – das ist normalerweise das Muster, mit dem auf andere Länder geguckt wird. Ich habe schon sehr früh als Student in Indonesien gelernt, dass es parallel auch andere, traditionelle Muster der Partizipation gibt. In Indonesien nennt man das Musyawarah Mufakat. Das heißt, man setzt sich so lange zusammen, bis eine gemeinsame Entscheidung gefunden worden ist. Das ist auf Dorfebene eigentlich der normale Prozess, etwa wenn eine neue Straße gebaut werden soll. Diese traditionellen Mechanismen haben ihre Vorteile und können den Prozess des Nation Building sehr gut ergänzen. Solch eine Konsensentscheidung birgt allerdings auch das Risiko, dass sich die wirtschaftlich Stärksten durchsetzen. Ich bin deswegen für einen doppelten Ansatz.
»Entscheidend für mich war, was im Interesse der Menschen ist: dass die Zahl der Toten zurückgeht«
Wie sieht der aus?
Im Fall Afghanistan haben wir die Abhaltung von Loya Jirgas unterstützt. Man strebt einen Konsens an, indem man die Stammesführer versammelt, die untereinander über Lösungen diskutieren. Das waren am Ende über 1.000 Leute. Es wurde also nicht in Hinterzimmern entschieden, sondern mit allen Entscheidungsträgern. Die Loya Jirga entscheidet in wichtigen Angelegenheiten, und das nach westlichem Zuschnitt geprägte Parlament hat das hinterher bestätigt, auch wenn es wohl nie gegen eine Entscheidung der Loya Jirga stimmen würde. Die UN fand diese lokalen Mechanismen grundsätzlich in Ordnung, aber forderte dann Frauenquote in der Loya Jirga. Es kann ja nicht sein, dass im 21. Jahrhundert tausend Männer allein entscheiden. Also haben auch Frauen teilgenommen. Dieses Nebeneinander zwischen teils aufoktroyiertem parlamentarischen Mehrheitsprinzip und dem Konsensprinzip versuchen wir in der Diplomatie zu nutzen. In Libyen ist dieser Ansatz aufgrund unterschiedlicher Interessen erst einmal gescheitert, aber ich bin sehr dafür, weiterhin offen zu bleiben.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein, wo Sie mal richtig daneben lagen?
Es geht in der Praxis eher um das Spannungsfeld, inwieweit man seine Position bei starkem Gegenwind ändert oder nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Libyen hatte mein Vorgänger Bernadino León 2015 das innerlibysche Friedensabkommen von Skhirat verhandelt. Aber er hatte es nicht geschafft, es auch durch das libysche Parlament zu bekommen. Und irgendwann war er dann weg. Dabei lag ein Abkommen, das Resultat von über einem Jahr Verhandlungen, auf dem Tisch. Dann kommt der Neue, in dem Fall ich, und es stellt sich die Frage: Gibt man dem Druck derer nach, die das Abkommen ohne Zustimmung des Parlaments in Kraft treten lassen wollen, oder dröselt man das ganze, mühsam verhandelte Abkommen wieder auf, wie es vor allem das Haftar-Lager wollte, und verhandelt neu.
Wie haben Sie sich entschieden?
Nach Rücksprache mit New York und vor allem den Anrainerstaaten und man chen Sicherheitsratsmitgliedern beschloss ich, dass die Parteien unterzeichnen und es erst danach vom Parlament absegnen lassen. Eine umstrittene Entscheidung, aber ich fand es richtig, dass der Bürgerkrieg beendet wird und man im Rahmen von politischen Verhandlungen fortfährt. Einen Tag vor der geplanten Unterzeichnung war ich zu Gast bei General Haftar in Ostlibyen, der mich davon überzeugen wollte, das Abkommen nicht unterzeichnen zu lassen. Auch die Stammesvertreter Ostlibyens haben sich einhellig dagegen ausgesprochen. Ich habe mich da schon gefragt, ob das der richtige Weg ist. Und es dann doch durchgezogen. Es ist am Ende immer eine Abwägungsfrage. Entscheidend für mich war, was im Interesse der Menschen ist: das Ende von Gewalt und Tod.
Stehen Sie noch zu Ihrer Entscheidung?
Ein neuer UN-Sonderbeauftragter hat immer auch die Chance, neu anzufangen und die Richtung zu wechseln. So habe ich es im Kongo gemacht. Aber in Libyen habe ich mich dafür entschieden, den Weg meines Vorgängers weiterzugehen. Wenn man das Desaster in Libyen heute ansieht, stelle ich mir in Nachhinein erneut die Frage, ob das damals die richtige Entscheidung war. Aber das Abkommen hat den Bürgerkrieg damals für zwei Jahre eingedämmt. Die neue Regierung konnte in die Hauptstadt Tripolis einziehen. Meine Devise war, dass erst Ruhe einkehren und dann eine Konsenslösung zwischen Ost, West und Süd verhandelt werden sollte. Da sind wir steckengeblieben. Hätte ich es noch mal so gemacht? Nach reiflicher Überlegung und auch in Kenntnis der heutigen Situation lautet meine Antwort: ja. Ich glaube, es war damals der richtige Weg. Aber andere sahen das damals und auch heute anders, das will ich nicht verhehlen.
»Das Budget für UN-Friedensmissionen entspricht der Bilanzsumme der Stadtsparkasse Freiburg«
Nahost-Diplomatie stellt man sich gerne als verqualmte Runde in Hinterzimmern vor, bei denen alte Männer stundenlang herumdiskutieren. Hand aufs Herz, was ist (noch) dran am Vorurteil?
Da ist schon was dran. Es sind oft kleine Zirkel. Aber die Frage ist, ob das, was da beschlossen wird, auch nachhaltig und tragfähig ist, gerade heute, in einer globalisierten Welt, in der jeder mit jedem kommunizieren kann. Ich habe deswegen versucht, wo immer ich war, Positionen auch der Bevölkerung verständlich zu machen. Im Kongo haben wir das einzige landesweite Radio betrieben, Radio Okapi. In Libyen habe ich das Twittern gelernt, um – auch unpopuläre – politische Botschaften unter die Leute zu bringen. Danach war ich Botschafter in Pakistan. Auch dort hatte ich einen ziemlich aktiven Twitter-Account. Ich habe Pakistan mit 250.000 Followern verlassen. Ich habe immer das Defizit gespürt, neben den Eliten aus Armee und Politik nicht genug mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Man kann ja nicht überall sein. Und so habe ich versucht, für unsere Positionen direkt zu werben – gerade über soziale Medien.
Waren die Reisen durchs Land und freundliche Tweets aus Pakistan Ihr persönlicher Ausgleich zu den harten UN-Posten in Libyen und im Kongo?
Die UN-Posten waren eine ganz außergewöhnliche und lohnende Erfahrung. Dafür bin ich dankbar. Ich wollte aber nach vier UN-Missionen vor meiner Pensionierung noch einmal ins Auswärtige Amt zurück. Ich habe da begonnen und wollte dort meine Laufbahn beenden. Ich kannte das Land aus afghanischer und indischer Perspektive, und es war reizvoll zu sehen, wie es vor Ort ist. Ich glaube, mein Erfolg in den sozialen Medien erklärt sich vor allem dadurch, dass in meinen Tweets und Posts immer auch eine Grundsympathie für Pakistan zu erkennen war. Aber ich habe trotzdem wahrscheinlich so klar wie kein Kollege zuvor öffentlich Kritik geübt. Pakistan ist immer noch das Land mit der höchsten Kindersterblichkeit weltweit, zu dem Thema habe ich oft getweetet – ebenso zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen oder Umweltverschmutzung. Dass eine Großstadt wie Islamabad heute noch keine Müllentsorgung hat, ist doch ein Skandal, den ich mehrmals öffentlich thematisiert habe. Ich habe mitnichten nur schöne Landschaften gepostet.
Unter Pakistans zivilen Eliten war Ihr Kurs durchaus umstritten. Ihr Fokus auf die Bevölkerung und Kritik an den herrschenden Zuständen wurde während des Wahlkampfs 2018 aber auch als Positionierung aufseiten des späteren Wahlsiegers Imran Khans empfunden.
Wer gegen Korruption und für Umweltschutz ist, wer für friedlichen Ausgleich mit den Nachbarstaaten eintritt, wer gegen Kinderarbeit und Sklaverei vorgehen und für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Armen kämpfen will, der sollte unsere Unterstützung haben, egal welche Partei er oder sie vertritt. Die Frage ist, was man öffentlich kritisiert und was man eher über klassische diplomatische Kanäle anspricht.
In welchen Situation ist welcher Ansatz angebracht?
Als ich einmal Korruption am Beispiel eines Straßenbaus thematisiert habe, wurde der Tweet plötzlich von den Sicherheitsbehörden gelöscht. Man merkt relativ schnell, wo die roten Linien sind. Aber das heißt nicht, dass Themen nicht angesprochen werden. Die Militärs sind ein entscheidender Faktor der pakistanischen Politik, nur greift man da eher zu diskreten Mitteln. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich während meiner Zeit in Pakistan einen guten Draht zum Generalstab hatte. Armeechef Qamar Javed Bajwa und ich haben eines gemeinsam: Wir waren beide für die UN im Kongo. Und deswegen konnten wir uns über die Frage der Milizenbekämpfung im Ostkongo langsam an andere Fragen herantasten. Den Einfluss der Armee auf die Politik kann man sicher nicht beim ersten Treffen ansprechen. Aber irgendwann habe ich diese Dinge in größter Offenheit mit ihm diskutieren können.
»Geheim sollte in der Diplomatie auch weiterhin geheim heißen. Dafür gibt es klare Regeln«
In den USA wird im Feuilleton gerade der Tod der klassischen Diplomatie beklagt, also die Kunst geschulter Experten, auf persönlicher Ebene hartnäckige Verhandlungen zu führen. Welche Rolle spielen persönliche Beziehungen heute im digitalen Zeitalter noch?
Erst einmal muss die Politik ihren Raum zurückerobern. Ronan Farrow beschreibt in dem Buch »Das Ende der Diplomatie« den Niedergang der Diplomatie und den Vormarsch militärischen Denkens in der amerikanischen Außenpolitik. In Deutschland sehe ich diese Gefahr glücklicherweise nicht. Ganz wichtig finde ich Respekt, Offenheit und Transparenz in den Beziehungen zu den Gesprächspartnern und in der Diplomatie gerade auch eine realistische interne Berichterstattung. Da sehe ich leider eine große Gefahr zur Schönfärberei. Nehmen wir zum Beispiel Afghanistan. Wenn ich da auf unsere interne Berichterstattung zurückblicke, finde ich manches doch ziemlich erstaunlich, ganz nach dem Motto: Am Ende wird schon alles gut. Dabei war interne Schönfärberei bereits bei den Briten im 19. Jahrhundert ein Grund für ihr Scheitern in Afghanistan.
Was führt denn zu dieser internen Schönfärberei?
Ich höre von jüngeren Kollegen immer wieder: Wenn ich das so und so schreibe, kommt das in Berlin nicht gut an. Da kann ich nur stark dagegenhalten: Wir sollten nicht das berichten, was in Berlin gut ankommt, sondern das, was wir im Ausland nach reiflicher Analyse und Abwägung denken. Das kann man ja auch als geheim klassifizieren.
Dem ehemaligen britischen Botschafter in den Vereinigten Staaten, Kim Darroch, wurde genau das zum Verhängnis. In geleakten Geheimdokumenten zeichnete er ein wenig schmeichelhaftes Bild von US-Präsident Trump. Und musste in Folge zurücktreten. Welche Auswirkungen hat die digitale Medienlandschaft auf das Geheime der Diplomatie? Muss nicht mittlerweile alles öffentlich sein?
Das glaube ich nicht. Geheim sollte in der Diplomatie auch weiterhin geheim heißen. Dafür gibt es klare Regeln. Und wer solche Dinge leakt, der handelt falsch. Sonst kann man keine realistische Lageeinschätzung vornehmen. Aber bei dem heute umfangreichen informellem Mailverkehr habe ich allen geraten, »leakfest«, sozusagen »Spiegel-fest«, zu schreiben. Für Brisantes gibt es den geregelten Berichtsweg.
Wie hat sich Ihr Blick auf die Welt seit 1983 verändert?
Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit über Krisen, Konflikte und Probleme geredet. Dabei sollten wir nicht außer Acht lassen: Die Welt ist seit den neunziger Jahren deutlich besser geworden – weniger Bürgerkriege, das Wohlstandsgefälle ist kleiner geworden. China hat 700 Millionen Menschen aus der Armut in den Mittelstand überführt. Ich sehe die Welt im Großen und Ganzen positiv und habe keine Angst vor der Zukunft. Allerdings bleibt Konfliktprävention nach wie vor ein Lippenbekenntnis. Die Literatur dazu füllt zwar Bibliotheken, aber in der Sache geschieht nicht genug. Dazu gehören auch die großen Zukunftsthemen wie Klima- und Bevölkerungspolitik. Wenn mich etwas umtreibt, dann die Sorge vor einem obszönen Werteverfall. Allein die Diskussion um die Frage, ob man Flüchtende im Mittelmeer retten soll oder nicht, finde ich skandalös. Das ist nicht mehr das Europa der Werte, für das ich ein Berufsleben lang eingetreten bin. Daher hat es mich gefreut, dass Spendenaufrufe, zum Beispiel für »Sea Watch«, Früchte tragen.
Wenn Sie dreißig Jahre später geboren worden wären, wären Sie wieder Diplomat geworden?
Ich habe mir neulich lauter Bücher dazu bestellt, wie man mit dem Ruhestand umgehen soll. Da wird vielfach empfohlen, dass man das machen soll, was man bisher verpasst hat. Da ist mir klar geworden, dass ich eigentlich nichts verpasst habe. Ich würde es immer wieder so machen. Ich hatte an vielen Weggabelungen in meinem Leben großes Glück. Besonders während der Zeit der rot-grünen Regierung, als ich Büroleiter des damaligen Außenministers Joschka Fischer sein konnte. Dreißig Jahre später wäre die Laufbahn aber mindestens genauso interessant und herausfordernd gewesen. Aber ich bedauere schon, dass ich heute nicht noch einmal aufs Neue dabei sein kann.
Auf welche Stationen blicken Sie besonders wehmütig zurück?
Beruflich waren die Jahre bei der UN einfach eine tolle Zeit, voller neuer Freundschaften mit Menschen, die für etwas brannten, die daran glaubten, die Welt tatsächlich ein bisschen besser machen zu können. Auch als junger Beamter in Jericho als erster Vertreter bei den Palästinensern nach dem Oslo-Abkommen war es aufregend. Ein heikles Terrain, besonders für einen Deutschen. Glücklicherweise konnte ich da vermeiden, in größere Fettnäpfchen zu treten. Am liebsten denken wir in der Familie aber eigentlich an eine unsere ersten Stationen in Indien zurück. Meine Frau ist ja auch beim Auswärtigen Amt. Unsere drei Kinder waren da noch sehr klein. Die Zeit hat uns familiär sehr geprägt.
Leo Wigger kommt ursprünglich aus Hamburg und hat an der School of Oriental and African Studies (SOAS) in London internationale Politik mit Schwerpunkt auf Pakistan studiert. Er schreibt seit 2017 für zenith, vor allem zu Südasien, Kultur und globalen Trends in der internationalen Politik.