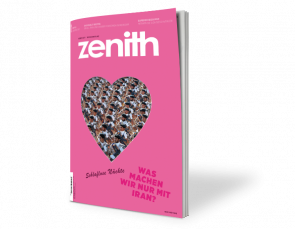Iranische Industriebetriebe sind gewiefte Ersatzteiljäger. Doch damit soll bald Schluss sein: Der Mittelstand sehnt sich nach der Sanktionsaufhebung nach neuem Equipment am besten aus Deutschland.
Ali Mohammad Reza, ein älterer Mann von großer Erfahrung und Lässigkeit, hört entspannt mit. Er trägt eine dicke goldene Uhr, ein grellrosa Hemd, helles Jackett und ein Lächeln, das Sicherheit ausstrahlt. Seine grauen Haare sind licht und kurz, sein Schnauzer ist dicht und schwarz. Er sitzt, lächelt, schweigt und jeder weiß, er wird am Ende die Entscheidung treffen in Halle 35 an Stand 24 auf der Messe »Irantex & Iran Mode« in Teheran.
Sein Sohn Mehrdad, hager, groß, unauffällige Kleidung, dieselben dicken Augenbrauen wie der Vater, verhandelt mit Abdul Mashadi von Texofin. Die beiden reden lebhaft, manchmal laut. Der Familie Mohammad Reza gehört die Firma Ziba nahe Teheran. Ziba heißt »schön«, übersetzt Mehrdad, und produziert fünf bis sechs Tonnen Stoff am Tag. Mehrdad holt ein Muster aus der Aktentasche. Weicher Stoff, weinrot, tiefblau. Muster mit Blumen und Paisleys. Da ließe sich schicke Konfektionsware draus machen.
Abdul Mashadi ist Besitzer von Texofin, einer Firma, die als Zwischenhändler auf dem iranischen Markt alles Mögliche verkauft: Ersatzteile, Material, Schmieröl. Texofin ist in Iran Agent von Interspare aus Reinbek bei Hamburg, einer Firma, die mit Ersatzteilen für Spannrahmen handelt und deren Monteure 400 Maschinen bei 286 Fabriken in Iran betreuen. Abdul Mashadi verkauft auch für mehrere chinesische Firmen Überdruckventile und Farbmischer. Aber eigentlich lebt er davon, Ersatzteile für diese Maschinen aus Deutschland zu organisieren. Sollte er eine große, neue Maschine verkaufen, wäre er wegen seiner Prozente reich. »Der Tag wird kommen«, sagt er. Also wartet er ab und bereitet sich vor. Tröstet sich mit dem Verkauf von Schmieröl, Textilfarben, Sicherungen, Ketten und anderen Kleinteilen.
Mit Mehrdad Mohammad Reza redet er über die Kammern des Spannrahmens bei Ziba. Die Maschine ist von Krantz aus Deutschland. Sein Großvater Ghaffar Mohammad Reza habe sie 1960 gekauft, sagt Mehrdad. »Damals neu.« Das ist wichtig zu wissen, denn zehntausende deutsche Textilmaschinen wurden im Globalisierungsfieber irgendwo in der Welt abgebaut und in ein Land mit noch geringeren Löhnen geschickt. Manche sind vier oder fünfmal umgezogen auf der Suche nach den billigsten Arbeitern: Puerto Rico, Mexiko, Philippinen, Vietnam, Bangladesch. Textilmaschinen haben Lebensläufe wie Backpacker Reiseblogs.
In Iran stehen viele solcher Wandervögel. Sie kamen aus China, aus Indien, aus Pakistan, aus Georgien, aus Russland. Selbst während der Zeit der Sanktionen. »Aber die Krantz hat Großvater damals neu gekauft«, sagt Mehrdad. Die Mohammad Rezas könnten mit der Maschine weiterarbeiten, die deutsche Wertarbeit wird noch lange laufen. Oder die Familie kauft eine neue, die schneller produziert. Eine, die mit billigerem Gas statt teurem Benzin läuft. Die Abluft in den Trocknern nutzen kann, die breitere Stoffbahnen produziert. Weniger Ausschuss. Auf jeden Fall eine deutsche, sagt Mehrban. Sein Vater nickt.
Aber alles ist gerade in der Schwebe. Iran öffnet sich, vielleicht, wahrscheinlich, sicher. Irgendwas glimmt da am Horizont. Es riecht nach Zukunft im Land. Jetzt, wo die Sanktionen der USA und der EU gelockert wurden. Alles geht langsamer als gedacht voran. Noch ist nicht alles geklärt, aber es verändert sich was. Alle sitzen in den Startlöchern. Warten ab. Suchen den richtigen Zeitpunkt.
Familienbetriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft. Sie haben das Know-how und sind flexibler als die großen Staatsbetriebe – es fehlt nur der Markt
Wenn die Sanktionen und vor allem die Finanzrestriktionen ganz weg sind, heißt das: Da ist ein neuer Markt für Waren aus dem Westen. Nicht so sehr für Konsumgüter. Die produziert Iran selbst. Aber für Maschinen, damit in Iran Konsumgüter produziert werden können. Vor allem bedeutet die Öffnung, so sieht das Abdul Mashadi und so sehen es die Mohammad Rezas: Stoff aus Iran wird endlich ohne viel Gemauschel in die Nachbarländer verkauft werden können. 300 Millionen Menschen leben in den Nachbarländern. Die GUS und die Golfstaaten seien wohl der größte Markt. GUS steht für die »Gemeinschaft Unabhängiger Staaten« und umfasst die alten Teilrepubliken der Sowjetunion inklusive Russland. Iran grenzt an Aserbaidschan und Turkmenistan.
Endlich Export. Darauf hoffen die iranischen Textilunternehmer, sagt Mohammad Moravey Hosseini. Er ist der Generalsekretär des Textilarbeitgeber-Verbandes, besitzt selbst mehrere Teppich und Stofffabriken. Dazu eine, die alte Textilmaschinen erneuert. 9.818 Textilfabriken gebe es offiziell im Land. Wobei weitere von der Statistik nicht erfasst würden. Er kenne da einige. »Wir warten auf den Startschuss«, sagt er und beklagt sich über den Investitionsstau. Noch kaufe keiner Maschinen, Kredite seien zu teuer, das Risiko deshalb noch zu groß. »30 Prozent Zinsen, verrückt.« Doch wenn es denn wirklich losgeht, dann werden alle kaufen. »Wir haben Hunger nach Maschinen.«
Wie jeder ordentliche Funktionär hat er Statistiken parat. 20 Meter Stoff pro Jahr und Kopf der Bevölkerung sei die Standardproduktion für Textilländer. »Das würde für uns bei 80 Millionen Einwohnern bedeuten: 1,6 Milliarden Meter. Aber wir produzieren gerade mal 800 Millionen Meter. Obwohl wir alle in drei Schichten arbeiten. Wir haben einen extremen Bedarf an Modernisierung.« Geld sei da. Es wird nur zurückgehalten. Dazu das, was im Ausland festsitzt. »Alleine in Indien sind wegen der Restriktionen acht Milliarden Dollar eingefroren, die unseren Textilfirmen gehören. Die Inder sagen: Kommt, kauft damit Maschinen bei uns, sonst kriegt ihr das Geld nicht.«
»Wir warten lieber«, sagt Mohammad Moravey Hosseini. »Wir wollen deutsche Maschinen.« Iranische Unternehmen besäßen im Ausland 100 Milliarden US-Dollar, festgefroren wegen der Finanzsanktionen. »Werden die frei«, sagt der Funktionär und redet nicht weiter. Er wartet lange, sagt dann: »Investitionsstau, Bonanza.« Auch die Iraner, also die Konsumenten, hätten Geld, sie wollten es ausgeben. »Sie warten«, sagt er. Wenn die Lage nur endlich mal geklärt wäre. »Wir sind ein Markt von 80 Millionen Menschen, vor allem junge Menschen, die meisten sind unter 30 Jahre alt. Dazu 300 Millionen Menschen in den angrenzenden Ländern. Menschen, die auch Mode haben wollen.«
Textilmaschinen haben Lebensläufe wie Backpacker Reiseblogs. In Iran stehen viele solcher Wandervögel. Sie kamen aus China, Indien, Pakistan, Georgien, Russland
Abdul Mashadi kennt die meisten der Textilunternehmer. Hat jedes Jahr einen Stand auf der Messe in Teheran. Kommuniziert, als habe wer bei ihm die Vorspul-Taste gedrückt. Den Rest des Jahres sind er und seine acht Mitarbeiter auf Tour durch Textilfabriken im Land. Er sprudelt vor Informationen. Weiß, wo eine 1950 gebaute Famatex arbeitet. Bei Yaran. Wo eine Franz Müller von 1958 steht. Bei Mersedeh. Er hat eine Kopie der Kladde der Riesenfirma Burujet. Da drin stehen Dutzende Maschinen von Hacoba, Krantz, Müller, Babcock, Artos und so weiter. Abdul Mashadi kennt jede Stentex im Land persönlich. Ahnt, dass die Familie Alizadeh, ein Modegroßund Einzelhändler, selber produzieren will, gerade Epak, eine kleine Fabrik auf dem Gelände der alten Uniformfabrik im Westen in der »Sepeher Industrial City«, als Probelauf betreibt und wohl als Erste neue Maschinen kaufen wird, wenn es losgeht.
Iran hat vielleicht so was wie eine Planwirtschaft, aber eine, die kapitalistisch ist. Es gibt viele Familienbetriebe, sie sind das Rückgrat der Wirtschaft. Flexibler als die großen Staatsbetriebe. Diese Familien stehen bereit, sie haben das Knowhow, es fehlt nur der Markt, sagt Abdul Mashadi. Er weiß, wer einen gelben Maserati besitzt und wer einen roten Ferrari, Autos, mit denen sich wegen des Neids gerade niemand in die Öffentlichkeit wagt. Wer gerade mit Unistar verhandelt. Das ist eine italienische Firma, die neue Maschinen produziert und versucht, sie über den Preis in den Markt zu drücken. »Wird nicht funktionieren, die Qualität der deutschen Maschinen ist besser. Jeder hier weiß das.« Da nicken sie jedes Mal, wenn er das sagt. Razmik Khodabkhsian, Chef von Mersedeh in Karadsch, oder die alten Männer der Familie Peidayesh bei Payabaf. Boss Astane Dari in Yazd bei der Firma Yazdbaf. Sie alle sitzen da und warten.
Zweifeln aber nicht. Das ist kein Optimismus, den sie haben. Eher das Wissen, dass sich auf jeden Fall was verändern wird. Dass sie bereitstehen und auf den Augenblick vorbereitet sind. Kann eigentlich nur besser werden, sagt Astane Dari mit viel Überzeugung in der Stimme. Oder M. M. Raeiszadeh, der Generalsekretär des Verbandes der Textilindustrie, am Stand von Abdul Mashadis Firma Texofin auf der Irantex: »Abwarten, einfach nur: abwarten!« Abdul Mashadi nickt beipflichtend.
Er ist 48. Hat als Kind, vor der Schule und nach der Schule, Teppiche geknüpft. Übrigens in einer Fabrik in Kaschan, die Mohammad Moravey Hosseini, dem Arbeitgeberverbands-Chef, gehört. Abdul hat sich hochgearbeitet, sich selbstständig gemacht und sich den Erfolg erkämpft. Ganz klar Mittelstand. Mindestens. Sein Sohn Ascha, 16, geht auf eine private internationale Schule, muss Sprachen für die Zukunft lernen. »Sprich Deutsch, Ascha!«, sagt Neschme, seine Mutter. »Sprich Englisch!«, sagt der Vater. Der Sohn ist die Zukunft, in ihn investieren sie. Sie würden gerne ein besseres Auto kaufen, eines aus Deutschland. Der Samand, den sie fahren, eine Weiterentwicklung des Pekan, der eine Weiterentwicklung des alten britischen Talbots der 1960er Jahre ist. Den fährt Abdul Mashadi widerwillig. Zu viel ärger damit, sagt er. Ständig Pannen. Die Scheibenwischer, einfach nur ärgerlich. Er freue sich auf die Zukunft.
Zwischendurch haben die Mashadis gezweifelt. Mit Neschme, 44, hatte er sich vor Jahren um Auswandererplätze in Kanada beworben. Die beiden haben Französisch gelernt, denn wenn sie Französisch gekonnt hätten, wären ihre Chancen auf einen Quotenplatz in der Provinz Quebec rapide gestiegen. Es hat nicht geklappt – wegen der Sprache. Keine Zeit für Kurse, denn das Geschäft hatte gerade angezogen. Oder besser gesagt, es sah damals schon so aus, als würde das Geschäft bald anziehen. »Jetzt warten wir«, sagt Abdul Mashadi. Er sei froh, dass das mit Kanada nichts geworden ist.
Unter der hohen Decke der Messehallen in Teheran sagt Mehrdad Mohammad Reza von Ziba zu Abdul Mashadi: »Klingt gut. Entex heißt die Firma?« Mashadi schreibt »Stentex« auf einen Block. Sagt, Interspare, die Firma in Reinbek, habe die Rechte an dieser Marke, könne so einen Spannrahmen bauen. Plötzlich legt der coole, stille, alte Ali Mohammad Reza die Hand mit der großen Uhr auf den Tisch. Fragt ganz ruhig, nur ein Wort. Abdul Mashadi hektisch: »In Deutschland, in Deutschland, in Reinbek, Deutschland.«
Alle lächeln. So wie der alte, erfahrene Ali Mohammad Reza es die ganze Zeit schon getan hat.