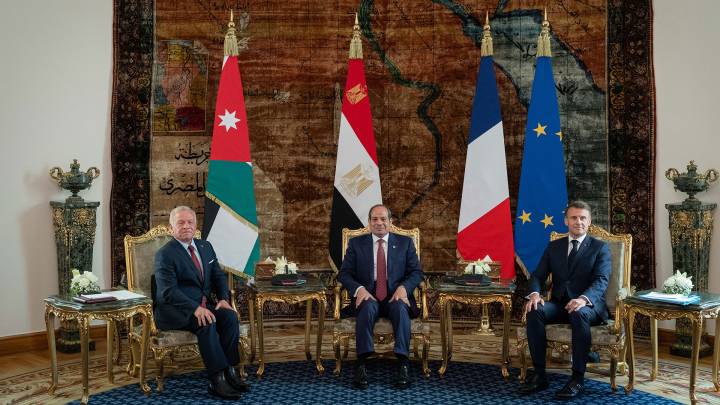Deutschland kann sich Zurückhaltung nicht leisten, wenn es um die Stabilisierung der Region Nahost geht. Die guten deutsch-israelischen Beziehungen sind dafür entscheidend, meint Nora Müller von der Körber-Stiftung.
Heute US-Präsident Obama, eine Woche zuvor Woche Kanzlerin Merkel: Innerhalb von nur sieben Tagen trifft Israels Premier Benjamin Netanjahu mit den Regierungschefs seiner wichtigsten Verbündeten zusammen. Während das amerikanisch-israelische Spitzentreffen Anfang März von der Krim-Krise überschattet sein dürfte, wurde rund um Merkels Besuch in Israel viel gemutmaßt über die vermeintlich gesunkene Betriebstemperatur zwischen Berlin und Jerusalem.
Ein Sturm im medialen Wasserglas, denn: je größer das Vertrauen, desto offener der Dialog – desto unverblümter mitunter die Kritik. Insofern ist Merkels und Netanjahus Übereinstimmung, vor allem in puncto Siedlungspolitik nicht übereinzustimmen, weniger Symptom eines ernsthaften Zerwürfnisses als Zeichen gesunder Normalität. Mehr Augenmerk in der Debatte würde man sich für eine andere, mindestens ebenso wichtige Frage wünschen: Aufgrund der historischen Verantwortung, die Deutschland trägt, ist das Bekenntnis zur Sicherheit Israels Grundkonstante deutscher Außenpolitik.
Was aber bedeutet dieses reichlich abstrakte Bekenntnis angesichts der immer schwieriger werdenden regionalpolitischen Großwetterlage im Nahen und Mittleren Osten für deutsche Israel-Politik? In ihrer Knesset-Rede 2008 gab Kanzlerin Merkel den Bezugsrahmen vor: Israels Sicherheit sei Teil deutscher Staatsräson. Eine Formulierung, die Bundespräsident Joachim Gauck vier Jahre später bei seinem Antrittsbesuch in Jerusalem bewusst vermied und stattdessen Israels Sicherheit als »bestimmend« für deutsche Politik bezeichnete.
Staatsräson hin oder her: Leitlinien für politisches Handeln ergeben sich aus beiden Positionen nur sehr bedingt, schon gar nicht für den Fall eines Zielkonflikts zwischen der postulierten Solidarität mit Israel und anderen regionalpolitischen Interessen. Wie Deutschland etwa reagieren sollte, falls Israel sich trotz des Risikos, einen regionalen Flächenbrand zu entfachen, zu einem Militärschlag gegen Iran entschlösse, lassen beide offen.
Jerusalem kann sich nicht mehr auf eine Politik des Abwartens zurückziehen
Wie steht es derzeit um Israels Sicherheit? Trotz der regionalen Verwerfungen seit Ausbruch der arabischen Revolutionen fällt Jerusalems sicherheitspolitische Bilanz grosso modo positiv aus. Allem Anschein nach ist Israels Kalkül aufgegangen, in Zeiten der Instabilität und Unsicherheit sprichwörtlich den Kopf einzuziehen, strategische Entscheidungen aufzuschieben und nur dann einzugreifen, wenn vitale Sicherheitsinteressen unmittelbar berührt sind.
Doch sein strategisches Umfeld ist im Begriff, sich zu verändern. Angesichts der Dynamik, die durch die Neuauflage des Nahostfriedensprozesses und die Nukleargespräche mit Iran in Gang gekommen ist, kann Israel sich nicht mehr auf eine Politik des Abwartens zurückziehen. Spätestens wenn US-Außenminister Kerry einen Entwurf für ein israelisch-palästinensisches Rahmenabkommen vorlegt, heißt es für Jerusalem: »hic Rhodus, hic salta«. Verlaufen die Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern nach Plan, soll dies noch im April der Fall sein.
Unabhängig davon, ob am Ende der Verhandlungen eine Endstatus-Lösung oder aber ein Scheitern steht: In beiden Fällen muss Israel einen proaktiven Kurs einschlagen – bestenfalls um eine mögliche Vereinbarung umzusetzen, schlechtestenfalls um Schadensbegrenzung zu betreiben. Denn ein Scheitern der Kerry-Initiative hätte Konsequenzen, die weit über das israelisch-palästinensische Verhältnis hinausgehen – einschließlich einer zunehmenden Isolierung Israels, einer Ausweitung der sogenannten »Boykott-, Deinvestitions- und Sanktionen-Kampagne« (BDS) und neuer Proteste in Palästina.
Auch die Genfer Interimsvereinbarung zum iranischen Atomprogramm und die laufenden Gespräche über ein permanentes Abkommen bringen Israel in Zugzwang. Sähe Jerusalem seine Sicherheitsinteressen in einer dauerhaften Einigung zwischen den E3+3-Staaten und Iran nicht hinreichend gewahrt, wäre es gezwungen zu handeln. Noch mehr Handlungsdruck würde entstehen, sollten die Nukleargespräche scheitern.
Denn wenn es den E3+3-Staaten nicht gelingt, sich mit Teheran auf eine endgültige Beilegung des Atomstreits zu einigen, steht die israelische Führung einmal mehr vor der Frage: Wie die Gefahr bannen, die von einem Iran mit nuklearer Waffenfähigkeit ausgeht? Spätestens dann würden für Israel wieder alle Optionen – einschließlich der militärischen – auf dem Tisch liegen.
Deutschland sollte sich Diskussionen zur Kennzeichnung von Siedlerprodukten nicht pauschal verweigern
Wie also können vor diesem Hintergrund Leitlinien für die deutsche Israel-Politik – Stand März 2014 – aussehen? Erstens: Kerrys Friedensinitiative nach Kräften unterstützen. Langfristig kann Israels Sicherheit nur im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung gewährleistet werden. Nicht neu, aber nach wie vor richtig. Weil die israelische Siedlungspolitik den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung im wahrsten Sinne des Wortes zu verbauen droht, tut die Bundesregierung gut daran, in diesem Punkt weiterhin »klare Kante« zu zeigen.
Dazu gehört auch, sich etwa der europäischen Diskussion über eine Kennzeichnungspflicht für Siedlungsprodukte nicht pauschal zu verweigern. Die Umsetzung einer solchen Verpflichtung wäre lediglich eine konsequente Anwendung geltenden europäischen Rechts, mitnichten ein Boykottaufruf gegen Israel. Zweitens: Die bilateralen Beziehungen zu Israel weiter ausbauen. Erst das solide Fundament der Beziehungen zwischen Berlin und Jerusalem eröffnet der Bundesregierung Spielräume, um einen Dissens in nahostpolitischen Fragen mit der israelischen Regierung auszutragen.
Umso wichtiger, dieses Fundament auszubauen und zukunftsfähig zu machen – etwa mit Maßnahmen wie dem jüngst geschlossenen Abkommen über konsularischen Beistand für israelische Staatsangehörige. Bilaterale Harmonie und zugleich nahostpolitischer Dissens: Ist das nicht ein bisschen schizophren? Keineswegs. Vielmehr Ausdruck kluger und vorausschauender Außenpolitik. Drittens: Zur Stabilisierung von Israels regionalem Umfeld beitragen.
Israel ist es gelungen, weitgehend unbeschadet durch die regionalpolitischen Stürme der letzten Jahre zu navigieren. Dass dies auch weiterhin der Fall sein wird, ist keineswegs ausgemacht. Ungemach könnte Israel drohen, falls das bislang relativ stabile Jordanien zu »wackeln« beginnt oder der große Nachbar Ägypten weiter im Chaos versinkt. Auch ein Scheitern der Nuklear-Verhandlungen mitsamt einer dann zu erwartenden Verhärtung der Fronten in Teheran wäre Israels Sicherheitsinteressen keinesfalls dienlich. Umso mehr gilt: Deutschland kann sich Zurückhaltung nicht leisten, wenn es um die Stabilisierung dieser ebenso wichtigen wie volatilen Region geht – nicht nur, aber auch mit Blick auf die Sicherheit Israels.
Israel muss sich als integraler Teil der Region begreifen
Viertens: Israels Isolation in der Region überwinden helfen. Mauern, Sperranlagen und Grenzzäune sind kurzfristig äußerst wirksam, um Terroristen aufzuhalten und Selbstmordanschläge zu verhindern. Dauerhafte Sicherheit kann Abschottung jedoch nicht garantieren. Israel als »Insel im feindlichen Nahen Osten« – dieses Selbstverständnis mancher Entscheidungsträger in Jerusalem und Tel Aviv ist angesichts der vielfältigen Bedrohungen verständlich und greift doch zu kurz.
Erst wenn Israel sich als integraler Teil der Region begreift – und als solcher auch von seinen arabischen Nachbarn akzeptiert wird – steht seine Sicherheit nicht mehr auf tönernen Füßen. Deutschland sollte seine guten Kontakte nicht nur nach Jerusalem, sondern auch in die anderen Hauptstädte der Region nutzen, um Gesprächskanäle herzustellen und Israel bei seinem Weg aus der regionalen Isolation zu unterstützen. Deutschlands Bekenntnis zur Sicherheit Israels in politisches Handeln zu übersetzen, bleibt eine Herausforderung. Doch die Hauptverantwortung dafür, dass Israels Sicherheit auch in Zukunft gewährleistet werden kann, liegt nicht in Berlin, sondern in Jerusalem.
Nora Müller
ist Programmleiterin im Bereich Internationale Politik der Körber-Stiftung.