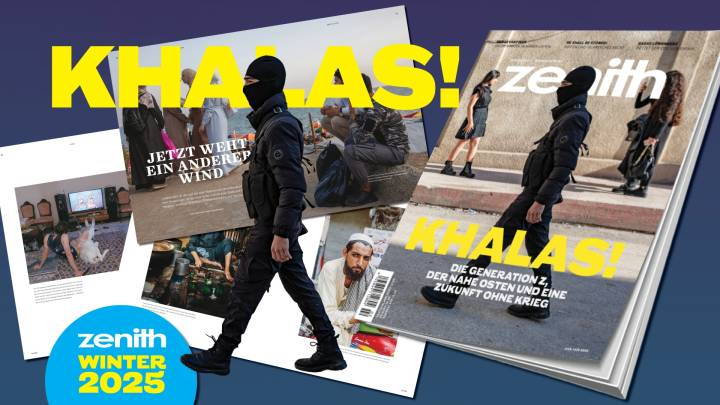Sind die Lehren aus Nationalsozialismus und Holocaust heute nur noch leere Worthülsen? Ein Plädoyer für eine inklusive Erinnerungskultur, die gerade im Umgang mit den Kriegsverbrechen in Gaza wichtiger denn je ist.
Im Koran heißt es in Sure 2, Vers 170: »Und wenn zu ihnen gesagt wird: ›Folgt dem, was Allah herabgesandt hat!‹, sagen sie: ›Nein, wir folgen dem, worin wir unsere Väter vorfanden.‹ – Auch dann, wenn ihre Väter nichts verstanden und nicht rechtgeleitet waren?« Der Koran kritisiert hierin fundamental, dass Menschen blind der Tradition ihrer Vorfahren folgen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ob diese denn tatsächlich wahr oder richtig war. Er fordert die Gläubigen unmissverständlich dazu auf, sich am offenbarten Wort Gottes zu orientieren – selbst dann, wenn dies bedeutet, liebgewonnene alte Gewohnheiten oder überkommene Lehren der Vorfahren radikal in Frage zu stellen.
Dieser Vers ist jedoch viel mehr als nur eine religiöse Ermahnung innerhalb eines spezifischen Glaubenssystems. Er beschreibt vielmehr ein universales, den Menschen an sich betreffendes Problem: die tief verwurzelte psychologische Neigung, am Alten, Vertrauten festzuhalten, selbst dann, wenn es längst überholt ist oder sogar aktiv schadet. Anstatt Neues unvoreingenommen zu prüfen, verharren wir in der trügerischen Sicherheit des Bekannten.
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat dieses Phänomen in einer anderen, säkularen Sprache auf scharfsinnige Weise beschrieben. Er zeigte in seinen Arbeiten auf, wie soziale Felder – sei es die Politik, das Bildungswesen oder die Kultur – dazu neigen, sich selbst zu reproduzieren. Wer in ein bestimmtes Milieu hineingeboren wird, übernimmt dessen spezifische Denkweisen, spricht seine jeweilige Sprache und bewegt sich wie selbstverständlich in seinen eingespielten Karrierenetzen. Dies geschieht zumeist nicht bewusst, sondern vollzieht sich unter der Oberfläche, wie von einer unsichtbaren Hand gelenkt.
»Nie wieder«, ist per definitionem nicht singulär, sondern gilt universell, für jede Form von Völkermord, für jeden Rassismus und für jede Spielart der Menschenfeindlichkeit
So entsteht das, was man als die Bourdieu-Falle bezeichnen kann: Eine Gesellschaft, die nach außen hin Offenheit und Dynamik proklamiert, folgt in Wahrheit festgelegten, unsichtbaren Mustern. Neue, innovative Wege sind in der Theorie zwar denkbar, aber in der Praxis sind sie kaum erreichbar, weil die Spielregeln des sozialen Feldes schon lange feststehen und von den darin befindlichen Akteuren unhinterfragt reproduziert werden. Genau dieses mechanische, unreflektierte Folgen ohne kritische Prüfung, das Bourdieu analysiert, wird im Koranvers auf religiöser Ebene scharf kritisiert.
In der Aufklärung hat Immanuel Kant dafür die berühmte und bis heute nachhallende Formel geprägt: »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!« – also: Denke selbst, prüfe eigenständig, anstatt dich bequem auf Autoritäten oder Traditionen zu verlassen. Hier, an diesem Punkt der kritischen Selbstbesinnung, treffen sich die Gedanken des Korans, Kants und Bourdieus in frappierender Weise. Alle drei, trotz ihrer unterschiedlichen historischen und kulturellen Kontexte, fordern den Menschen dazu auf, eingefahrene Denkweisen nicht als gottgegebenes Schicksal oder naturgegebene Ordnung zu akzeptieren, sondern den Mut aufzubringen, sie kritisch zu hinterfragen und sich von ihnen zu emanzipieren.
Ein besonders sensibles und hochaktuelles Beispiel für diese Dynamik ist die deutsche Erinnerungskultur an den Holocaust und der Kampf gegen alle Formen des Antisemitismus. Der Holocaust war und bleibt ein historisch singuläres Verbrechen – in seiner industriellen Dimension, seiner bürokratischen Organisation und seiner abgründigen Grausamkeit. Aber die Lehre, die wir daraus ziehen, das »Nie wieder«, ist per definitionem nicht singulär. Sie gilt universell, für jede Form von Völkermord, für jeden Rassismus und für jede Spielart der Menschenfeindlichkeit. Die große Gefahr besteht jedoch genau dann, wenn dieses »Nie wieder« selektiv angewandt wird – also nur im Bezug auf eine bestimmte Gruppe Gültigkeit beansprucht, während der menschenverachtende, menschenfeindliche Mechanismus als solcher dahinter nicht mehr erkannt oder benannt wird.
Ein konkretes und aktuelles Beispiel für diese Bourdieu-Falle im politischen Handeln ist die Haltung Deutschlands in der Frage der Kriegsverbrechen in Gaza
So verwandelt sich die lebendige Lehre in eine erstarrte Doktrin, und wenn dann die berechtigte Kritik an dieser inhaltlichen Verengung reflexartig und pauschal als Antisemitismus abgetan wird, vollzieht sich diese Verhärtung erst recht. Auf diese Weise verliert die Lehre ihre universelle, alle Menschen umspannende Kraft und wird selbst, in einer bitteren Ironie der Geschichte, zu einem Instrument der Begrenzung und Ausgrenzung. Das universelle Prinzip »Nie wieder« wird dann selbst ein Opfer der Bourdieu-Falle: Man darf es nicht mehr aktiv denken, nicht mehr mit neuem Leben füllen und danach handeln, sondern nur noch ritualisiert wiederholen, wie ein Mantra, das seine Bedeutung verloren hat.
So verengt sich unser kollektives Vorstellungsvermögen in gefährlicher Weise. Medien setzen enge Grenzen dessen, was sagbar und was undenkbar ist. Karrieren, insbesondere in etablierten Institutionen, laufen auf vorhersehbaren Schienen ab. Politische Optionen erscheinen nicht mehr als das, was sie sind – Ergebnisse von Aushandlungsprozessen und Machtverhältnissen –, sondern wie naturgegebene, unveränderliche Gesetze. Der Begriff der »Alternativlosigkeit« wird zum bequemen Schlagwort, um kritische Nachfragen im Keim zu ersticken. Ein konkretes und aktuelles Beispiel für diese Bourdieu-Falle im politischen Handeln ist die Haltung Deutschlands in der Frage der Kriegsverbrechen in Gaza.
Deutschland hat international lange Zeit eine anerkannte Vorreiterrolle in der Aufarbeitung der eigenen, historischen Schuld eingenommen. Diese Rolle war sichtbar, vorbildlich und strukturell verankert. Man denke nur an die konsequente Umsetzung der Lehren aus den Nürnberger Prozessen in das Völkerstrafrecht, die frühe und anhaltende Anerkennung der Staatengemeinschaft sowie die massive politische, finanzielle und ideelle Unterstützung internationaler Gerichtshöfe, die als Hüter eines »Nie wieder« gegründet wurden. Genau diese Institutionen, die maßgeblich durch deutschen Impuls und deutschen Willen zur Aufarbeitung befähigt und finanziert wurden, werden im entscheidenden Moment, wenn ihre Autorität und ihre Urteile einmal gegen mächtige Verbündete Deutschlands gerichtet sind, plötzlich angezweifelt, ihr Verfahren in Frage gestellt und ihre Legitimität relativiert.
Man ruht sich auf den erreichten Strukturen aus und denkt das »Nie wieder« als ein historisch abgeschlossenes Projekt, das sich primär auf die Vergangenheit bezieht
Dies ist die Bourdieu-Falle in Reinform: Das Bekenntnis zu »Nie wieder« und einer regelbasierten internationalen Ordnung wird zur leeren Doktrin, sobald es die eigenen, festgefahrenen politischen Muster und Bündniszwänge in Frage stellen würde. Die universelle Lehre wird dem partikularen Interesse geopfert, und damit verkommt das »Nie wieder« zu einem selektiven Prinzip, das seine moralische Glaubwürdigkeit und transformative Kraft einbüßt.
Deutschland hat es verstanden, eine strukturelle und institutionelle Infrastruktur der Vergangenheitsbewältigung aufzubauen. Sie wurde nicht nur vom Staat, sondern auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren wie den Kirchen mit großem Ernst und Aufwand vorangetrieben – eine historische Leistung. Doch genau dieser Erfolg hat eine neue Art von Stillstand produziert. Man ruht sich auf den erreichten Strukturen aus und denkt das »Nie wieder« als ein historisch abgeschlossenes Projekt, das sich primär auf die Vergangenheit bezieht. Es fehlt an einem dynamischen, zukunftsgerichteten Konzept, wie dieses Postulat in den globalisierten, migrationsgeprägten Gesellschaften des 21. Jahrhunderts aussehen soll.
Wie kann das »Nie wieder« für neue Formen des Rassismus, für Antiziganismus, für Muslimfeindlichkeit oder für den wachsenden Antisemitismus unter Migranten gleichermaßen gelten? Die Antwort darauf bleibt Deutschland schuldig. Es verpasst den Anschluss an die gesamtgesellschaftliche Realität, weil es in den Mustern einer ethnisch homogen gedachten Erinnerungsgemeinschaft verharrt und es versäumt, die universelle Botschaft so zu übersetzen, dass sie für alle Menschen, die heute in Deutschland leben, gleichermaßen verbindlich und anschlussfähig ist. Die Struktur ist da, aber ihr Geist ist erstarrt.
Dieses Defizit zeigt sich auch in der praktischen Arbeit der Erinnerungskultur. Die Geschäftsführer und Mitarbeiter von Gedenkstätten leisten eine hervorragende, unverzichtbare pädagogische und wissenschaftliche Arbeit in Deutschland. Doch auch sie sind oft traditionellen Mustern verhaftet. Ihre Arbeit konzentriert sich fast ausschließlich auf die Vermittlung der historischen Tatsachen des Nationalsozialismus. Die entscheidende Frage jedoch, wie die daraus gezogene universelle Lehre des »Nie wieder« die nachfolgenden Generationen von Neudeutschen und Menschen mit Migrationsgeschichte erreichen und aktiv einbinden kann, bleibt weitgehend unbeantwortet.
Erst in dieser Spannung beweist sich, ob das »Nie wieder« eine lebendige moralische Richtschnur oder eine tote Doktrin ist
Es gibt kaum durchdachte, flächendeckende Konzepte, um diese Bevölkerungsgruppen nicht nur als passive Adressaten der Gedenkarbeit, sondern als aktive Mitgestalter einer lebendigen, zukunftsorientierten Erinnerungskultur zu gewinnen. Das ist ein fatales Versäumnis, denn die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg und Nazi-Deutschland, die Abwehr jeder Form von Völkermord und Menschenfeindlichkeit, ist keine ethnisch deutsche Hausaufgabe, sondern ein universelles Anliegen, das alle Menschen in Deutschland angeht. Indem man sie aber als ein ausschließlich deutsches Erbe behandelt, schließt man genau diejenigen aus, die für die Zukunft dieser Lehre entscheidend sind.
Aus der historischen Schuld am Holocaust erwächst für Deutschland eine exklusive, nicht verhandelbare Verpflichtung: die Verantwortung für die Sicherheit Israels und das Wohlergehen jüdischen Lebens in Deutschland und weltweit. Diese Verantwortung ist eine unauslöschliche Konstante der deutschen Staatsräson. Die Bourdieu-Falle besteht hier jedoch darin, zu glauben, dass diese spezifische Verantwortung im Widerspruch zu einer universellen Menschenrechtspolitik stünde oder sie ausschließen würde. Im Gegenteil: Gerade aus der historischen Verantwortung gegenüber den Juden erwächst auch eine aktuelle moralische Verpflichtung auch gerade jetzt gegenüber den Palästinensern. Ein »Nie wieder« kann nur glaubwürdig sein, wenn es den Schutz aller Menschenleben, egal welcher Nationalität oder Ethnie, zur unverhandelbaren Prämisse macht.
Die ausschließliche Parteinahme für eine Seite und die damit einhergehende Relativierung des Leids der anderen Seite untergräbt die universelle Gültigkeit der eigenen Lehre. Es ist die schwierige, aber notwendige Aufgabe, beide Verantwortungen zusammenzudenken: die besondere, historisch begründete für Israel und die Juden und die universelle, aus den Menschenrechten abgeleitete für alle Menschen, einschließlich der Palästinenser. Erst in dieser Spannung beweist sich, ob das »Nie wieder« eine lebendige moralische Richtschnur oder eine tote Doktrin ist.
Doch wie der Koran mahnt, führt blindes Folgen nicht zur Wahrheit. Wie Kant fordert, braucht es Mut zum eigenen Denken. Und wie Bourdieu zeigt, braucht es ein waches Bewusstsein für die unsichtbaren Strukturen, die unser Denken und Handeln lenken. Aus all dem ergibt sich eine klare und dringende Aufgabe: Wir müssen Traditionen, Gedenkkulturen, Karrieremuster und politische Gewissheiten nicht ablehnen – aber wir müssen sie unentwegt prüfen, sie auf ihren universellen Gehalt befragen und sie für neue Realitäten öffnen. Nur dann bleibt der Raum für Neues, für wahrhaftiges Lernen und für echte Humanität offen. Nur dann kann aus ritualisierter Erinnerung eine universelle, handlungsleitende Lehre werden, aus toten Prinzipien eine lebendige Orientierung und aus oberflächlicher Kritik eine echte, gesellschaftliche Veränderung.
Aiman A. Mazyek