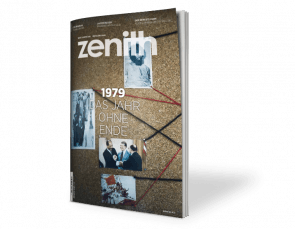Frank Bösch hat 1979 unter die Lupe genommen. Der Historiker erklärt, wie die Weltpolitik ins Wohnzimmer der Deutschen kam, Christdemokraten sich für Flüchtlinge einsetzten – und beide deutsche Staaten von den Ereignissen überrascht wurden.
zenith: Warum sagt 1979 so viel über die Gegenwart aus?
Frank Bösch: Wenn man Leute auf 1979 anspricht, sind sie oft erst etwas ratlos, was da eigentlich passiert ist. Das wird anders, wenn man ein paar Ereignisse in Erinnerung ruft, die damals die Welt erschüttert haben: die iranische Revolution, der sowjetische Einmarsch nach Afghanistan, die Revolution in Nicaragua, die Wahl von Thatcher oder die »Boat People«, die auch nach Deutschland kamen und die erste große außereuropäische Flüchtlingswelle bildeten. Viele dieser sehr unterschiedlichen Ereignisse korrespondieren mit Problemen und Herausforderungen der Gegenwart, die hier sichtbar wurden. Mein Buch geht von der Idee aus, an zehn derartigen Ereignissen mit weltpolitischer Bedeutung übergreifend das Aufkommen der Gegenwart zu analysieren, insbesondere auch aus deutscher Sicht. Auf diese Weise kann eine andere Sichtachse entstehen, als wenn wir wie gewöhnlich die Welt von 1945 oder 1989 her denken.
War den Menschen in Deutschland und Europa 1979 bewusst, dass sie sich inmitten von geschichtsträchtigen Umbrüchen befinden?
Die Ereignisse wurden alle damals schon als grundlegende Umbrüche diskutiert. Jeweils einzeln wurden sie als historische Wendepunkte markiert, als Brüche im 20. Jahrhundert, als eine »Live-Übertragung der Geschichte«. Man war direkt am Fernseher dabei und konnte Geschichte erleben. Auch das ist eine wichtige Voraussetzung für das Aufkommen dieser weltweiten Ereignisse. Wir haben seit den 1970er Jahren ein Satellitenfernsehen, das global direkt überträgt. Das ermöglichte erst, dass Reporter in dem Moment, in dem etwa die Massen in Teheran Khomeini empfangen, direkt vor Ort live senden konnten. Es gibt einen direkteren Kontakt, eine direktere Interaktion mit fernen Teilen der Welt.
Stimmt der Eindruck, dass die Bundesregierung zunächst recht unsicher war, wie sie die iranische Revolution einschätzen sollte?
In der Tat. Damals war völlig unklar, wie man Khomeini bewerten sollte. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Regierungen in Frankreich und Großbritannien hielten ihn für das kleinere Übel gegenüber den damals ebenfalls protestierenden Kommunisten. Viele trauten Khomeini wenig zu, sahen ihn als eine Übergangslösung. Helmut Schmidt sagte wörtlich: »Die Ayatollahs können das Land nicht ewig regieren.« Man gab Khomeini im Grunde genommen ein paar Jahre und glaubte, dass der Spuk dann vorbei sei.
Die Regierung knüpfte relativ schnell die ersten diplomatischen Fäden über die Botschaft in Teheran. Schwierig wurde es mit den ersten Hinrichtungen
Worauf beruhte diese Hoffnung?
Khomeini gab sich ja zunächst kompromissbereit und hatte einige demokratische Versprechungen gemacht. In den zahlreichen Interviews, die er in Paris damals gab, hatte er etwa zugestanden, eine demokratische Verfassung einzuführen und Wahlen abzuhalten. Der Protest war vielstimmig und zumindest bis zum März, als erstmals Proteste blutig niedergeschlagen wurden, war die Situation durchaus noch offen. Die iranische Revolution begann ja zudem nicht so blutig, wie man sie dann aus den Jahren danach in Erinnerung hat.
Das heißt, die Bundesregierung hat zunächst keinen Handlungsdruck gesehen?
Intern schon. Vor dem Beginn der Revolution hat sie versucht, möglichst unauffällig alle Deutschen aus dem Land zu holen. Die Bundesregierung bereitete Blutkonserven und Rettungspläne vor, hatte also durchaus Angst vor einer blutigen Revolution, die aber dann nicht in dem Maße wie befürchtet eintrat. Deshalb knüpfte die Bundesregierung relativ schnell erste diplomatische Fäden über die Botschaft in Teheran. Schwierig wurde es mit den ersten Hinrichtungen. Es wurden ja im Frühjahr 1979 auch ehemalige Politiker wie Amir Hoveyda hingerichtet, die viele deutsche Spitzenpolitiker auch persönlich kannten. Hier gab es kleine Protestnoten, aber danach erschien Mitte 1979 die Situation wieder beruhigt. Die Geschäfte gingen wieder los. Auch deutsche Geschäftsleute fuhren nun wieder nach Teheran.
Was waren die zentralen Motive der Regierung in Bonn – Geopolitik oder die Hoffnung, dass deutsche Unternehmen gute Geschäfte machen können?
Man darf nicht vergessen, dass die Bundesrepublik zu den stärksten Wirtschaftspartnern Irans gehörte. Umgekehrt kam aus Iran der größte Anteil der bundesdeutschen Öleinfuhren. Knapp 20 Prozent waren es, bevor die Exporte durch die Streiks Ende 1978 eingebrochen waren. Man hoffte, an diese enge Kooperation anzuknüpfen. Trotz der Proteste gegen den Schah 1967 genoss Iran ein hohes Ansehen in der Bundesrepublik. Eine offene Sympathie gegenüber dem Schah wurde in den 1970er Jahren vermieden, aber auch die sozialliberale Koalition förderte selbst die Lieferung problematischer Güter. Das Atomkraftwerk in Buschehr wurde von bundesdeutscher Seite geliefert und gebaut von der KWU. Viele große Unternehmen hatten in Iran Geschäfte, auch der Vertreib von Autos spielte eine Rolle.
Noch 1978, als die Proteste schon begonnen hatten, versuchte die DDR, den Schah in die DDR einzuladen
Welche Hoffnungen verband die DDR mit der iranischen Revolution?
In den 1970er Jahren versuchte die DDR generell mehr Anerkennung zu finden in der Welt und auch ihre Produkte in den Export zu bringen. Die DDR wollte vom hohen Ansehen profitieren, das deutsche Produkte in Iran genossen. Es gelang allerdings nicht recht. Die Exportquoten blieben relativ gering. Noch 1978, als die Proteste schon begonnen hatten, wollte die DDR den Schah einladen. Honecker unterstützte dabei in einem Entwurf eine Einladung an den Schah, in dem der Schah als Majestät angesprochen wird. Die DDR war sehr pragmatisch in dieser Phase. Während der Revolution versuchten die Staaten des Warschauer Pakts das Erbe der USA und der westlichen Staaten zu übernehmen. Das gelang in Teilen bei Waffenlieferungen, die traditionell eher an den Irak gingen. Aber insgesamt kamen sie in den Exportmarkt mit ihren Produkten kaum rein.
Inwieweit betrachtete die DDR die Entwicklungen im Iran auch durch die Folie der deutsch-deutschen Beziehungen?
Die DDR fokussierte fast alle Fragen mit Blick auf die Bundesrepublik, auch die Situation in Iran. Natürlich unterstützte sie die dortigen Kommunisten, ohne stärker Einfluss nehmen zu können. Ein Zeitzeuge erzählte mir ein besonders kurioses Beispiel über dieses Dreiecksverhältnis: Mit seinem kommunistischen Vater floh seine Familie Anfang der 1980er Jahre aus Iran in die Türkei, wo die DDR-Botschaft ihnen ein gefälschtes Visum für die Bundesrepublik gab. Dort sollten sie in einem deutschen Atomkraftwerk arbeiten und an die DDR berichten. Die DDR wollte also nicht unbedingt Flüchtlinge aus diesem Teil der Welt aufnehmen, diese aber in der deutsch-deutschen Rivalität nutzen.
Anfangs, haben Sie gesagt, wurde Khomeini von der Regierung in Bonn als Übergangslösung gesehen. Gab es mit den zunehmenden Repressionen einen Bruch oder folgte der erst mit der Besetzung der Botschaft?
Es gab mehrere Brüche, aber ein zentraler war natürlich die Besetzung der US-Botschaft. Auch die bundesdeutsche Botschaft hat damals die Androhung einer Besetzung erhalten. Ich kann zeigen, wie sie dann ausgedünnt wurde, fast nur noch iranisches Personal für einige Zeit dort arbeitet, obgleich von iranischer Seite deren Sicherheit betont wurde. Noch im Oktober – auch das bestätigten Zeitzeugen mir – erschien die Situation ganz entspannt. Besonders an den vielen Straßensperren zum Flughafen kontrollierten freilich junge Männer mit schweren Gewehren, was die fragile Situation zeigte. Aber an sich schien die Lage sich zu beruhigen. Die US-Botschaft war schon im Februar besetzt worden, aber bei der Besetzung im November 1979 ließ Khomeini die Besetzer schalten und walten. Das war eine zentrale Demütigung der USA. Generell kam es 1979 in den Konflikten zu einer Diskreditierung der Supermächte. Die Sowjetunion verlor durch ihren Einmarsch in Afghanistan an Ansehen, die USA durch den Umbruch in Nicaragua und die spätere Unterstützung der dortigen Rebellen. Einen weiteren Bruch bescherten die Massenhinrichtungen im Sommer 1981. Sie führen in der bundesdeutschen Öffentlichkeit zu einem gewissen Aufschrei darüber, dass der Kontakt zu Iran noch relativ gut sei. In der Folge schlug selbst Genscher, der sehr zurückhaltend im Ansprechen von Menschenrechtsverletzungen war, eine andere Sprache bei politischen Treffen an.
Viele Militärs hatten vor dem Einmarsch gewarnt, Breschnew selbst war schwerkrank und kaum noch entscheidungsfähig. Am Ende trat er dafür ein
Welche Rolle spielte die Bundesregierung bei der Befreiung der US-Geiseln?
Ich konnte an bislang geheimen Archivakten aufzeigen, dass die Bundesrepublik hier eine maßgebliche Rolle spielte. Besonders der bundesdeutsche Botschafter in Teheran, Gerhard Ritzel, pflegte weiter wichtige Kontakte zum Umfeld von Khomeini, so dass er als ein wichtiger geheimer Vermittler bei der Geiselbefreiung agieren konnte. Er leitete geheime Treffen zwischen Sadegh Tabatabei, Genscher und US-Außenminister Vance ein. Der pragmatische deutsche Kurs stärkte insofern nicht bloß Wirtschaftsinteressen, sondern trug auch zu einer Deeskalation bei.
Hat die Sensibilität im Umgang mit Israel 1979 auch noch mal zugenommen, weil die Fernsehserie »Holocaust« im Januar so massiv eingeschlagen war?
Das ist ein wichtiger Punkt. Die 1978/79 weltweit ausgestrahlte Serie »Holocaust« sensibilisiert auf neuartige Weise für den Umgang mit der NS-Vergangenheit. Mit der Serie selbst wird vielen Deutschen erst bewusst, welche Verbrechen, welche Vergehen, welche Grausamkeiten von Deutschen ausgingen. Das Auswärtige Amt verfolgt übrigens sehr genau auch die weltweite Ausstrahlung der Serie und besonders die in Israel. Anders als befürchtet führte sie nicht zu neuen Vorwürfen gegenüber Deutschland. Vielmehr stärkte sie den Willen zur Versöhnung und zu einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld. Insofern gibt es ein wachsendes Verständnis für die Situation vieler Juden, wenngleich die israelkritischen Töne natürlich nicht verschwinden.
Gegen Jahresende gab es noch zwei weitere Großereignisse im Nahen und Mittleren Osten – zunächst die Besetzung der Großen Moschee in Mekka. Wie wurden die Entwicklungen in Saudi-Arabien damals eingeschätzt?
Die Besetzung der Großen Moschee in Mekka machte vor allem deutlich, dass es nicht den Islam gab, sondern dass hier unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Formen der Radikalität miteinander rangen. Viele Studien benennen sie heute als eine Geburtsstunde des Fundamentalismus. Sie führte dazu, dass das saudische Königshaus einen deutlich konservativeren Kurs einschlug. Die saudische Regierung schlug die Besetzung zwar knallhart und blutig nieder, aber gleichzeitig ging sie stärker auf die fundamentalistischen Positionen ein. Auch dies gilt, trotz der Liberalisierung, die sich vorsichtig andeutet, bis in heutige Zeiten.
Kurz darauf erfolgte der sowjetische Einmarsch in Afghanistan. Haben die Sowjets unterschätzt, dass sie hier nicht nur den Kalten Krieg auf dem Boden eines Drittlandes austragen?
Die Protokolle des Politbüros der KPdSU unterstreichen, dass die Sowjetunion das ganze Jahr 1979 über unsicher war, wie sie mit Afghanistan umgehen sollte. Bis zum 12. Dezember, als die Entscheidung fiel, war umstritten, ob es einen Einmarsch geben sollte. Viele Militärs hatten davor gewarnt, Breschnew selbst war schwerkrank und kaum noch entscheidungsfähig. Am Ende trat er dafür ein. Dass die Sowjetunion die Risiken unterschätzte, lag vielleicht an der Hoffnung, dass es sich um einen kurzen Einsatz ähnlich wie in Prag 1968 handeln werde. Der Einmarsch ist eng mit der iranischen Revolution verbunden. Dass, wie damals im Westen wahrgenommen wurde, die Sowjets Angst hatten vor Unruhen in ihren südlichen islamischen Republiken hatte, dokumentieren die Politbüro-Protokolle nicht. Wie eine Volkszählung kurz vorher gezeigt hatte, war die Zahl der Muslime dort stark angestiegen. Es traten keine Unruhen auf. Aber die Vorgänge an der Südgrenze sensibilisierten die KPdSU für die Sprengkraft des Islams. Die Entscheidung für den Einmarsch hatte vielmehr mit dem Glauben zu tun, dass mit der Islamischen Republik Iran eine neue Bedrohung entstehen würde und dass die USA nun ihren Schwerpunkt von Pakistan aus auf Afghanistan verlegen würden. Die Sowjets fürchteten, dass all die Militärhilfe und die wirtschaftliche Unterstützung für Afghanistan seit den 1930er Jahren umsonst gewesen sei.
Das Paradoxe ist ja, dass einerseits eine Islamfurcht auftritt, dass andererseits die Mudschaheddin, »Freiheitskämpfer«, wie sie genannt wurden, Unterstützung finden
Die Führung der DDR hat nach der Aussage von ostdeutschen Diplomaten am Tag vor dem Einmarsch der Sowjets von dem Einsatz erfahren. War Ostberlin für die Sowjetführung so irrelevant?
Generell hat die Sowjetunion ihre Verbündeten wenig über ihre zentralen militärstrategischen Entscheidungen informiert. Die DDR war jedoch, das deuten die Akten an, vermutlich etwas besser informiert als die anderen Mitglieder des Warschauer Paktes. So gab es kurz vor dem Einmarsch eine Weisung von Honecker an das Neue Deutschland, bei den Meldungen zu Afghanistan genau auf die Presseanweisungen zu achten. Es wurde natürlich auch danach nicht von einem Einmarsch gesprochen, sondern von Hilfsmaßnahmen. Denn dass die Sowjetunion bereit war, Panzer und Truppen zu schicken, war gerade im Kontext der polnischen Entwicklung natürlich auch ein Warnzeichen an die sozialistischen Bruderländer, was wiederum Kritik in der Bevölkerung fördern konnte.
Der Einmarsch machte es für den Westen leichter, den Kommunismus als die größte Gefahr zu sehen. Wurde dadurch auch übersehen, dass hier mit einem entstehenden Islamismus etwas Neues entstand?
Das Paradoxe ist ja, dass einerseits im Westen mit der iranischen Revolution eine neuartig starke Islamfurcht auftritt, dass andererseits die Mudschaheddin als »Freiheitskämpfer« Unterstützung fanden. Es ist bezeichnend, dass konservative Stiftungen wie die Hanns-Seidel-Stiftung oder die Konrad-Adenauer-Stiftung Leute wie Gulbuddin Hekmatyar einfliegen lassen und sie für politische Gespräche hoffähig machen. Einzelne konservative Bundesabgeordnete und Journalisten, wie der CDU-Abgeordnete Jürgen Todenhöfer, flogen sogar nach Pakistan und begleiteten die Mudschaheddin ins Grenzgebiet bei Kämpfen, um für deren Unterstützung zu werben. Das zeigt, wie stark die anti-kommunistische Brille prägend blieb.
Sind eigentlich in Westdeutschland in größerer Zahl Asylbewerber aus Afghanistan und auch aus dem Iran aufgenommen worden?
Es ist bezeichnend, dass aus Afghanistan kaum Flüchtlinge aufgenommen wurden. Ganz im Gegenteil, die Verteilung von Visa wurde 1980 restriktiver. Das zeigt den Unterschied zu den »Boat People«. Sowohl die »Boat People« als auch die Flüchtlinge aus Afghanistan wurden von Kommunisten verfolgt, aber die Afghanen galten als weniger gebildet und als weniger integrationsfähig. Vielmehr erhöhte die Bundesrepublik die Zahlungen und Hilfslieferungen für die Flüchtlingslager stark. Sie gab Geld, wollte aber nicht direkt Menschen aufnehmen.
Und aus Iran?
Aus Iran bleiben die Zahlen auch relativ klein, denn die Flucht war auch nicht ganz einfach. Insgesamt ist die Zahl der Menschen, die aus Iran kamen, untergeordnet zu den Flüchtlingen aus Indochina.
Die CDU warb für Spenden, für ein direktes Einfliegen und sorgte dafür, dass Flüchtlinge in die CDU-regierten Bundesländer kamen
Die Aufnahme der »Boat People« – ein Thema des Jahres 1979, das einen rein bildlich sofort in die Gegenwart katapultiert. Wie erklären sie sich, dass es damals zunächst vor allem christdemokratische Politiker in Deutschland waren, die für eine Aufnahme plädiert haben?
Bis Ende der 1970er hat Deutschland so gut wie keine Flüchtlinge aufgenommen, die nicht aus Europa kamen. Das ändert sich schlagartig mit der Aufnahme der »Boat People«. Dass besonders die Christdemokraten ihre Aufnahme forderten, hatte mehrere Gründe: Zum einen waren es Verfolgte des Kommunismus. Dass viele chinesisch-stämmige Vietnamesen flohen, korrespondierte mit der neuen Nähe zu China, die die CDU/CSU gegen die Ostpolitik suchte. Viele Christdemokraten, die sich hier engagierten, waren zudem selbst Vertriebene aus den vormals deutschen Ostgebieten oder sahen Parallelen zur Zeit nach 1945. Zudem galten die Flüchtlinge aus Südostasien als besonders fleißig und insofern auch als gut integrierbar. Die CDU warb für Spenden, für ein direktes Einfliegen aus den Lagern und sorgte dafür, dass Flüchtlinge in die CDU-regierten Bundesländer auch über die Quoten hinaus Aufnahme fanden, die mühsam der Regierung Schmidt abgerungen wurden.
Es waren ja nicht nur politische Parteien sondern auch kleine Hilfsorganisationen, allen voran »Ein Schiff für Vietnam«, die sich für die Rettung der Flüchtlinge einsetzten. Ist das auch ein Trend, der damals einsetzte?
Generell trat eine breite Öffentlichkeit für die Aufnahme der »Boat People« ein. Es kamen mehr Spenden, mehr Sachgeschenke, mehr Adoptionsanträge als überhaupt umgesetzt werden konnten für die rund 38.000 Flüchtlinge, die in den ersten Jahren kamen. Auffällig ist, dass die Medien eigenständig dafür sorgten, dass »Boat People« aufgenommen wurden. Die Wochenzeitung Die ZEIT beispielsweise stellte eine eigene Spendenaktion auf die Beine und flog Flüchtlinge ein. Die wurden dann von Mitteln dieser Spenden aufgenommen und versorgt. Am spektakulärsten war sicherlich die Aktion von Rupert Neudeck, der mit Cap Anamur ein Schiff charterte, das fast 10.000 Menschen aus dem Wasser aufnahm und etwa dreimal so viele auch medizinisch versorgte. Dieses Schiff steht für das große Engagement in der Bevölkerung, tatsächlich Menschen aus dem Wasser zu retten und in Deutschland aufzunehmen. Es wurde bis auf eine EG-Spende komplett aus privaten Spenden finanziert.
Kann man bei der Aufnahme in Deutschland von einer Willkommenskultur sprechen?
Man kann den neueren Begriff der »Willkommenskultur« hier durchaus anwenden. Neu in dieser Phase ist einerseits das engagierte Auftreten von kleinen NGOs wie Cap Anamur und die breit in der Bevölkerung verankerte Unterstützung. Markant ist aber, dass diese Stimmung dann kippte, ähnlich wie später dann auch bei der Aufnahme der syrischen Flüchtlinge. Ausländerfeindliche Ressentiments kamen mit Verweis darauf auf, dass gleichzeitig die Zahl der Asylbewerber aus anderen Ländern, besonders aus der Türkei und aus Polen, stark anstieg und sich die Zahl der Migranten um 1980 durch den Familiennachzug deutlich erhöht hatte. Im Bundestagswahlkampf von Franz-Josef Strauß kam erstmalig auch der Begriff Wirtschaftsasylant auf. Entsprechend ging die Öffnung gegenüber den »Boat People« mit mehr Restriktionen einher und einem schärferen Asylgesetz.
Es ist generell auffällig, in welch starkem Maße die Medien Interviews mit Diktatoren aus aller Welt führen
In deutschen Zeitungen und Zeitschriften sind 1979 reihenweise Interview mit Diktatoren erschienen. Mit Gaddafi, mit Hafiz Al-Assad, auch mit Saddam Hussein. Herrschte damals eine offenere Diskurskultur?
Es ist auffällig, in welch starkem Maße die Medien Interviews mit Diktatoren aus aller Welt führten. Nicht nur Khomeini, sondern viele Akteure setzten auf eine intensive Medienpolitik. Selbst die Bild-Zeitung sprach damals mit ihm. Auch der frisch gewählte Papst Johannes Paul II. setzte ganz auf eine enge Medienkommunikation. Die weltweit kursierenden Interviews der Sandinisten aus Nicaragua beantwortete der dort regierende Autokrat Somoza etwa mit Interviews mit dem Stern und dem Spiegel. Dies machte sie zu globalen Akteuren, die so die Ereignisse in ihren Regionen beeinflussten und zu weltpolitischen Konfliktfeldern machten.
Wenn man sich im Rückblick intensiv mit 1979 beschäftigt und feststellt, was dort alles begonnen hat, wie groß ist dann die Gefahr, dass man die Geschichte nicht mehr als ergebnisoffen wahrnimmt?
Man darf sich nicht an einzelnen Jahreszahlen festklammern. Die Geschichte muss man problembezogen mit Fragen untersuchen und je nach Blickrichtung wird das Ergebnis anders ausfallen. Insofern ist 1979 nicht als eine Superzäsur zu verstehen, die alles erklärt. Mein Buch ist allerdings der Versuch, eine andere Sichtweise zu etablieren. Jemand der in Iran, in China oder Nicaragua lebt, selbst jemand aus Großbritannien, der denkt die Welt nicht von 1933 oder 1989 her, sondern für diese Menschen gilt 1979 als ein Schlüsseldatum. Der Grundgedanke bei meinem Buch ist, zu fragen, inwieweit dieser grundlegende Wandel in anderen Teilen der Erde eigentlich die Welt insgesamt und besonders uns Deutsche beeinflusste.
Haben Sie in ihrem Buch auch Entwicklungen beschrieben, die zu Sackgassen geworden sind? Über die wir heute sagen würden, damit kann ich gar nichts anfangen.
Bei den großen Weltereignissen eigentlich nicht. Ich hatte aber darüber nachgedacht, ein Kapitel zu gestürzten Diktatoren zu machen – zu Leuten wie Pol Pot, Idi Amin und Bokassa. Da hätte man offen fragen können, wofür dies eigentlich steht: für den Beginn einer besseren Welt, in der man nicht mehr Millionen Menschen in seinem Land ermorden oder vertreiben kann? Diese bessere Welt ist sicherlich nicht eingetreten. Natürlich haben wir auch danach noch Völkermorde gehabt, haben danach noch blutrünstige Diktatoren gesehen, auch wenn sie vielleicht in dieser Form wie Pol Pot etwa, selbst in abgeschotteten Ländern wie Nordkorea nicht mehr denkbar erscheinen. Aber selbst in dieser Hinsicht ist die Geschichte offen.
Frank Bösch ist Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam und Professor für Europäische Geschichte an der dortigen Universität. Zuvor lehrte er in Göttingen, Bochum und Gießen. Er ist Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschien »Mass Media and Historical Change« (2015). Am 25. Januar 2019 erscheint sein Buch »Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann«.