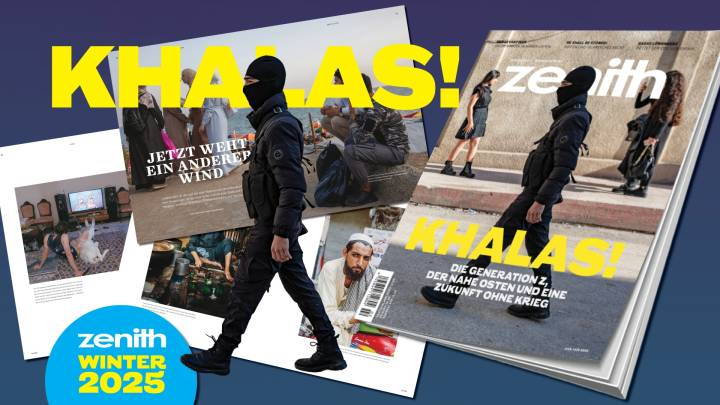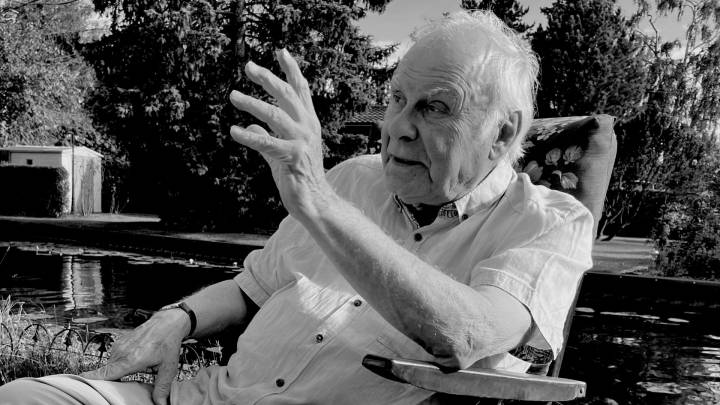Hila Limar von der NGO Visions for Children e.V. über Bildungsarbeit in Afghanistan, die systematische Entrechtung von Frauen und Mädchen – und die zweifelhaften Avancen der Bundesregierung an die Taliban.
zenith: Wie hat sich die Bildungsarbeit Ihrer Organisation Visions for Children e.V. nach der Machtübernahme der Taliban, also in den letzten vier Jahren, verändert?
Hila Limar: Nach der Machtübernahme der Taliban standen wir zunächst vor enormen organisatorischen Herausforderungen. Unser damaliges Team vor Ort musste evakuiert werden, sodass wir gezwungen waren, die Arbeit mit neuen Mitarbeitern wieder aufzubauen. Die Einarbeitung und der Umgang mit der De-facto-Regierung und deren Regeln beziehungsweise Gesetze benötigen Zeit, und viele bürokratische Prozesse und gängige Arbeitsabläufe im Team konnten nicht wie gewohnt fortgesetzt werden. Es hat etwa zwei Jahre gedauert, bis sich hier eine gewisse Struktur etabliert hat, mit der wir arbeiten können. Mit der Zeit wurden uns zunehmend Einschränkungen auferlegt: Etwa bei der Arbeit von weiblichen Mitarbeiterinnen unserer Partnerorganisationen. Inzwischen ist es allerdings möglich, dass sie zum Beispiel aus dem Home Office heraus ihrer Arbeit weiter nachgehen können. Besonders schwer wiegt für uns jedoch, dass wir einen Teil unserer Zielgruppe – insbesondere Mädchen an Mittel- und Oberschulen – nicht mehr erreichen können, da ihnen der Schulbesuch untersagt wurde.
Welche Herausforderungen kamen auf Ihre Organisation noch zu?
Unsere Arbeit in Afghanistan wird größtenteils durch öffentliche Fördermittel finanziert. Nach der Machtübernahme im August 2021 wurden jedoch diese Förderprogramme seitens der Bundesregierung vorerst eingestellt. Diese Finanzierungslücke hat nicht nur uns, sondern viele andere Organisationen hart getroffen. Einige Projekte mussten komplett eingestellt werden. Was dabei oft vergessen wird: Das Ausbleiben von Fördermitteln betrifft in erster Linie die Kinder, die auf Bildungsangebote angewiesen sind – nicht etwa die De-facto-Regierung. Gleichzeitig war für uns als in Deutschland registrierte Organisation lange unklar, ob und unter welchen rechtlichen Voraussetzungen wir weiterhin in Afghanistan tätig sein dürfen, da die Taliban international nicht als legitime Regierung anerkannt werden. Die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für entwicklungspolitisches Engagement waren in dieser Zeit entweder gar nicht oder nur sehr vage definiert. Diese Unsicherheiten erschwerten die Arbeit ungemein.
Wie sieht die Realität in den Schulen insbesondere seit der Machtübernahme der Taliban aus? An Grundschulen dürfen Lehrerinnen ja noch arbeiten und Mädchen bis 12 Jahren dürfen am Unterricht teilnehmen.
Tatsächlich arbeiten wir mit unseren Partnerorganisationen weiterhin an Grundschulen; in Afghanistan laufen diese bis einschließlich der 6. Klasse. Dort dürfen Mädchen noch offiziell unterrichtet werden. Gerade weil der Zugang zu Bildung für ältere Mädchen versperrt ist, ist es umso wichtiger, die verbleibende Schulzeit so sinnvoll und hochwertig wie möglich zu gestalten. In vielen Schulen, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in anderen Ländern des globalen Südens, erleben wir, dass Kinder nach sechs Jahren Grundschule kaum in der Lage sind, flüssig zu lesen, zu schreiben oder zu rechnen. Das belegen etwa globale Studien der Weltbank und UNESCO; in Projektbesuchen und Gesprächen mit Schülern erleben wir es auch persönlich. Unser Ziel ist es daher, die Kinder, die noch zur Schule gehen dürfen, bestmöglich zu fördern. Es liegt nicht an fehlender Motivation – im Gegenteil, wir erleben eine große Lernbereitschaft. Es sind die Lernbedingungen, die nicht ausreichend sind: überfüllte Klassen, fehlende Lehrmaterialien, schwach ausgebildetes Personal. Hier setzen wir an.
»Das zeigt sich deutlich an den angekündigten Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit für den diesjährigen Haushalt«
Wie sehen denn die Lernbedingungen in Afghanistan konkret aus?
Es fehlt an grundlegender Infrastruktur – viele Schulen verfügen weder über feste Gebäude noch über ausreichende Ausstattung. Zahlreiche Kinder müssen bei über 40 Grad im Sommer oder eisigen Minusgraden im Winter im Freien lernen. Das beeinträchtigt ihre Konzentration und Lernfähigkeit massiv. Auch an Lehrmaterialien mangelt es häufig, und die Lehrkräfte sind oft entweder nicht ausreichend ausgebildet oder durch die Gesamtsituation entmutigt. Klassen mit bis zu 50 Kindern sind keine Seltenheit, was eine individuelle Betreuung nahezu unmöglich macht. Hinzu kommt der Schichtbetrieb aufgrund fehlender Räume: Schüler werden vormittags oder nachmittags unterrichtet – mit entsprechend verkürzter Lernzeit. Diese Faktoren führen dazu, dass viele Kinder die Grundschule ohne grundlegende Lese-, Schreib- oder Rechenkenntnisse verlassen. Unser Ziel ist es daher, sicherzustellen, dass sie zumindest diese essenziellen Fähigkeiten erwerben – denn Bildung ist die Basis zu jeder Form von gesellschaftlicher Teilhabe und Veränderung sowie der persönlichen Selbstbestimmung.
Wie haben sich die Bildungsmöglichkeiten für Mädchen in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban verändert?
Seit 2021 hat sich die Situation dramatisch verschlechtert: Mädchen dürfen nur noch bis einschließlich der 6. Klasse reguläre Schulen besuchen. Zwar sind religiöse Bildungseinrichtungen – sogenannte Medressen – auch für ältere Mädchen geöffnet, doch diese unterstehen der Kontrolle der De-facto-Autoritäten, was die Inhalte offiziell stark einschränkt. Ein Hochschulstudium ist für Frauen in Afghanistan heute nahezu unmöglich. Selbst vormals zugängliche Studiengänge im medizinischen Bereich sind nicht mehr erlaubt. Einige Berufe dürfen weiterhin ausgeübt werden: Lehrerinnen an Grundschulen dürfen zum Beispiel weiterhin unterrichten – für viele Familien stellt das die einzige stabile Einkommensquelle dar.
Wie empfinden Sie die Reaktion zum Beispiel der Bundesregierung auf diese Entrechtung afghanischer Mädchen und Frauen?
Die Ampel-Koalition strebte eine feministische Außenpolitik an mit dem Ziel, die Frauenrechte weltweit zu stärken. Im Hinblick auf Afghanistan ist aus unserer Sicht zu wenig passiert – also in einem Land, in dem die Rechte der Frauen so massiv beschnitten werden, wie nirgendwo sonst. Frauen wurden fast vollständig aus dem öffentlichen Leben verdrängt – aus der Bildung, Medien, Politik und vielen Schlüsselberufen. Diese Entwicklung wird zwar benannt, aber politisch kaum wirksam angegangen. Das empfinden wir als enttäuschend.
Woran liegt das?
Afghanistan steht beispielhaft dafür, wie sich Deutschland zunehmend aus internationaler Verantwortung zurückzieht. Dabei tragen wir als Gesellschaft durch den 20-jährigen Einsatz im Land und den überstürzten Abzug im August 2021 eine Mitverantwortung für die heutige Situation. Nehmen wir die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen: Die ersten fünf – Armut bekämpfen, Hunger beseitigen, Gesundheit, Bildung und Geschlechtergerechtigkeit – sind grundlegende Menschenrechte. Doch in der deutschen Debatte finden sie kaum noch statt. Stattdessen verlagert sich der Fokus zunehmend auf rechte Narrative, nationale Interessen und vermeintliche Belastungen für den Steuerzahler. Das zeigt sich deutlich an den angekündigten Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit für den diesjährigen Haushalt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es in Afghanistan und den zahlreichen weiteren betroffenen Ländern nicht nur um politische Entscheidungen geht. Sondern um konkrete Lebensrealitäten und um das Überleben von Millionen Menschen.
»Ohne Stabilität und Rückhalt in Deutschland wird es auch für die Projekte in Afghanistan immer schwieriger«
Was sollte die internationale Gemeinschaft, aber auch insbesondere Deutschland, tun, um die Belange der afghanischen Bevölkerung wieder stärker in den Fokus zu rücken?
Deutschland sollte auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen. Es wäre fatal, die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe weiter zu kürzen. Die USA stellten bereits die Zahlungen über die Agentur USAID ein, womit der weltweit größte Geber ausscheidet. Die anderen Nationen können diese finanzielle Lücke schließen, dafür muss aber der politische Wille vorhanden sein. Natürlich erlebt die Welt viele Krisen – aber genau deshalb braucht es politisch ein gemeinsames Verständnis für Menschenrechte und Solidarität. Und Afghanistan darf dabei nicht in Vergessenheit geraten. Die Situation verschlechtert sich kontinuierlich, und das hat langfristige Folgen – für die Region, aber auch für Europa.
Am 18. Juli führte eine Maschine von Qatar Airways von Leipzig aus den insgesamt zweiten Abschiebeflug seit 2021 mit 81 Afghanen an Bord durch.
Wir lehnen Abschiebungen nach Afghanistan entschieden ab. In vielen Fällen handelt es sich um Menschen, die nie selbst in Afghanistan gelebt haben – sondern aus der Diaspora stammen, etwa aus Pakistan oder Iran. Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland lassen sowohl Schutz als auch Ablehnung zu – das zeigt sich am Beispiel der Ortskräfte. Trotz klarer Aufnahmezusagen wurde einer afghanischen Familie das Visum verweigert. In einem Eilverfahren entschied das Berliner Verwaltungsgericht nun zugunsten der Familie. Das macht deutlich: Schutz hängt oft von politischen Auslegungen ab – und nicht von einer einheitlichen rechtlichen Haltung.
Innenminister Alexander Dobrindt wiederum bringt direkte Gespräche mit den Taliban ins Spiel. Wie sollte man mit dem Regime in Afghanistan interagieren?
Die Bereitschaft der Bundesregierung, nun direkte Gespräche mit den De-facto-Autoritäten zu führen, ist aus innenpolitischen Interessen heraus motiviert. Es geht nicht darum, humanitäre Hilfe zu fördern oder gegen Menschenrechtsverstöße vorzugehen. Diese Haltung sendet ein fatales Signal – sowohl an die afghanische Bevölkerung als auch an die Diaspora weltweit. Denn sie zeigt: Menschenrechte sind offenbar zu vernachlässigen, wenn innenpolitischer Druck groß genug ist.
Wird bei Afghanen mit unterschiedlichem Maß gemessen?
Ja, ganz eindeutig. Der politische Wille ist entscheidend. Die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine zeigte, was möglich und welcher Umgang mit Geflüchteten richtig ist: schnelle Aufnahme, unkomplizierte Verfahren, breite gesellschaftliche Solidarität. Afghanische und viele andere Geflüchtete hingegen erleben oftmals Bürokratie, Misstrauen und Ablehnung. Dabei ist Schutzbedürftigkeit keine Frage der Herkunft – sondern der konkreten Gefährdung. Wer Menschen nach politischen Interessen und Herkunft unterschiedlich behandelt, stellt den universellen Anspruch von Menschenrechten in Frage und bedient rassistische Narrative. Für unsere Arbeit bedeutet das: Ohne Stabilität und Rückhalt in Deutschland wird es auch für die Projekte in Afghanistan immer schwieriger.
Hila Limar