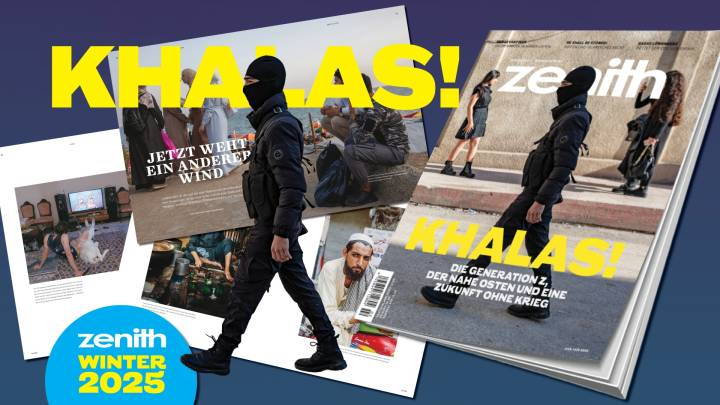Kindertherapeutin Katrin Glatz Brubakk über die psychische Betreuung vor und während der Waffenruhe in Gaza – und worauf es beim Umgang mit traumatisierten Kleinkindern ankommt.
zenith: Frau Glatz Brubakk, Sie kehrten Anfang 2025 zurück in den Gazastreifen. Welches Bild bot sich Ihnen?
Katrin Glatz Brubakk: Die Stimmung war sehr angespannt. Die israelischen Bombenangriffe dauerten bis kurz vor der Waffenruhe am 16. Januar an. Ein Kollege wollte an diesem Tag frühmorgens zur Toilette. Ein Geschoss durchschlug die Zeltwand und verfehlte ihn nur um wenige Zentimeter. Die Menschen haben diesen Tag herbeigesehnt, sie hatten die Hoffnung, endlich wieder so etwas wie ein normales Leben führen zu können, und natürlich waren sie erleichtert. Nur muss man zwischen Hoffnung und Glauben unterscheiden. Trotz der immensen Zerstörung hoffen die meisten Menschen, dass sie ihre Häuser wieder aufbauen können. Aber nur wenige glauben auch daran – das hat sie die Erfahrung der letzten Monate gelehrt.
Sie sind im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im Einsatz. Reichen die Hilfsgüter aus, um den Bedarf zu decken?
Es kommen mehr Hilfsgüter an als früher – das ist an sich gut. Aber mit 600 Lastwagen pro Tag bewegt sich das Volumen in der gleichen Größenordnung wie vor dem Krieg, also während der Blockade des Gazastreifens. Im Winter ist es eisig kalt in den Zelten. Es regnet herein, denn die Zelte sind notdürftig aus Planen und Teppichen errichtet. Gerade traumatisierte Kinder brauchen Sicherheit und Geborgenheit – die Bedingungen dafür sind absolut nicht gegeben.
Welchen Herausforderungen stehen Sie bei der psychologischen Betreuung von Kindern gegenüber?
Als ich im August und September hier war, fielen die Bomben ohne Unterlass. Es gab keine Atempause. Wenn man abends zu Bett ging, wusste man nicht, wer am nächsten Morgen noch leben würde. Unter diesen Bedingungen litten die Kinder häufig unter Panikattacken, die oft durch Kleinigkeiten ausgelöst wurden: eine Tür, die zu schnell zufiel. Oder das Geräusch, wenn die Schwestern die Verbände wechseln. Es ist sehr schwierig, mit den Kindern Kontakt aufzunehmen. Sie starren durch einen hindurch, so verängstigt sind sie. Diese Symptome der erlittenen Traumata begegnen mir hier immer noch – aber seit Beginn der Waffenruhe seltener, weil die hohe Stressbelastung etwas abgenommen hat.
Welche langfristigen Folgen des Krieges sind bereits jetzt sichtbar?
Alpträume rauben vielen Kindern den Schlaf. Gerade kleine Kinder erleben extreme Verlustängste. Ein dreijähriges Mädchen, das ich behandelte, war bei einem Bombenangriff verletzt worden, ihre einjährige Schwester war verhungert. Weil sie so große Angst hat, dass noch mehr Menschen sterben könnten, klammert sie sich fast ununterbrochen an ihre Mutter.
»Spielen ist die Sprache der Kinder. So drücken sie sich aus und kommunizieren ihre Gefühlswelt«
Ist dieses Verhalten häufig bei traumatisierten Kindern zu beobachten?
Sie empfinden die Welt als so unberechenbar, dass sie ständig auf der Hut vor Gefahren sind. Sie setzen alle ihre Kräfte ein, um irgendwie sicherzustellen, dass nichts Schlimmes passiert. In solchen Fällen treten Entwicklungsstörungen auf: Gerade in dieser Lebensphase sollten sie eigentlich Wissen erwerben, sprechen und lernen, mit anderen Kindern umzugehen. Dafür haben sie einfach nicht genug Kraft und Energie. Selbst wenn der Krieg heute enden würde, bleiben nachhaltige Schäden zurück, und es wird Jahre dauern, diese Entwicklungsschritte nachzuholen. Dieser Krieg wird in den Kindern von Gaza noch lange weiterleben. In Form von Albträumen, Entwicklungs- und Angststörungen.
Welche therapeutischen Ansätze können helfen?
Jedes Kind in Gaza ist von diesem Krieg betroffen. Einige natürlich mehr als andere. Und so gesehen bräuchten wir jetzt massive Ressourcen, vor allem für Traumatherapien. Dafür braucht es einen stabilen Rahmen. Dazu gehören auch Menschen, die einem zur Seite stehen. Oder auch die Sicherheit, dass man schlafen kann. Obwohl während der Waffenruhe keine Bomben fallen, gibt es diese Stabilität in Gaza nicht. Die Kinder leben immer noch in Zelten, können nicht zur Schule gehen, und die Eltern sind oft selbst traumatisiert und kommen kaum durch den Tag. Unter diesen Umständen können wir nur helfen, mit den Symptomen umzugehen. Wie können sie besser einschlafen, wie entspannen sie sich, wie gehen sie mit ihren Gedanken und schlimmen Erlebnissen um? Mit kleineren Kindern spiele ich auch viel. Das heißt entweder malen, etwas bauen oder auch Geschichten erzählen. Denn Spielen ist die Sprache der Kinder. So drücken sie sich aus und teilen ihre Gefühlswelt mit.
Können Sie so auch traumatisierten Kleinkindern helfen?
Wenn wir gestresst sind, atmen wir sehr hoch in der Brust. Das ist ein biologisches Signal an den Körper: Achtung, Gefahr, Vorsicht! Durch tiefes Atmen kann sich das Nervensystem wieder beruhigen. So verhindert man, dass der Stress chronisch wird. Mit einem Fünfjährigen solche Atemübungen zu machen, ist nicht einfach. Seifenblasen bieten hier eine Möglichkeit. Denn man muss sehr tief einatmen und sich konzentrieren. Das hilft, negative Gedanken auszublenden – und das im Rahmen einer spielerischen Aktivität. Im Spiel regulieren wir die Emotionen der Kinder. Wir lenken sie ab und geben ihnen eine Pause, damit sie sich entspannen können. Ja, ich bin die Dame, die im Krieg ständig Seifenblasen macht. Das sieht von außen vielleicht albern aus. Aber dahinter steckt wichtige therapeutische Arbeit.
Inwiefern lassen sich die Eltern in diese spielerischen Ansätze mit einbinden?
Die Patienten bleiben nur wenige Wochen bei uns. Danach werden sie in die Obhut ihrer Eltern entlassen. Die NGO »Save the Children« hat errechnet, dass bis zu 40 Prozent der Familien in Gaza inzwischen auch für fremde Kinder sorgen, weil die Eltern zu krank, vermisst oder tot sind. Diesen Betreuern bieten wir Kurse an. Dort lernen sie, mit ihrem eigenen Stress umzugehen. Denn Kinder beruhigt man, indem man selbst Ruhe ausstrahlt. Wir befähigen sie auch, typische Reaktionen bei Kindern zu erkennen, die traumatische Erlebnisse hatten. Zum Beispiel, wenn ein achtjähriges Kind plötzlich aufhört zu sprechen. Ein Zwölfjähriger, der ins Bett macht, weil er Albträume hat. Oder ein Zweijähriger, der anfängt, sich die Haare auszureißen. Indem wir ihnen erklären, dass dies normale Reaktionen von schwer traumatisierten Kindern sind, können wir die Eltern ein Stück weit beruhigen. Und wir geben ihnen Methoden an die Hand, wie sie ihren Kindern helfen können.
»Wie können sie besser einschlafen, wie entspannen, mit ihren Gedanken und schlimmen Erfahrungen umgehen?«
Die therapeutische Arbeit mit den Kindern hilft auch den Erwachsenen?
Beim Seifenblasen kann ich das beobachten. Auch Erwachsene brauchen mal eine Pause. Sie wollen ebenso mal lachen und einfach einen Moment unbeschwert sein. Und das überträgt sich auf andere Patienten im Krankenhaus. Neulich kam ein älterer Herr um die siebzig auf mich zu und zeigte auf ein Zimmer: »Hier musst du auch Seifenblasen machen!« Dort lag kein Kind, sondern sein über 30-jähriger Sohn. Er war am ganzen Körper mit Brandwunden übersät. Ich dachte, das wird jetzt peinlich. Aber dann sieht man die Freude in den Augen: Endlich kann man sich auf etwas anderes konzentrieren, einfach mal lächeln. Das hilft auch den Erwachsenen.
Helfen solche nonverbalen Ansätze auch, mögliche Sprachbarrieren zu überwinden?
Ich leite ein Team von 17 Psychologen und Sozialarbeitern. Ich bin hier also nicht nur Therapeutin, sondern unterstütze mein Team zum Beispiel bei komplizierteren Fällen und bilde es auch weiter. Meine Kollegen sprechen alle Arabisch und machen den größten Teil dieser Arbeit. Ich auch, aber dann oft im Dialog mit den Eltern, die Englisch sprechen. Denn viele Menschen in Gaza sind sehr gut ausgebildet und mehrsprachig.
Sie haben auch im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gearbeitet. Welche Parallelen und Unterschiede sind Ihnen in Bezug auf die psychische Belastung der Kinder aufgefallen?
Die Kinder in Moria haben vieles von dem erlebt, was die Kinder in Gaza jetzt durchmachen, nur zeitversetzt. Die meisten von ihnen sind vor einem Krieg geflohen, zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan. Der Unterschied in Gaza ist das Ausmaß der Zerstörung. Alle Institutionen, die normalerweise helfen, traumatisierte Kinder aufzufangen, sind nicht mehr da. Und die 15 Monate andauernden Bombardements und die geschlossenen Grenzen haben die Flucht aus dem Kriegsgebiet unmöglich gemacht. Auch die »humanitären Korridore« sind teilweise unter Beschuss geraten. Die extreme Todesangst, die ich bei Kindern und Erwachsenen beobachte, macht die Situation in Gaza so einzigartig.
Katrin Glatz Brubakk