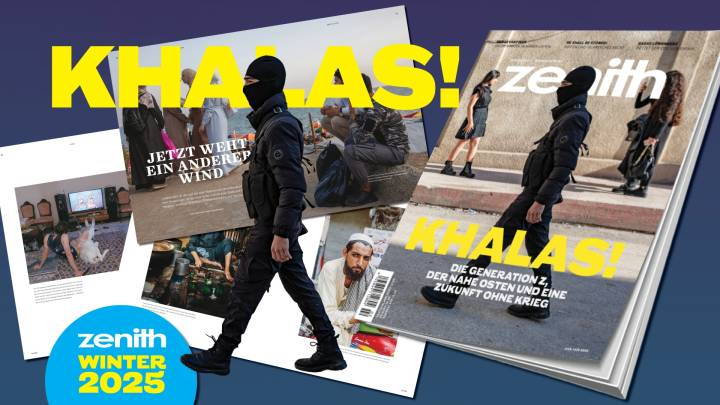Die EU-Kommission schlägt Sanktionen mit fraglichen Erfolgsaussichten vor. Warum Ursula von der Leyens Ankündigung dennoch einen Wendepunkt in Europas Israel-Politik signalisiert.
Ursula von der Leyen fand in ihrer Rede zur Lage der Union am 10 September ungewohnt klare Worte. »Die Kommission wird alles in ihrer Macht Stehende selbst tun. […] Doch ohne Mehrheit kommen wir da nicht weiter. Und das müssen wir überwinden. Lähmung können wir uns nicht leisten.« Neben Forderungen nach Waffenstillstand und einem humanitären Zugang stellte sie konkrete Maßnahmen vor, die bisher als rote Linie galten. Wenn es nach ihr ginge, suspendiert Brüssel Handelserleichterungen, setzt extremistische Minister auf schwarze Listen und friert bilaterale Unterstützungsgelder ein. All das, um Tel Aviv zu einem Ende der Kampfhandlungen im Gazastreifen zu bewegen. Die Frage ist nun, ob aus symbolischen Gesten tatsächliche Machtprojektion wird und wie wirkmächtig diese überhaupt sein kann.
Ganz aus dem Nichts kam dieser Schritt nicht, er ist vielmehr Folge eines langen politischen Prozesses. Schon im Februar 2024 hatten Spanien und Irland eine Überprüfung von Artikel 2 des EU-Israel-Assoziierungsabkommens beantragt, der Menschenrechte und demokratische Prinzipien zur Bedingung macht. Im Mai dieses Jahres stimmte eine Mehrheit von 17 Mitgliedsstaaten für eine Überprüfung. Parallel dazu landeten erstmals radikale Siedlergruppen, die »Hilltop Youth« und »Lehava« auf der EU-Sanktionsliste. Acht Länder, darunter Großbritannien, Kanada und Spanien, belegten die Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich mit Einreiseverboten und Vermögenssperren.
Inzwischen haben 156 UN-Mitglieder die Eigenstaatlichkeit und damit Souveränität Palästinas anerkannt, darunter vier der fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat, dem einzigen Gremium, das völkerrechtlich bindende Beschlüsse zu Krieg und Frieden fassen kann. Zuletzt gingen Frankreich, Großbritannien, Belgien und sechs weitere Staaten Mitte September diesen Schritt. Mit ihren neuen Maßnahmen versucht die EU-Kommission, sich diese Dynamik auf internationaler Ebene zunutze zu machen, um den Stillstand in Brüssel zu überwinden. Die Erfolgsaussichten sind zum Teil fraglich, doch schöpft die EU-Kommission ihren verfügbaren Handlungsspielraum aus, um den Druck auf Israel zu maximieren und zugleich ihrem Anspruch an eine wertebasierte Außenpolitik gerecht zu werden.
Im Fall Israel vergingen elf Monate, bis konkrete Sanktionen auf den Tisch kamen
Die EU bewegt sich mit ihrer Position auf dem Boden aktueller Urteile sowie verbindlicher Vertragsklauseln. Ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) erklärte im Juli 2024 die israelische Besatzung der Palästinensischen Gebiete für völkerrechtswidrig. Artikel 2 des Assoziierungsabkommens verpflichtet die EU zudem, bei systematischen Menschenrechtsverletzungen zu reagieren.
Aus ökonomischer Sicht ist die Europäische Union Israels wichtigste Partnerin. 42,6 Milliarden Euro beträgt das Handelsvolumen, 37 Prozent der israelischen Exporte gehen in die EU. Die von Brüssel angekündigten Strafzölle könnten Israel rund 227 Millionen Euro kosten. Noch sind das Summen, die nicht weit über einen symbolischen Charakter hinausgehen.
Der Kontrast zur Ukraine-Politik ist überdeutlich. Als Russland am 24. Februar 2022 in das Nachbarland einmarschierte, hatte die EU schon drei Sanktionspakete beschlossen. Binnen weniger Tage folgten SWIFT-Ausschluss und Zentralbank-Sanktionen. Bis heute hat Brüssel 18 Maßnahmenpakete gegen Moskau verabschiedet. Im Fall Israel vergingen elf Monate, bis konkrete Sanktionen auf den Tisch kamen.
Unter Premierminister Pedro Sánchez zählt Spanien zu den stärksten politischen Unterstützern der Palästinenser in der EU
Die ersten Wochen und Monate des Krieges, der auf den Überfall am 7. Oktober 2023 folgte, ebneten dabei maßgeblich den Weg. Die USA und zentrale EU-Staaten verharrten in passiver Beobachtung, unter Verweis auf Israels Recht auf Selbstverteidigung, das im Oktober reflexartig und vielfach von dutzenden Regierungen bekräftigt wurde. Appelle zur Deeskalation verhallten dagegen ungehört. Und an dieser Laufrichtung hielt man fest. Aus dem Weißen Haus und aus Brüssel hieß es unisono, man arbeite unermüdlich an einem Waffenstillstand und ein palästinensischer Staat bleibe Teil der politischen Vision. Die zunehmend entgrenzte Rhetorik aus Netanyahus Kabinett wurde ignoriert, relativiert oder erst gar nicht zur Kenntnis genommen.
Die Fürsprecher dieser Strategie hofften womöglich auf das historische Muster israelischer Kriege: kurze intensive Operationen mit großer Signalwirkung. Der Suezkrieg 1956 dauerte eine Woche, der Sechstagekrieg 1967 eben sechs Tage. Im Jom-Kippur-Krieg 1973 dauerten die Kämpfe knapp drei Wochen, im Libanonkrieg 2006 etwas mehr als einen Monat. Und auch in Gaza endeten die Operationen 2008, 2012, 2014 und 2021 nach Tagen oder wenigen Wochen.
Dieser Gaza-Krieg sprengt diese Logik. Seit fast zwei Jahren dauern die Kämpfe an, zuletzt mit erneuten Offensiven in Gaza-Stadt. Diese Dauer eröffnete Netanyahu einen Handlungsspielraum zwischen Achtung und Ahndung, der Verstöße gegen Völkerrecht, demokratische Prinzipien und Rechtsstaatlichkeit ausreizte. So wurde das Spielen auf Zeit zur militärischen Strategie, die zunehmend internationale Partnerschaften belastet und die EU stärker unter Druck setzt.
Unter Premierminister Pedro Sánchez zählt Spanien zu den stärksten politischen Unterstützern der Palästinenser in der EU. Madrid beschloss schon im Oktober 2023 ein Ausfuhrstopp für Waffen nach Israel, verhängte Sanktionen gegen gewalttätige Siedler und erkannte im Mai 2024 Palästina offiziell an. Israels Regierung reagierte unter anderem mit Einreiseverboten gegen spanische Minister.
43 Prozent der EU-Ausfuhren entfallen auf Maschinen und Transportausrüstung – genau die Bereiche, die für Deutschland und Italien besonders wichtig sind
Diese bilateralen Maßnahmen beeinflussen Israels Kriegsführung nicht, aber sie zeigen: Aus Worten können Taten werden, aus Symbolen Politik. Auch Irland, Belgien und Slowenien drängten auf härteres Vorgehen. Diesen Staaten gegenüber stehen Deutschland, Italien, Ungarn, Österreich und Tschechien, die aus unterschiedlichen, oft historisch begründeten Motiven Sanktionen gegen Israel ablehnen. Dazu kommen aber auch pragmatische Gründe. So ist die Zusammenarbeit beim Austausch von Geheimdienstinformationen für viele Dienste in der EU essenziell. Im Angesicht der wachsenden Bedrohung durch Russland – gerade in der Luft – hofft die EU auf Technologietransfer für den Verteidigungsschirm.
Sanktionen bergen allerdings auch wirtschaftliche Risiken für Europa. 43 Prozent der EU-Ausfuhren entfallen auf Maschinen und Transportausrüstung – genau die Bereiche, die für Deutschland (4,8 Milliarden Euro) und Italien (3,1 Milliarden Euro) besonders wichtig sind. Die derzeit geplanten Sanktionen hätten unmittelbar nur geringe Auswirkungen, doch mit weiteren Sanktionspaketen könnten die Verluste deutlich steigen.
Für immer mehr Mitgliedstaaten gewinnen die innenpolitischen Abwägungen gegenüber solchen ökonomischen Unannehmlichkeiten aber an Bedeutung. In den Niederlanden etwa trat Außenminister Caspar Veldkamp am 22. August aus der Regierung aus, weil er mit seiner Forderung nach härteren Sanktionen gegen Israel in der Koalition gescheitert war. Ihm folgten vier Amtskollegen seiner Partei.
Bei Aussetzung des Assoziierungsabkommens würden 4 Prozent Zölle auf israelische Einfuhren aufgeschlagen. Solche Symbolpolitik kann Wirkung entfalten, wenn sie kollektiv und konsequent durchgehalten wird: zum Beispiel als Basis für weitergehende Maßnahmen. Demonstrativ stehen die USA als letzte Veto-Macht im UN-Sicherheitsrat und Patron Israels gegen die Anerkennung des Staates Palästinas. Trump hat keinen direkten Einfluss auf die Prüfung des Assoziierungsabkommens, aber Entscheidungsträger in Europa hüten sich davor, ihn zu verärgern.
Eine Aussetzung des EU-Forschungsprogramms »Horizon Europe« benötigt ebenso eine qualifizierte Mehrheit
Am 20. Oktober befasst sich der Außenministerrat mit dem Kommissionsvorschlag, dabei könnten erste Weichen beim informellen EU-Gipfel Anfang Oktober in Kopenhagen gestellt werden. Die Beschlüsse würden mit qualifizierter Mehrheit gefasst, also mindestens 15 Mitgliedsstaaten, die gemeinsam mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung abbilden. Deutschlands Position ist noch nicht abschließend geklärt, dabei könnte Berlin seine Blockadehaltung vom Juni revidieren. Ohne die deutsche Zustimmung ist dieses Votum wohl nur schwer zu erreichen.
Deutschland bleibt so das Zünglein an der Waage. Unter Außenminister Johann Wadephul hat Berlin einen zuweilen schärferen Ton gegenüber Israel angeschlagen. Laut Forsa-Umfrage wünschen sich drei Viertel der Deutschen mehr Druck auf Netanyahu. Doch die »historische Verantwortung« bleibt politisch handlungsleitend und kollidiert mit der juristischen Pflicht, Völkerrechtsbrüche nicht zu tolerieren. Eine vergleichbare Schlüsselrolle spielt Italien: Mit 13 Prozent der EU-Bevölkerung könnte Rom gemeinsam mit kleineren Staaten (anbieten würden sich etwa Ungarn, Tschechien und Österreich) ebenfalls eine Sperrminorität bilden – so wie Deutschland mit seinen 19 Prozent.
Auch bei den personalisierten Sanktionen bleiben die Aussichten auf Umsetzung überschaubar. Die Listung von neun gewalttätigen Siedlern und den Ministern Ben-Gvir und Smotrich erfordern Einstimmigkeit unter den Mitgliedsstaaten. Ungarn blockierte bereits 2024 vergleichbare Anträge, unter Verweis auf nationale Interessen und zusätzliche Prüfbedarfe, und nutzte sein Vetorecht wiederholt als politisches Druckmittel.
Eine Aussetzung des EU-Forschungsprogramms »Horizon Europe« benötigt ebenso eine qualifizierte Mehrheit, da die Teilnahme dritter Staaten auf geltenden Bestimmungen der Forschungs- und Innovationspolitik basiert. Der Kommissionsvorschlag zur teilweisen Suspendierung der israelischen Beteiligung wird daher nicht im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, sondern unter bildungspolitischen Gesichtspunkten behandelt. Damit greift automatisch das ordentliche Verfahren im Rat mit qualifizierter Mehrheit statt Einstimmigkeit. Die Aussichten auf eine Annahme sind vergleichbar mit denen zur Aussetzung des Assoziierungsabkommens.