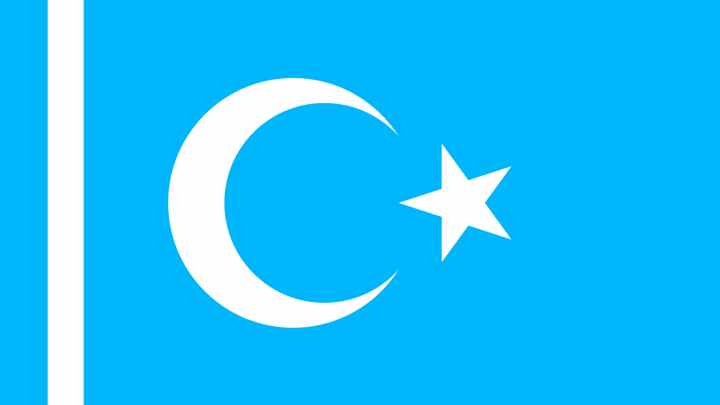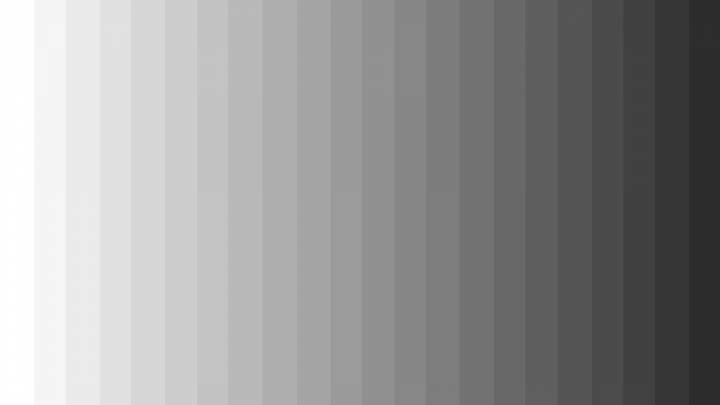Um Haaresbreite verpasste Syrien im Herbst die erste WM-Teilnahme. Das Assad-Regime inszeniert den sportlichen Achtungserfolg als Plädoyer für den Präsidenten. Doch Krieg und Folter machten auch vor dem Sport nicht halt.
Als die Syrer die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland verspielt hatten, war die Geschichte der Kommerzialisierung des Weltfußballs um eine weitere, nicht eben unpassende Anekdote reicher. Der Australier Tim Cahill hatte am 10. Oktober in Sydney in der 109. Minute, in der zweiten Hälfte der Verlängerung des zweiten Play-off-Qualifikationsspiels, sein zweites Tor geköpft. Den Jubel über die Entscheidung im Duell um einen WM-Startplatz hatte Cahill an eine Online-Reiseagentur verkauft, deren Markenzeichen – den Buchstaben T – er nun mit beiden Armen formte. Eine konsequente Weiterentwicklung des fußballerischen Geschäftssinns gewissermaßen, schreiben Sportjournalisten doch häufig von der »Reise zum Titel«, auf die sich eine Mannschaft gemacht habe, von den »Tickets, die für ein Turnier gebucht« wurden, und regelmäßig kommt auch eine Mannschaft am »Ziel ihrer Träume« an.
Für die Verlierer des dramatischen Play-off-Spiels von Sydney, für die syrische Fußballnationalmannschaft, gab es keine WM-Qualifikation. Gab es keine »Fahrkarten nach Russland«, war der Traum von der ersten Teilnahme an einer Fußball-WM geplatzt. Ihre Reise aber führte sie noch weiter. Zurück in die Heimat, zurück ins Herz des Landes, für das mancher von ihnen nicht mehr hatte spielen wollen und es nun doch wieder tat. Zurück in das Syrien, in dem Bürgerkrieg herrscht. Zurück in das Land, in dem Baschar Al-Assad herrscht.
Am 23. Oktober empfing der syrische Präsident die Fußball-Nationalmannschaft, sendete der Account @Presidency_Sy Twitter-Fotos vom Kriegsherrn mit den Kickern. Prominent platziert: Firas Al-Khatib. Auf einem der Bilder scheint er mit dem Präsidenten zu plaudern, schaut Assad an, der rechts von ihm geht und den Kopf leicht zum Fußballspieler hinunter neigt.
Teheran, Azadi-Stadion, sechs Wochen zuvor. Die Syrer brauchen ein Ergebnis, wenigstens ein Unentschieden, bei der stärksten Mannschaft der Qualifikationsgruppe, um im Rennen um die Weltmeisterschaft zu bleiben. Firas Al-Khatib ist bereit, es zu liefern. Seit 2012 hatte er nicht mehr für die syrische Nationalmannschaft gespielt – aus Protest und Widerwillen. Khatib hatte sich für die Opposition entschieden. »Ich habe Angst, ich habe Angst«, hatte er im Februar 2017 dem US-amerikanischen Sportsender ESPN offenbart. »In Syrien wirst du jetzt umgebracht. Für das, was du sagst. Nicht für das, was du tust. Sie töten dich für das, was du denkst.
Als das Tor in Teheran fällt, jubeln die Menschen in Damaskus, die das Spiel zu Tausenden beim Public Viewing verfolgen
Damals hatte er darüber nachgedacht, ob er wieder für Syrien spielen solle, für die Nationalmannschaft, für Assads Syrien. Khatib stammt aus Homs, einem Zentrum der Opposition, das von Assad ausgehungert wurde, bis die Menschen Gras essen mussten, sagen Oppositionelle. Sollte Khatib wieder für dieses Syrien spielen? Seine Verwandten leben in Homs, bis heute. Ein, zwei Stunden, hatte er im Frühjahr gesagt, denke er darüber nach, Abend für Abend, vor dem Einschlafen. »In Syrien laufen inzwischen so viele Mörder herum. Nicht nur ein oder zwei. Und ich hasse sie alle.« Khatib entschied sich dafür, wieder für Syrien aufzulaufen. Am 5. September führt er die Mannschaft gegen Iran als Kapitän aufs Feld. Er wird nach 60 Minuten ausgewechselt. In der 93. Minute trifft Omar Al-Soma zum 2:2-Ausgleich für die Syrer. Auch er hatte sich mit der Opposition identifiziert. Am 20. Dezember 2012 hatte Soma mit einer Flagge der Opposition gejubelt, als die syrische Mannschaft in Kuwait-Stadt die Westasien-Meisterschaft gewann. Im September 2017 in Teheran jubeln Khatib und Soma vor der schwarz-weiß-roten Flagge mit den zwei grünen Sternen, vor Fans, die Plakate mit Assads Konterfei über ihren Köpfen schwenken.
Als das Tor in Teheran fällt, jubeln die Menschen in Damaskus, die das Spiel zu Tausenden beim Public Viewing verfolgen. Autos fahren hupend durch die Stadt – so nah war Syrien einer Fußballweltmeisterschaft noch nie. Und wie es so ist mit der Freude über den Fußball: So weit weg war der Alltag für die Menschen, die da jubelten, wohl auch selten in den vergangenen Jahren, jedenfalls für zwei Stunden oder eine oder wenigstens ein paar Augenblicke.
Und doch bedeutete das Tor von Teheran auch einen weiteren Schritt zur Umsetzung eines Projekts des syrischen Präsidenten. Die Spielergeneration, die in den Jahren vor dem Bürgerkrieg heranwächst, profitiert vom Geld, dass Baschar Al-Assad in die Infrastruktur des syrischen Fußballs gesteckt hatte, im Jahrzehnt vor dem Bürgerkrieg. Wie so viele Potentaten vor ihm hatte er erkannt, dass Spieler, die für Syrien auflaufen, für sein Syrien auflaufen. Ob sie wollen oder nicht.
Die Nähe von Politikern zu Sportlern wächst, unabhängig vom politischen System, mit deren Erfolg. Angela Merkel ließ sich auch schon in der Kabine im Kreise der Nationalmannschaft inszenieren, bei der Weltmeisterschaft 2014 zum Beispiel. Gerade in der arabischen Welt aber hat die Einflussnahme der Machthaber auf den Sport im Allgemeinen und den Fußball im Besonderen eine traurige und brutale Tradition.
1986, in Syrien, hatte Hafiz Al-Assad noch lange Jahre der Herrschaft vor sich, hatte das Nachbarland Irak zum ersten und bis heute einzigen Mal an einer Weltmeisterschaft teilgenommen – nachdem sich die Mannschaft in Play-off-Spielen gegen die Syrer durchgesetzt hatte. Spieler, die für das Land und den Clan Saddam Husseins in Mexiko aufliefen, berichteten Jahrzehnte später vom Schrecken, der sie begleitete.
Saddams Sohn Udai, 1964, ein Jahr vor Baschar Al-Assad geboren, hatte 1984 die Kontrolle im irakischen Fußballverband und im Nationalen Olympischen Komitee übernommen. Die Spieler bekamen die Vorlieben des Diktatorensohns zu spüren, als er vor der WM in Mexiko die Trikotfarben vom traditionellen Grün-Weiß zu Hellblau und Kanariengelb wechseln ließ, weil sein Lieblingsklub – der von ihm gegründete SC Al-Raschid – in diesen Farben auflief.
Persönliche Bestrafungen für Minderleistungen auf dem Spielfeld beschränkten sich zunächst vornehmlich auf Haarschnitte. Torhüter Ahmad Ali, der für Al-Raschid und die irakische Nationalmannschaft spielte, behauptete 2014 gegenüber dem Journalisten Omar Almasri, ihm seien in jenen Jahren viermal die Haare gestutzt worden: »Und zwar, weil ich es verdiente.« Wie Ali sind etliche Iraker auch heute noch stolz auf die sportlichen Erfolge von damals – obwohl Udai Hussein schon bald seinen Sadismus immer brutaler auslebte.
Udai Hussein folterte Sportler bei Misserfolgen, bei Niederlagen, wenn sein persönlicher Erwartungshorizont nicht erfüllt wurde. Das volle Ausmaß offenbarte sich nach dem Sturz und Tod der Husseins infolge der US-Invasion 2003, doch schon in den 1990er Jahren hatten ehemalige Spieler vom Terror im irakischen Sport berichtet. Der Internationale Fußballverband Fifa und das Internationale Olympische Komitee schritten nie maßgeblich ein.
Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft, der seinen Club aus Homs 2006 ins Finale der asiatischen Champions League geführt hatte, starb zehn Jahre später im Folterknast
Wie einst die Iraker, die ihre Qualifikationsspiele 1984 und 1985 während des anhaltenden ersten Golfkrieges außerhalb Iraks austragen mussten, spielen auch die Syrer auf Anweisung der Fifa seit Jahren nicht mehr in der Heimat. Während die Mannschaft ihr Play-off-Heimspiel gegen die Australier am 5. Oktober 2017 in Krubong, an der Straße von Malakka in Malaysia, austrug, twitterte der in London lebende Journalist Oz Katerji eine Liste von Spielern, die ihre Opposition zum Syrien Baschar Al-Assads nicht überlebt haben. »Ich kann dieses Spiel nicht von seinem politischen Kontext trennen«, schrieb Katerji. »Aber ich respektiere die Syrer, die es getan haben und die Mannschaft unterstützen.«
Seinen Angaben zufolge sind seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 über 100 Profifußballer in Syrien verschwunden. ESPN schrieb im Frühjahr 2017 von 38 Fußballspielern der ersten und zweiten syrischen Liga, die den Bürgerkrieg nicht überlebt haben. Erschossen, ermordet, zu Tode gefoltert. Der bekannteste Fall: Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft, Dschihad Kasseb, wurde im Militärgefängnis Sednaya, gut 30 Kilometer von Damaskus entfernt, zu Tode gefoltert. Der Spieler von Al-Karama, der die Mannschaft aus seiner Heimatstadt Homs 2006 als erstes syrisches Team bis ins Finale der asiatischen Champions League geführt hatte, starb zehn Jahre später an den Folgen der Folter der Schergen des syrischen Präsidenten. Das war im Herbst 2016, einige Monate später bezeichnete Amnesty International Sednaya als »Schlachthaus für Menschen«.
Auch andere Spieler aus Homs hatten sich der Opposition angeschlossen. Torhüter Mosab Balhus saß im Gefängnis, weil er Mannschaftskameraden zum bewaffneten Kampf gegen Assad angestachelt haben soll – und stand später wieder im Tor der Nationalmannschaft. Auch Sportler in anderen Disziplinen mussten flüchten, wie die nach Berlin emigrierte Schwimmerin Yusra Mardini, die inzwischen Sonderbotschafterin des UN-Flüchtlingshilfswerks ist. Rund 400 Sportler aber starben bisher, schätzt Katerji – im Krieg, durch Folter. »Die überwiegende Mehrzahl auf Assads Befehl«, schreibt er.
Der Präsident in Damaskus spannte die Erfolge der Fußballmannschaft mehr und mehr für seine Zwecke ein, je mehr die Chancen auf die WM-Qualifikation stiegen. »Jeder Syrer in Syrien repräsentiert Präsident Baschar Al-Assad, und seine Exzellenz Präsident Dr. Baschar Al-Assad repräsentiert uns«, ließ Fadi Dabbas, der Vizepräsident des syrischen Fußballverbandes, im Frühjahr gegenüber ESPN verlautbaren. »Wir sind stolz auf unseren Präsidenten. Wir sind stolz darauf, was er erreicht hat. Wir wollen ihm unsere Grüße und unseren Dank für das, was er für Syrien getan hat, schicken, wir stehen hinter ihm und unter seiner Führung.«
Wie sehr die Spieler tatsächlich unter Assads Führung standen, wurde deutlich, als Trainer Fajr Ibrahim und Mittelfeldspieler Osama Omari im November 2015 mit T-Shirts bei einer Pressekonferenz in Singapur auftauchten, auf denen der Präsident lachte. Freiwillig, selbstverständlich, schwor der Coach. »Wir lieben unseren Präsidenten. Er kämpft auch für Sie. Er ist der beste Mensch der Welt.«
Die Fifa, die Verbände stets sperrt, wenn missliebige Verbandspräsidenten von Regierungen abgesetzt werden – und das geschah in den vergangenen Jahren dutzendfach –, reagierte, wie immer in diesen Fällen offensichtlicher politischer Einfluss- und Parteinahme durch die Regierung: gar nicht. Solange der Fußballapparat funktionierender Teil des regierenden Staatsapparats ist, bietet sich politischen Propagandakampagnen ein weites Feld.
Diese Erfahrung machte auch der nach Schweden geflüchtete ehemalige Spieler Aiman Kaschit, der mehrfach nach Zürich gereist war, um die Fifa auf die Fälle von Verfolgung und Folter gegen Fußballspieler in Syrien hinzuweisen. Er möge sich beim syrischen Verband beschweren, bekam Kaschit zu hören. Bei dem Verband, der dem Assad-Regime als wichtiger Arm der Auslandspropaganda dient.
Dass die Fifa die ideologische Überhöhung von Qualifikationsspielen durchaus registriert, bekam der iranische Verband im Herbst 2016 zu spüren: Für die religiösen Gesänge und Banner der Fans, die das Spiel am Tag vor dem schiitischen Aschura-Fest in Teheran gegen Südkorea begleiteten, wurde der iranische Fußballverband mit einer Geldstrafe von 45.000 Schweizer Franken belegt.
Im Falle Syriens aber galt: Mochten Spieler und Trainer das Konterfei des Präsidenten und Kriegsherrn über dem Herzen tragen, mochten syrische Fans immer wieder Assad-Poster auf die Tribünen schleppen und ausrollen – die Fifa wollte nur das eindimensionale Märchen des kickenden Aschenputtels sehen, die für 90 Minuten Ablenkung sorgten.
Die Fifa wollte nur das eindimensionale Märchen des kickenden Aschenputtels sehen, die für 90 Minuten Ablenkung sorgten
Viele Syrer, jene, die mit Assad gebrochen haben, stellte der Erfolg der Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren vor ein echtes Dilemma. War das ihr Team? Konnte es ihr Team sein, wenn es zugleich sein Team war? Es waren ihre Spieler. Und seine Funktionäre. Es war ihr Land. Aber nicht ihr Präsident. Sondern ihr Feind. »Manche revolutionären Syrer haben sich entschlossen«, schrieb Oz Katerji im Oktober, »die WM-Qualifikationsrunde zu unterstützen, weil sie meinen, der Sport sei von der Politik zu trennen. Viele andere stellen sich gegen die Mannschaft, weil sie darauf bestehen, dass sie Assad dient und seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit übertüncht. Diese Debatte ist Angelegenheit der Syrer, und zwar der Syrer allein.«
Und Faris Al-Khatib, 34 Jahre alt, der Spieler, von dem sie sagen, dass er der beste Mittelfeldspieler wenigstens seiner Generation sei, der Generation, die auf alle Zeiten vom Krieg stigmatisiert sein wird? Der Spieler, der, als der Traum von der Weltmeisterschaft vorüber war, der Krieg aber nicht, auf dem Bild, das aus dem syrischen Präsidentenpalast versendet wurde, mit Baschar Al-Assad zu plaudern scheint? »Es ist sehr kompliziert«, hatte Khatib im Frühjahr gesagt. »Ich möchte mehr sagen, aber ich kann es nicht. Es ist besser so für mich, mein Land, meine Familie, für alle, wenn ich nicht rede.«
CHRISTOPH BECKER ist Sportredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).