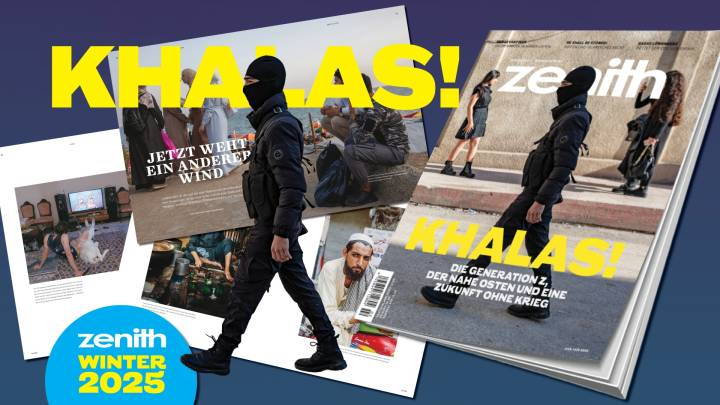Mit ihrer Gaza-Politik hat sich die Bundesrepublik in eine Sackgasse manövriert. Höchste Zeit, sich wieder auf das zu besinnen, was ihre Soft Power einst ausgemacht hat.
Eine der denkwürdigsten Erfahrungen, die man als junger Mitarbeiter oder Leiter deutscher Organisationen im Ausland macht: mitzubekommen, wie positiv der Ruf des eigenen Landes ist. Fast schon befremdlich positiv möchte man anfügen, denn junge Deutsche wachsen vielfach mit einem sehr kritischen Selbstbild auf – was aus Sicht des Auslands oft völlig ungerechtfertigt erscheint.
65 Jahre bundesdeutscher Außenpolitik, zu der nicht nur offizielle diplomatische Vertretungen gehören, sondern auch das mannigfaltige Netzwerk der sogenannten Mittler – offizielle Entwicklungszusammenarbeit, Kulturinstitutionen, Kirchen, politische Stiftungen – haben es vermocht, die Bundesrepublik seit 1949 vom Paria der Weltgemeinschaft in eines ihrer meistgeachteten und verehrten Mitglieder zu verwandeln.
Klar gibt es Klischees, und auch den ein oder anderen peinlichen Moment, wenn einem für Dinge gratuliert wird, auf die man lieber nicht stolz wäre. Im Großen und Ganzen beruft sich das Fremdbild aber auf positive Errungenschaften und zeichnet ein wohlhabendes, politisch stabiles, sozial gerechtes Land, das bei aller außenpolitischer Zurückhaltung auch Kultur und Zivilgesellschaft in den Blick nimmt, überdies gerade im Sozialen und Humanitären viel selbstlose Hilfe leistet, und für das Menschenrechte und internationales Recht nicht nur lästiges Beiwerk sind.
Was für den globalen Süden galt, traf im Besonderen für die arabische Welt und den erweiterten Nahen Osten zu. Auch hier war das Deutschlandbild exzellent. In einer Region also, in der dem politischen Westen insgesamt, gerade in Gestalt der Weltmacht USA und der ehemaligen Kolonialmächte Frankeich und Großbritannien, nicht unerhebliche Ressentiments entgegenschlagen. Es wurde der Bundesrepublik hoch angerechnet, dass sie internationales Recht und eine langfristig orientierte Einschätzung der Lage über das kulturkämpferische Pathos stellte (Nein zum Irak-Krieg, Nein zur Libyen-Intervention), mit dem andere Demokratie und Fortschritt herbeibomben wollten.
Die deutsche Staatsräson war lange mehr Rhetorik, heute dagegen ist sie in Waffen messbar
Selbst die engen Beziehungen zu Israel wirkten sich in der Vergangenheit keinesfalls automatisch nachteilig auf Deutschlands Position in der arabischen Welt aus. Möglicherweise auch, weil Berlin darauf verzichtete, als Oberlehrer aufzutreten und Ambivalenzen zuließ, die sich aus anderen geografischen und historischen Erfahrungen ergaben. Und nicht zuletzt, weil das deutsche Engagement für einen gerechten Frieden und die bedeutende Unterstützung für die palästinensischen Institutionen als aufrichtig wahrgenommen wurden. Womöglich aber auch, weil die deutsche Staatsräson lange mehr Rhetorik war, in Zeiten des Gaza-Krieges dagegen in Waffen messbar ist.
Der Gaza-Krieg und die von Anfang an eindeutige Positionierung Berlins, die auch sechs Monate und mehr als 35.000 Tote später noch so gut wie keine Zwischentöne zuließ, setzt Deutschland nun einer globalen Kritik aus, die für die deutsche Softpower womöglich der tiefsten Zäsur seit der Wiedervereinigung gleichkommt. Mit seiner Metapher von »den Kindern des Lichts gegen die Kinder der Dunkelheit« setzte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu den Ton für ein Zivilisation-hier-Barbarei-und-Terror-dort-Narrativ, das Deutschland damit genauso bereitwillig abnickte wie den frühzeitigen Plan von Verteidigungsminister Yoav Gallant, den Gazastreifen vollständig abzuriegeln.
Trotz derlei finsterster Kolonialrhetorik aus dem Land des vermeintlich werteverwandten Partners stellte Berlin Tel Aviv sehr früh eine carte blanche für das unerbittliche Vorgehen in Gaza aus. Der Bundeskanzler erklärte fast schon apodiktisch, dass das Land als Demokratie nahezu nicht anders könne, als den Prinzipien des Völkerrechts zu genügen – jahrzehntelanger völkerrechtswidriger Annexion, Siedlungspolitik und bereits vor dem 7. Oktober Tausender toter Palästinenser zum Trotz.
Berlin war damit nicht eine Stimme unter vielen in einem pan-westlichen Chor, sondern fand sich plötzlich unfreiwillig exponiert wieder. Wenige spürten das stärker und direkter als die Vertreter deutscher Organisationen im Ausland. Sie sahen sich einer Infragestellung des eigenen Landes ausgesetzt, die auch für langjährig Aktive beispiellos gewesen sein dürfte. Schon diskursiv bewegte man sich in Paralleluniversen – die Begrifflichkeiten zu beschreiben, was in Gaza geschieht, waren nicht mehr dieselben.
Wenige spürten das stärker und direkter als die Vertreter deutscher Organisationen im Ausland
Doch zumindest diejenigen, die ihr Herz weltanschaulich noch nicht völlig verschlossen haben, kommen nicht umhin festzustellen, dass hier womöglich die vielbeschworene Staatsräson kollidiert mit jenen Werten, die gerade diese Bundesregierung mit ihrem Anspruch einer wertegeleiteten, gar feministischen Außenpolitik durchzusetzen gedenkt. Feministisch ist eine Außenpolitik übrigens dann, wenn sie auch die Bedürfnisse besonders vulnerabler Gruppen in den Blick nimmt. Angesichts von fast 15.000 toten Kindern in Gaza, fast 90 Prozent Binnenvertriebenen und einer menschengemachten, gezielt herbeigeführten Hungersnot (Stand Ende März 2024) drängt sich die Frage wie der berühmte Elefant in den Raum, inwiefern dieser Anspruch auch für die komplizierteste unter den Partnerbeziehungen gilt.
Überhaupt geschah die Verkündung unverbrüchlicher Solidarität in seltsamer Verkennung des politischen Charakters mancher, die dort in Israel Regierungsverantwortung tragen. Im vorherrschenden deutschen Diskurs wurde das Ganze als Haltungsfrage behandelt. Durch Realitäten vor Ort, Äußerungen führender Politiker oder der Art der Kriegsführung wollte man sich da lieber nicht stören lassen.
Und so glauben große Teile des globalen Südens wie unter einem Brennglas in der nahezu bedingungslosen Unterstützung für Israels Kriegsführung das ganze Elend deutscher Doppelmoral erkannt zu haben.
Vor allem in der arabischen Welt wurde die deutsche Einseitigkeit frühzeitig als Heuchelei beklagt, die sich vor dem Hintergrund des andauernden Ukraine-Krieges freilich besonders entlarvend ausnimmt. Dessen bewusst sehr moralistische Aufladung als eine Art Weltordnungskrieg stieß außerhalb des Westens von Anfang an auf Widerstände. Heute lässt sich konstatieren, die angestrebte Isolation des Aggressors Russlands ist global gescheitert. Skepsis und Zweifel an der Aufrichtigkeit des westlichen Narrativs spielten Moskau in die Hände. Afghanistan, Irak, Libyen und ja, immer wieder Palästina – das hörte man als Vertreter deutscher Organisationen, wenn man die Frustration heimischer Politiker übermittelte, dass die arabische Welt sich weigere, Russland klar zu isolieren.
Berlin stellte Tel Aviv sehr früh eine carte blanche zur Durchsetzung jeglichen Vorgehens in Gaza aus
Hinzu kommt, dass die Bilder aus Gaza die aus der Ukraine in Sachen Grausamkeit und Elend in den Schatten stellen. Und weil auch die bloßen Zahlen darauf hindeuten, dass das menschliche Leid in Gaza Ausmaße erreicht hat, die nicht mehr hinnehmbar sind – und eben nicht, wie es (nur) in Deutschland immer noch manche sehen möchten, Zeugnis dafür, wie Israel versucht, die Zivilisten in Gaza bestmöglich zu schützen. Entsprechend eindeutig sind auch die globalen Mehrheitsverhältnisse.
Nun ist es nicht so, dass man die Herausforderung in Berlin nicht erkannte. Der Bundeskanzler verband seine Ausrufung einer Zeitenwende mit der Notwendigkeit von »Partnerschaften auf Augenhöhe« mit den Ländern des globalen Südens und warb unermüdlich für eine regelbasierte Weltordnung, die auch einem multipolaren Setting Rechnung trägt.
Doch Gaza wirkt nun für die Skeptiker westlicher Aufrichtigkeit wie eine umfassende Bestätigung all ihrer Zweifel. Wo ist sie jetzt, die Rhetorik schierer Empörung angesichts mutmaßlicher israelischer Kriegsverbrechen? Vernichtungskrieg und Völkermord sind zwei historisch in Deutschland ja eindeutig belastete Begriffe, die aber sehr schnell ihren Eingang in den Mainstream gefunden hatten, als es darum ging, die Putin'sche Aggression gegen die Ukraine zu beschreiben. Verfemt dagegen diejenigen, die es wagen, dieselben Begrifflichkeiten auch nur in die Nähe des israelischen Vorgehens in Gaza zu rücken.
Auch in Sachen Völkermordanklage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) ist Deutschland der weltweit einzige Staat, der Israel juristisch zur Seite springt – während mehrere Dutzend Staaten und große Staatenverbünde ihre Sympathie für die südafrikanische Seite haben erkennen lassen. Stoisch bis hin zur Arroganz beharrt Deutschland darauf, Israel handele nach wie vor im Namen der Selbstverteidigung, der Genozid-Vorwurf entbehre jeder Grundlage – ganz so, als brauche man trotz der 15-zu 2-Mehrheit der Richter-Stimmen, die Südafrikas Klage im Vorverfahren als »plausibel« einstufte, gar kein IGH-Urteil abzuwarten.
Es sind längst die liberalen und westlich gesinnten Eliten, die Deutschland von der Stange gehen
Und längst ist die Staatsräson keine reine Prosa mehr. Nach den USA ist Berlin Israels größter Waffenlieferant. Das Ausmaß der Rüstungskooperation übersteigt vermutlich die Vorstellung, die sich die deutsche Öffentlichkeit davon macht. Indes stoppte die Bundesrepublik wegen der mutmaßlichen Beteiligung einiger Beschäftigter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA am Massaker der Hamas vom 7. Oktober ihre Zahlungen für den Gazastreifen. Und weder Deutschland noch die USA haben die Druckmittel, die gegenüber Israel bestehen, bisher auch nur annähernd genutzt, um auf eine veränderte Kriegsführung und ein Ende der humanitären Katastrophe hinzuwirken. Das macht Deutschland in den Augen vieler im globalen Süden gar mit zur Kriegspartei.
Die Ausmaße dieses Reputationsschadens und Glaubwürdigkeitsverlusts für Deutschland sind derzeit noch nicht absehbar. Vor allem Vertreter deutscher Organisationen, als Antennen des Landes im Ausland, merken jedoch längst, wie massiv sie ausfallen könnten. Gerade in der arabisch-muslimischen Welt, wo das Gaza-Elend nonstop auf die Smartphones projiziert wird, wirkt der wiederauferstandene Nahostkonflikt wie eine Massenpolitisierung.
Die Unfähigkeit breiter medialer und politischer Kreise in Deutschland selbst, eine Differenzierung zuzulassen zwischen einem Engagement für die palästinensische Zivilbevölkerung einerseits und Hamas-Sympathie andererseits, hat als Konsequenz, dass die Mauer dazwischen stückweise fällt. Wenn jegliches pro-palästinensische Engagement kriminalisiert wird, erscheinen die wirklich Radikalen auch weniger abstoßend. Wenn sowieso jeder, der sich für ein Ende des Krieges und der Besatzung einsetzt, unter Antisemitismusverdacht gestellt wird, welcher Begriff bleibt dann noch, die echten Judenhasser zu bezeichnen?
Und so erzielt man nicht nur bei den sonst so wohlgesonnenen und lange sogar verständigen Partnern des globalen Südens Reaktionen von resigniertem Kopfschütteln bis hin zu blanker Wut, sondern stößt auch gerade diejenigen progressiven Kräfte in der arabischen Welt und in Israel und Palästina vor den Kopf, die für Deutschland eigentlich Partner beim Streben nach Frieden im Heiligen Land sein sollten. Es sind längst die liberalen und westlich gesinnten Eliten, die Deutschland von der Stange gehen, während man sich selbst einreiht in die Parade rechtspopulistischer und -radikaler Kräfte – von Trump über Orban, von Bolsonaro zur AfD und Milei bis Wilders – die Israel so verehren.
Die Art der Kriegsführung, die Israel im globalen Süden so viel Empörung entgegenschlagen lässt, eben keineswegs so alternativlos
Die unverbrüchliche Solidarität, die zum Glaubensbekenntnis nicht nur des Staates, sondern der gesamtem polit-medialen Elite geworden ist, gilt einer Israel-Projektion, die weit mehr mit deutschen Befindlichkeiten, als mit dem real existierenden Staat am östlichen Mittelmeer zu tun hat. Da weigert man sich auch mit Blick auf die hegemonialen Kräfte in Israel zu sehen und zu hören, was nicht sein darf: die de facto koloniale Realität im Westjordanland, klare Ablehnung und systematische Verhinderung eines palästinensischen Staates, offener Rassismus gegen Palästinenser. Den Deutschen geht es um Absolution vor dem Hintergrund der eigenen Vergangenheit, darum (endlich) einmal auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.
Doch die Welt hört längst mit bei den Debatten, die wir in Deutschland eigentlich mit uns selbst führen. Bei einem global rezipierten Ereignis wie der Berlinale offenbarte sich das auf eklatante Weise: Während in Deutschland der Skandal die Reden der Prämierten waren, war es überall sonst die Tatsache, dass selbst ein jüdischer Nachfahre von Holocaust-Überlebenden, der gemeinsam mit seinem palästinensischen Filmkollegen für ein würdevolles, friedliches Leben in direkter Nachbarschaft eintritt, mittlerweile als Antisemit beschimpft werden kann, wenn nur genügend deutsche Trigger-Begriffe (Apartheid, Genozid) fallen und reichweitenstarke Medienhäuser wie auch medienaffine Ex-Politiker ihre Kampagnen lostreten.
Doch wer Jüdinnen und Juden, die einen rechtsextrem regierten Staat, seine Besatzung und Kriegsführung kritisieren, als Antisemiten beschimpft und Israelis, wenn sie mehr Frieden und Gerechtigkeit in ihrem Land fordern, als Israelhasser verunglimpft, ist eben auch Teil des Problems – Teil der globalen Rufschädigung, die Mittler im Ausland seit Oktober fortlaufend beobachten. So provinziell und selbstbezogen das deutsche Agieren sich ausnimmt, so ratlos bis verstört lässt es viele zurück, die Deutschland einst bewunderten.
Etwa ist die Art der Kriegsführung, die Israel im globalen Süden so viel Empörung entgegenschlagen lässt, eben keineswegs so alternativlos wie hierzulande häufig dargestellt. Vielmehr ist sie in ihrer extremen Brutalität Ausdruck einer systematischen Entmenschlichung der Palästinenser durch israelische Politiker und Parteien, die nach dem Scheitern des »Managens« der Palästinenserfrage nun ganz offen radikalere Lösungen diskutieren. Wie der laufende Krieg ausgeht, ist weiterhin offen. Dass er mit einer dieser radikaleren Lösungen endet, ist womöglich wahrscheinlicher als die durch die deutsche Außenpolitik wie eine Monstranz vor sich hergetragene »gerechte Zweistaatenlösung«.
Es ist um Deutschlands Stellung in der Welt schlecht bestellt, sollte sich Berlin weiterhin zu eng an ein Land ketten, das ideologisch derart abdriftet
Unbemerkt vom deutschen Mainstream wird so in Gaza jene regelbasierte, dem internationalen Recht verpflichtete Weltordnung begraben, für die gerade Deutschland stand – mehr als fast jedes andere Land weltweit. Und damit auch die Grundlage der deutschen Softpower, die sich neben der Wirtschaftskraft auf jene Kombination aus Humanität und Recht stützte, die das breite deutsche Engagement in Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft erst möglich machte.
Es ist um Deutschlands Stellung in der Welt schlecht bestellt, sollte sich Berlin weiterhin zu eng an ein Land ketten, das ideologisch derart abdriftet. Für die Feinde des Westens ist dies eine Einladung, Deutschland Doppelmoral und Heuchelei vorzuhalten. Für die Freunde kommt es einer weltanschaulichen Selbstaufgabe gleich, die die wertebasierte Außenpolitik beerdigt.
Kann man optimistisch sein, dass Berlin hier noch die Kurve kriegt und die eigene Reputation wiederherstellt? Hoffen darf man sicherlich. Auf eine Ausnüchterung und De-Ideologisierung des Diskurses. Auf mehr Ambiguitätstoleranz und ein Ende des identitären Schwarz-Weiß-Denkens. Auf eine Außenpolitik, die hochtrabende Sonntagsreden und die diplomatische Realität wieder zusammenbringt. Auf eine Staatsräson, die weniger Glaubensbekenntnis, sondern wertegeleitet und damit an Bedingungen geknüpft ist. Die Debatten in Deutschland zeigen allerdings: Realistisch ist das nicht. Eine außenpolitische Kernfrage wird hier innenpolitisch verhandelt, als reine Nabelschau.
Selbst die zunehmende rhetorische Schärfe, die ab Ende Februar Einzug in den deutschen Diskurs erhielt, dürfte kaum ausreichen, die eigene Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, wenn hintenrum die Waffenlieferungen weiterlaufen. Nach Gaza erwartet uns eine andere Welt. Es ist eine Welt, für die ein dann an Einflussmöglichkeiten ärmeres Deutschland einen Preis zahlen wird.
Marcus Schneider leitet das FES-Regionalprojekt für Frieden und Sicherheit im Mittleren Osten mit Sitz in Beirut.
Hanna Voß war Redakteurin für die taz am Wochenende und ist nun als Programm-Managerin im Auslandsbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut tätig.