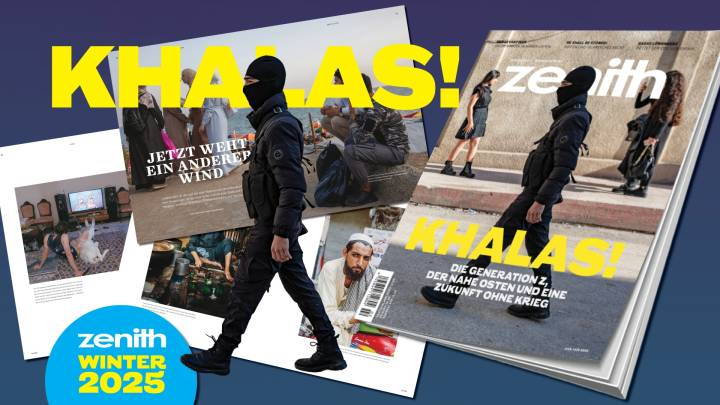Erschießungskommandos, Entführungen, sexualisierte Gewalt: Auch im Herbst reißen in Syrien Angriffe auf Alawiten nicht ab. Die Spuren der Täter führen bis in den Präsidentenpalast.
Homs, 7. Oktober 2025. Layal Gharib verlässt ihre Wohnung im alawitisch geprägten Viertel Zahraa in Homs, um zur Arbeit zu laufen. Zwischen ihrem Zuhause und der Walid-Al-Najjar-Schule im Viertel Jab Al-Jandali liegen nur einige Gehminuten. Als die Lehrerin ihren Arbeitsort erreicht, nimmt der Morgen eine unvorhergesehene Wendung: Zwei vermummte Männer halten auf einem Motorrad in Sichtweite. Sie zielen, schießen und verschwinden. Layal Gharib sackt in der Kaab Al-Ahbar-Straße zusammen. Die Mutter von vier Kindern stirbt noch am Tatort.
Latakia, in derselben Woche. Wenige Meter von der Mittelmeerküste liegt die Jamal-Daoud-Schule. Bewaffnete Männer halten in einem silbernen Geländewagen. Sie reißen den Achtklässler Muhammad Qais Haidar vor den Augen seiner Mitschüler ins Auto. Viele Umstehende werden Zeuge der Entführung. Aber die Angst, dasselbe Schicksal wie die Lehrerin Layal Gharib zu erleiden, hält sie wohl davon ab einzuschreiten. Erst am 1. November wurde der Junge nach Solidaritäts- und Boykottaktionen der Nachbarschaft freigelassen.
In Al-Buwayda, östlich von Homs, begründeten Angreifer ihre Überfälle damit, »Überbleibsel des alten Regimes« ausmerzen zu wollen. Ein Beduine im Dienst der »Allgemeinen Sicherheit« enteignet dort unter diesem Vorwand eine Familie und vertreibt sie gewaltsam aus ihrem Haus. Ein halbes Jahr zuvor entführte derselbe Mann ein Mädchen und zwang sie zur Heirat. Am 17. Oktober erschießt die junge Frau ihren Peiniger – und ist seither auf der Flucht.
Alawiten aus Bustan Al-Basha an der nördliche Mittelmeerküste wurden schon im März zu hunderten in Massengräbern verscharrt. Über ein Dutzend Gruppierungen, teils der HTS unterstellt, andere im Führungskader des Präsidenten, waren Teil dieses Blutrausches. Alawiten trauen sich kaum mehr aus dem Haus oder an abgelegene Orte wie den Strand, obwohl das Meer hier nur wenige Schritte entfernt ist. Im Oktober ordnete die Regierung an, Alawiten aus ihren Wohnungen in Al-Dimas, westlich neben Damaskus, zu vertreiben – auch Kinder und Senioren. Räumungsbescheide im Viertel Al-Sumairiya in Damaskus tragen den Stempel der »Öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft Syriens«.
Fristlose Kündigungen prägten die Neubesetzung des Sicherheitsapparats, doch auch Angestellte etwa im Bereich öffentlicher Infrastruktur waren betroffen
NGOs wie das »Syrian Network for Human Rights (SNHR) dokumentieren minutiös die immer häufigeren Übergriffe auf Minderheiten in Syrien sowie die damit einhergehende Diskriminierung im Alltag. Seit dem Zusammenbruch des Assad-Regimes häufen sich in West- und Zentralsyrien gezielte Tötungen, Entführungen, Vertreibungen und sexualisierte Gewalt gegen Angehörige der alawitischen Gemeinschaft. Allein während drei Tage im März wurden über 55 Massaker verübt, bei denen etwa 1.600 Alawiten starben. Seither verzeichnen Beobachtungsstellen und NGOs täglich neue Fälle.
Die Interimsregierung der Hayat Tahrir Al-Schams (HTS) gilt heute als de facto stärkste politische Koalition Syriens. Sie propagiert Transparenz und Minderheitenschutz, duldet in der Praxis jedoch Repression und religiös motivierte Diskriminierung. So erklärte die Frauenbeauftragte der Regierung, Aischa al-Dibs, Frauen sollten die »Prioritäten ihrer gottgegebenen Natur nicht überschreiten« und sich ihrer »erzieherischen Rolle in der Familie« bewusst sein; Säkularismus sei ein westlicher Import, die Scharia das Ideal.
Der Sturz des Regimes hat eine fragile, über Jahrzehnte erzwungene Balance zerstört, welche teils islamistische Gruppen ersetzen, die sich hinter Scharaa scharen. Während Drusen teils Rückhalt bei Israel suchen und finden, erhalten die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Nord- und Ostsyrien, Gelder aus den USA und unterhalten weiterhin eigene Streitkräfte zum Schutz ihrer Gemeinschaften. Alawiten hingegen können nicht auf solche Rückendeckung aus dem Ausland oder in der Region zählen.
Unter Hafez und Bashar Al-Assad waren Alawiten im öffentlichen Dienst, Militär oder Geheimdienst überrepräsentiert – etwa 80 Prozent arbeiteten für den Staat, obwohl sie nur rund ein Zehntel der Bevölkerung stellten. Diese Dominanz bedeutete jedoch nicht automatisch Wohlstand, sondern Loyalität als Überlebensgarantie. Mit dem Zusammenbruch des Assad-Regimes verloren Zehntausende ihre Arbeitsplätze. Fristlose Kündigungen prägten die Neubesetzung des Sicherheitsapparats, doch auch Angestellte etwa im Bereich öffentlicher Infrastruktur waren betroffen.
Angriffe erfolgen vor Schulen, Universitäten, Werkstätten, Bäckereien, an Kontrollpunkten und in Wohngebieten
Dazu kommen Spannungen zwischen dem ideologischen Fundament und der proklamierten Inklusionspolitik – eine Zerreißprobe für Ahmad Al-Scharaas Koalition. Denn ideologisch stützen islamistische Einzelgruppierungen innerhalb der HTS ihre Feindbilder auf mittelalterliche Rechtsmeinungen, die Alawiten als »ungläubiger« als Juden, Christen oder andere »Kuffar« verunglimpfen, Ehen mit ihnen untersagen und sie für vogelfrei erklären. Theoretisch sollen Kontrollpunkte den Ein- und Ausgang alawitischer Gebiete schützen, in der Praxis folgen diese HTS-Pförtner ihren eigenen Ideologien.
Drei Konstanten sind der Gewalt gemein. Erstens sind die Täter sind oft maskiert, auf Motorrädern unterwegs, tragen Uniformen der »Allgemeinen Sicherheit«, einem der staatlichen Geheimdienste, die die Regierung vom Vorgängerregime übernommen hat. Angriffe erfolgen vor Schulen, Universitäten, Werkstätten, Bäckereien, an Kontrollpunkten und in Wohngebieten. Opfer sind Lehrerkräfte, Studierende, Handwerker, Taxifahrer, Kinder. Dabei gehen Raub, Lösegeldforderungen, Vergewaltigungen und Plünderung einher mit explizit religiös begründeten Tatmotiven beziehungsweise Rechtfertigungen für solche Straftaten. Zweitens konzentrieren sich die Brennpunkte auf Homs, Hama, die Küstengebiete um Latakia und Tartus, sowie den Großraum Damaskus. Drittens untergräbt die Gewalt Vertrauen in die Regierung, schürt Angst vor Behörden und sogar den eigenen Nachbarn und zwingt eine Minderheit in die Flucht oder zum Schweigen.
Dennoch bricht sich der Widerstand gegen die Repressionen in der Öffentlichkeit bahn. In Latakia und Tartus gingen Alawiten auf die Straße, in Suwaida setzten die Drusen im Sommer 2025 nach Wochen schwerer Gewalt ein Zeichen mit Protestmärschen, im August und September folgte eine Welle großer Kundgebungen mit Forderungen nach mehr Selbstverwaltung – die größte Mobilisierung seit dem Regimewechsel. Auch kurdische Gemeinschaften im Nordosten demonstrierten im Oktober 2025 in Qamishli und Hasaka gegen ein Präsidialdekret, das kurdische Feiertage ausspart, und für die sichere Rückkehr Vertriebener aus Serê Kaniyê/Ras Al-Ain.
Das syrische Innenministerium teilte am 2. November 2025 mit, dass von 42 seit Jahresbeginn in den Küstenprovinzen gemeldeten Entführungsfällen lediglich einer als tatsächliche Entführung bestätigt wurde. Alle übrigen Meldungen hätten sich laut der Behörde als freiwillige Auszüge, häusliche Konflikte oder Falschinformationen herausgestellt. Die Fälle aus Homs, Hama, Latakia, Tartus und Damaskus sind nicht bloß Statistik. Es sind Namen, Familien, Berufe, Wege zur Arbeit, zur Schule, zum Markt. Die Gewalt trifft die Infrastruktur des Alltags und zielt auf die Psychologie einer Minderheit, der die Luft zum Atmen genommen wird. Solange maskierte Sicherheitsbeamte vor Schulen und Wohnhäusern marodieren, bleiben Versprechen von Rechtsstaatlichkeit Worthülsen. Schutz beginnt mit überprüfbarer Verantwortlichkeit. Bis dahin bleiben den Betroffenen nur die Solidarität ihrer Nachbarn, der Mut zum Protest und die Hoffnung, dass jemand hinhört.