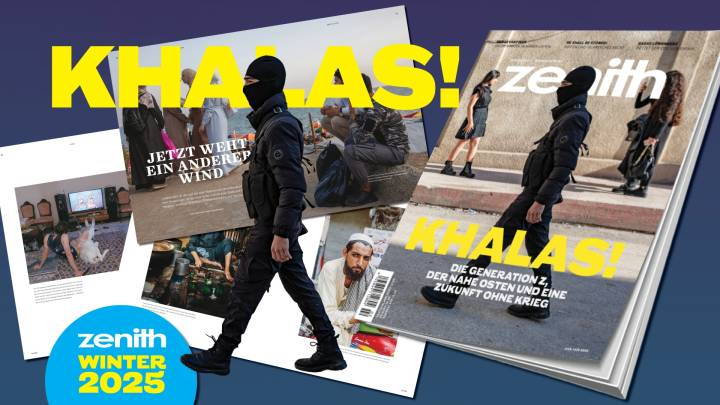Nach dem Sturz des Assad-Regimes kontrollieren kurdisch geführte Milizen weiterhin etwa ein Drittel des Landes. Wie es dort weitergeht, könnte über das wirtschaftliche Überleben des Landes entscheiden.
Die Arbeiter kommen um kurz vor sieben. Zu Fuß, in Kleinbussen oder auf klapprigen Motorrädern passieren sie ein steinernes Tor. Bewaffnete Wächter in Uniform lassen sie durch. Hier, im Handelszentrum von Al-Rai im Norden der syrischen Provinz Aleppo werden sie auch heute wieder produzieren: Schuhe, Textilien, Zement oder Maschinen und Einzelteile für die Land- und Bauwirtschaft. Die Mehrheit der Arbeiter sind Binnenflüchtlinge. Vertriebene Araber, Kurden und Turkmenen. Fast alle sind Männer, manche noch im Kindesalter. »Ist doch besser, als wenn sie Terroristen werden«, sagt ein Unternehmer in einer Nähstube.
Ein paar Hundert Meter weiter laden Arbeiter an diesem Morgen schwarze Rohre auf einen Lastwagen. Neben ihnen steht Hüseyin Eissa, der Vorsitzende der Handelskammer von Al-Rai. Die Ladung gehe nach Osten, erklärt er. Dort, auf der anderen Seite des Flusses Euphrat, haben die sogenannten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) das Sagen, ein Zusammenschluss kurdischer, aber mehrheitlich arabischer Stämme unter kurdischer Führung der Volksschutzeinheiten (YPG).
Für viele Syrer ist die Miliz nicht mehr als ein Ableger der in zahlreichen Ländern als Terrororganisation gelisteten PKK. Auch Handelskammerchef Eissa denkt so. Ein Teil seiner Arbeiter sei vor den SDF geflohen. Angekommen in Al-Rai und anderen Orten im Norden, berichten sie von Zwangsrekrutierungen, Kindesentführungen, Schutzgeldern und einer Wirtschaftslage, die das Überleben im SDF-Gebiet schwer mache. »Wir handeln natürlich trotzdem mit ihnen«, sagt Eissa, der der turkmenischen Minderheit in Syrien angehört. Inzwischen sichern die Arbeiter die Rohre auf dem Lastwagen. Im Gegenzug würden Gas und Öl aus dem SDF-Gebiet geschickt. Darauf sei man angewiesen, betont Eissa.
Denn der mehrheitlich von Arabern bewohnte Osten ist so reich an Bodenschätzen wie kaum eine andere Region des Landes. Dort liegen die größten Vorkommen, darunter die Ölfelder »Omar« und »Tanak« sowie die Gasförderanlage Coneco. Mit diesen Ressourcen könnte ein großer Teil des syrischen Energiebedarfs gedeckt werden.
Zain, ein arabischer Anwohner in Deir Al-Zur, erzählt, wie umkämpft seine Heimat wegen der Vorkommen seit Beginn der Revolution 2011 ist. »Die SDF, zwischendurch der IS und andere bewaffneten Gruppen: Sie alle haben es auf das Erdöl abgesehen.« Für ein paar Jahre hatte auch ein französisches Unternehmen Einfluss in der Gegend. Die Firma Lafarge SA, die heute Holcim heißt, betrieb in Jalabiya ein Zementwerk und soll mit dem IS kollaboriert haben.
Französische Untersuchungsrichter haben im vergangenen Herbst angeordnet, dass sich die Lafarge SA wegen Terrorfinanzierung in Syrien vor Gericht verantworten muss. Inzwischen ist die Zementfabrik unter Kontrolle der kurdisch geführten Milizen. Laut Zain kontrollieren die SDF auch den Agrarsektor. Deir Al-Zur ist nach der Provinz Hasaka der zweitgrößte Produzent von Weizen, Baumwolle und anderen Feldfrüchten.
Die türkische Armee unterstützt seit Jahren den Milizenverband »Syrische Nationalarmee« (SNA) bei dem Versuch, die auch wirtschaftlich wichtigen Gebiete im Nordosten Syriens zu erobern
Nach dem Sturz des Regimes im Dezember blieb etwa ein Drittel des Landes umkämpft. Die kurdisch geführten Milizen hatten es 2012 von Assad zugesprochen bekommen. In der Folge unterstützten sie nicht nur Damaskus, sondern kooperierten auch mit den Russen und iranischen Kampfverbänden – ab 2014 aber auch mit den USA. Amerikanische Soldaten sind seitdem in der Nähe der wichtigsten Ölfelder stationiert. Offiziell dient die Allianz vor allem dem Kampf gegen den IS. Dessen Existenz legitimiert bis heute Washingtons Zusammenarbeit mit den SDF.
Mitte März einigten sich die SDF nach mehreren Verhandlungsrunden – und dem Vernehmen nach auf Druck der USA – mit den neuen Machthabern in Damaskus. Das auffallend allgemein formulierte Abkommen sieht unter anderem vor, dass alle zivilen und militärischen Einrichtungen im Nordosten in die syrische Staatsverwaltung integriert werden, einschließlich der Grenzübergänge, des Flughafens sowie der Öl- und Gasfelder. Seitdem laufen beispielsweise Wartungsarbeiten zur Wiederherstellung der Wasserversorgung von Manbidsch im Umland von Aleppo. Als Ende März in Damaskus offiziell eine Übergangsregierung eingesetzt wurde, erklärte die Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens (DAANES), sie werde sich nicht um die Umsetzung der Beschlüsse des neuen Kabinetts kümmern. Beobachter werten dies als offizielle Ankündigung, dass das Abkommen von Mitte März droht, wertlos zu werden.
Unabhängig davon werden Öl und Gas erst seit Mitte Februar und nur in geringem Umfang in das übrige Syrien transportiert. Inzwischen steigen dort die Preise für Benzin und Diesel. Selbst in der Hauptstadt Damaskus gibt es nur wenige Stunden am Tag Strom. Der Direktor des SDF-Medienzentrums, Farhad Shami, äußerte sich nach Abschluss des Abkommens kritisch: »Es gibt keine Veränderung in der Ölfrage.« Das Abkommen solle lediglich die Türkei davon abhalten, Gebiete unter SDF-Kontrolle zu bombardieren.
Die türkische Armee unterstützt seit Jahren den Milizenverband »Syrische Nationalarmee« (SNA) bei dem Versuch, die auch wirtschaftlich wichtigen Gebiete im Nordosten Syriens zu erobern. Anfang Februar hatte der in der Türkei in Einzelhaft sitzende PKK-Gründer Abdullah Öcalan seine Organisation zur Auflösung aufgerufen. Aber erst wenn das geschehen sei und die ausländischen PKK-Kämpfer Syrien verlassen hätten, wolle die Türkei ihre Operationen beenden. Doch auch nach dieser historischen Ankündigung wird weiter um die Kontrolle über kritische Infrastruktur wie den Tischrin-Staudamm südlich von Manbidsch gekämpft.
Die Kontrolle über den Staudamm entscheidet darüber, wer in Nordsyrien Strom hat und wer nicht
Die Kontrolle über den Staudamm entscheidet darüber, wer in Nordsyrien Strom hat und wer nicht. »Der Staudamm könnte 20 Prozent des syrischen Stroms liefern«, sagt der Unternehmer Eissa. Er ärgert sich, dass Syrer wie er keine eigenen Ressourcen nutzen können und stattdessen auf Energieimporte aus der Türkei und Katar angewiesen sind. Mit dem Golfstaat gibt es seit Februar ein neues Abkommen: Täglich werden zwei Millionen Kubikmeter Gas geliefert. Die Lieferungen sollen helfen, die Stromversorgung in vielen Landesteilen auf drei bis vier Stunden pro Tag zu erhöhen.
Wasser, Gas, Öl: Syrien braucht Ressourcen für den Wiederaufbau. Die Kontrolle des Nordostens ist auch für den internationalen Handel und Drogenschmuggel wichtig: Eine der schnellsten Routen von Asien nach Europa führt durch Syrien. Im Westen von Syrien liegen außerdem strategisch wichtige Häfen. Sie standen früher unter russischer Kontrolle. Inzwischen sollen dort französische Soldaten stationiert sein.
Das internationale Tauziehen und innenpolitische Machtkämpfe erschweren den Versuch der Übergangsregierung in Damaskus, ein unabhängiges Syrien aufzubauen. Übergangspräsident Ahmad Al-Scharaa will erklärtermaßen weg vom Sozialismus des Assad-Regimes und strebt ein liberales Modell an, das auf marktwirtschaftlichem Wettbewerb basiert. Doch die Regierung steht vor einem Scherbenhaufen: Die ehemaligen Regimegebiete sind weit- gehend zerstört, viele Fabriken und die zivile Infrastruktur wurden seit den 1950er-Jahren nicht mehr instandgesetzt.
Der wichtigste Faktor, der über Wohl und Wehe der syrischen Wirtschaft entscheidet, sind jedoch die internationalen Sanktionen. Sie behindern Importe und Exporte und schrecken Investoren ab. Weil Syrien nach wie vor vom internationalen SWIFT-System ausgeschlossen ist, haben heimische Unternehmen Schwierigkeiten, Zahlungen abzuwickeln oder grenzüberschreitende Kredite zu sichern. »Keine Investitionen, keine Arbeitsplätze, keine Rückkehr von Syrern aus dem Ausland«, prognostizierte Samir Soufiyan, Direktor der Denkfabrik »Harmoon Center« bei einer Veranstaltung Mitte März in Istanbul. Am schwersten wiegt der US-amerikanische »Caesar Act«. Ursprünglich war das Gesetz erlassen worden, um das Assad-Regime und dessen Geldgeber zu sanktionieren. Nach dem Umsturz bleiben die Maßnahmen jedoch in Kraft.
Sanktionierte Länder könnten sich auch anderen Partnern zuwenden. Im Falle Syriens dürften dies die Golfstaaten oder China sein
Washington zeigte sich im Frühjahr zurückhaltend, was die Aufhebung der Sanktionen betrifft. Die USA fordern im Gegenzug unter anderem die Vernichtung aller verbliebenen Chemiewaffenbestände und eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus. Außerdem soll die Übergangsregierung einen Verbindungsmann für die Suche nach dem Journalisten Austin Tice und dem syrisch-amerikanischen Bischof Yohanna benennen, die beide seit Jahren vermisst werden. Zwar erhebt US-Präsident Donald Trump – wie schon in seiner ersten Amtszeit – gelegentlich Anspruch auf die von US-Soldaten ge- sicherten Ölvorkommen. Insgesamt schenkt er Syrien aber vergleichsweise wenig Beachtung.
Die Europäische Union wiederum hat die Sanktionsaufhebung an wirtschaftliche Freiheit, Frauenrechte und Minderheitenschutz geknüpft. Die EU-Staaten einigten sich Ende Februar darauf, eine Reihe von Sanktionen gegen Syrien auszusetzen. Es geht vor allem um die Bereiche Energie, Verkehr und Wiederaufbau. Unklar ist bisher, ob etwa der Export syrischer Produkte in die EU erlaubt wird. Währenddessen fordert Frankreich nach den Massakern an Alawiten im März weitere Sanktionen gegen Syrien.
Internationale Sanktionsexperten befürchten ein Dilemma. »Die Zwangsmaßnahmen sind ein gravierendes Hindernis für die wirtschaftliche und humanitäre Verbesserung der Lage«, sagt etwa Christian von Soest, der Leiter des Forschungsschwerpunkts Frieden und Sicherheit am German Institute for Global and Area Studies (GIGA). Die Übergangsregierung stehe unter Druck: Mit den sektoralen Wirtschaftssanktionen könne sie sich nur schwer gegenüber der eigenen Bevölkerung beweisen, was zu mehr innenpolitischen Spannungen führen und folglich die Skepsis der internationalen Gemeinschaft bestätigen könne. Von Soest weist auf eine andere Folge von Sanktionen hin, die er aus seiner Forschung kennt: »Zwangsmaßnahmen befördern oft Schmugglernetzwerke und den Schwarzmarkt.«
Sanktionierte Länder könnten sich auch anderen Partnern zuwenden. Im Falle Syriens dürften dies die Golfstaaten oder China sein, die eine Zusammenarbeit kaum an humanitäre Standards knüpfen. Im schlimmsten Fall droht Europa seinen Einfluss auf Syrien zu verlieren: wirtschaftlich und menschenrechtlich. Sanktionsexperte von Soest kann die Vorsicht des Auslands gegenüber der neuen Übergangsregierung zwar nachvollziehen, plädiert aber für einen Vertrauensvorschuss. »Man hätte die breiten, sektoralen Sanktionen zunächst aussetzen oder sogar aufheben können – mit der Option eines sogenannten Snapbacks.« Das heißt: Bei Problemen oder nicht eingehaltenen Versprechen treten die Sanktionen wieder in Kraft.
Selbst im von der Türkei unterstützten Norden des Landes, der als wirtschaftlich stabilste Region gilt, steigen seit dem Sturz Assads die Preise
Doch das größte Hindernis sehen Experten wie er nicht in der EU, sondern im Verhalten Washingtons. »Die sekundären US-Sanktionen halten Unternehmen und Banken weiterhin davon ab, mit Syrien zu kooperieren«, schreibt der Wirtschaftsberater Karam Shaar in einer Analyse. Die Lockerung der Sanktionen durch die EU sei politisch wichtig, könne aber nur begrenzte positive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, wenn nicht umfassendere Reformen und regulatorische Zusicherungen folgten.
Während Experten und Politiker darüber diskutieren, wie man die neuen Machthaber in Syrien durch wirtschaftlichen Druck beeinflussen kann, treffen die Sanktionen vor allem die lokalen Unternehmer. Sie haben Schwierigkeiten, Materialien zu importieren, Zahlungen abzuwickeln und Kredite zu erhalten. Das dürfte sich auch auf diejenigen auswirken, die nach Syrien zurückkehren wollen. Im ersten Monat nach dem Sturz Assads haben nach UN Angaben rund 200.000 Menschen diesen Schritt gewagt. Sie fanden ein zerstörtes und wirtschaftlich nahezu isoliertes Land vor. Lebensnotwendige Dienstleistungen wie Strom, Wasser und Treibstoff sind kaum verfügbar, es fehlt an Arbeitsplätzen und teilweise an ausreichend Nahrung.
Selbst im von der Türkei unterstützten Norden des Landes, der als wirtschaftlich stabilste Region gilt, steigen seit dem Sturz Assads die Preise. »Wir haben Produkte, die es früher in den Regimegebieten nicht gab – jetzt kommen die Leute her, um sie zu kaufen«, sagt Hussein Eissa. Zudem ziehe die ausgebaute Infrastruktur mehr Fachkräfte an, als benötigt würden. Dadurch steige die Arbeitslosigkeit. All das ließe sich vermeiden, wenn sich die Welt endlich für Syrien öffnen würde, ist sich Eissa sicher. Er sucht fast täglich nach neuen Investoren. Bisher sind die wichtigsten Partner die Türkei, der Irak, Libyen und Marokko.
In der Umgebung des Handelszentrums von Al-Rai sind sieben weitere kleinere Industriegebiete verstreut. Auch in Städten wie Azaz, Al-Bab und Idlib haben Geschäftsleute in den letzten Jahren neue Unternehmen gegründet. »Unser Modell kann als Blaupause für das ganze Land dienen«, ist Eissa überzeugt. Niedrige Lohnkosten, hohe Produktqualität: Syrien sei ein attraktiver Markt. Dem Chef der Handelskammer bleibt nicht viel mehr, als auf die Einsicht in Europa und den USA zu hoffen. Experten schätzen, dass der Prozess Jahre dauern kann. Zeitverschwendung, findet Eissa. »Statt aus China zu importieren, wäre es ökonomischer und ökologischer, bei uns zu investieren.«