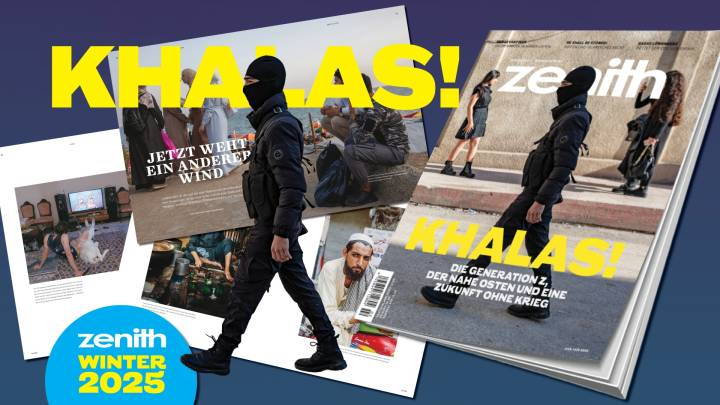Als Folge des Gaza-Kriegs schwebt das Damoklesschwert des Ausschlusses aus Sportverbänden und Wettbewerben über Israel. Dabei bietet sich gerade jetzt die Gelegenheit, die Missstände in israelischen Stadien endlich ernsthaft anzugehen.
Die Zukunft des israelischen Profifußballs steht auf Messers Schneide. Nachdem sich in den vergangenen Jahren rassistische und gewalttätige Vorfälle häuften, hat der am 7. Oktober 2023 ausgebrochene Krieg ein Schlaglicht auf das Geschehen in unseren Stadien geworfen. Wegschauen, Fehlverhalten entschuldigen oder auf Toleranz gegenüber rassistischen Beleidigungen setzen sind keine Optionen mehr, wenn die Augen der Dachverbände des Weltsports auf Israel gerichtet sind. Die FIFA-Regularien und der Strafenkatalog der UEFA zu Rassismus und politischer Hetze sind mehr als abstrakte Prinzipien: Sie bergen die Gefahr realer Sanktionen. Es ist höchste Zeit, darüber nachzudenken, was für den Fußball in Israel auf dem Spiel steht, wenn wir nicht handeln.
Was mit dem Sport in Israel nicht stimmt, dafür bekommen Spieler, Fans und Funktionäre oft erst im Ausland ein Gefühl. Auf der Jahreskonferenz von »Kick It Out« in diesem Sommer berichteten einige der Teilnehmer von ihren Erfahrungen. Etwa Muhammad Abu Fani, der vor zwei Jahren von Maccabi Haifa zu Ferencváros Budapest wechselte. »Mir war zum ersten Mal in meiner Karriere bewusst, dass Buhrufe in Ungarn sich auf mein Spiel bezogen – nicht auf meine Identität als Araber in Israel«, berichtete der 22-fache israelische Nationalspieler.
Seine Worte bringen eine jahrzehntelange Fehlentwicklung auf den Punkt: Der Fußball in Israel, einst stolze Arena gemeinsamer jüdisch-arabischer Errungenschaften, ist zu einem Schlachtfeld geworden, auf dem eine lautstarke Minderheit Spieler rassistisch beschimpft, während die für die Regeldurchsetzung zuständigen Verbände und Funktionäre allzu oft schweigen. Diese Versäumnisse heizen die durch den Krieg ohnehin aufgeladene Stimmung an und öffnen zunehmend Gewalt Tür und Tor. So entsteht in unseren Stadien eine feindselige Atmosphäre, der sich Fans, denen es um den Sport und ihre Mannschaft geht, nicht aussetzen wollen.
In der Saison 2024/25 registrierten unsere Beobachter 367 Fälle rassistischer Beleidigungen, verglichen mit 224 in der Vorsaison – ein Anstieg von 64 Prozent
Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, und wenn die Gesellschaft Rassismus, Misstrauen und Hass ausstrahlt, spiegelt sich das auf dem Rasen. Die Saison 2024/25 hat das schmerzlich deutlich gemacht: Der Gaza-Krieg hat nicht nur den Spielbetrieb unterbrochen, sondern auch die gesellschaftlichen Spannungen im Land verschärft – und die Zuschauerränge reagierten entsprechend.
Das von mir geleitete Programm »Kick It Out Israel« setzt sich dafür ein, dass der Fußball in Israel verbindet, statt zu spalten. Ein zentrales Instrument ist unser Netzwerk von Spielbeobachtern: Viele von ihnen sind treue Fans ihrer Vereine, die den Hass aus ihren eigenen Rängen satthaben. Andere sind einfach Fußballliebhaber, die Rassismus verachten. Unsere Freiwilligen besuchen jedes Spiel der Israelischen Premier League (IPL), um zu dokumentieren, was sie sehen und hören. Ihre Anwesenheit dient nicht der Überwachung, sondern der Dokumentation und der Bestandsaufnahme des Geschehens auf den Rängen.
In der Saison 2024/25 registrierten unsere Beobachter 367 Fälle von rassistischer Beleidigung, deutlich mehr als die 224 Fälle der Vorsaison, gleichsam ein Anstieg von 64 Prozent auf den höchsten Wert des letzten Jahrzehnts. Das wahre Ausmaß des Problems ist wahrscheinlich noch größer, da viele Gesänge auf den Rängen undokumentiert bleiben.
Zwei Liga-Spiele wurden gar aufgrund gewalttätiger Auseinandersetzungen abgebrochen, bei einem dritten wurde ein Kind durch eine von der Tribüne geworfene Nebelgranate verletzt. Diese Zahlen zeigen auch, wie sich der Hass auf friedliche Tribünenbereiche ausbreitet. Die Erklärung ist ebenso beunruhigend wie offensichtlich: die niedrige Strafverfolgungsrate rassistischer Straftaten. Nirgendwo reformieren sich gewalttätige oder extremistische Menschen von selbst. Sie ändern sich nur, wenn die für die Sicherheit zuständigen Behörden sie dazu zwingen.
Nicht alle von uns dokumentierten Fälle sind Folge des 7. Oktober. Nael Odeh pfeift als einer der wenigen arabischen Schiedsrichter in der obersten israelischen Spielklasse. »Vor und nach dem 7. Oktober habe ich von den Tribünen dieselben rassistischen Beschimpfungen zu hören bekommen: ›arabischer Terrorist‹ oder ›dreckiger Araber‹. Im Europapokal greift die UEFA bei solchen Vorfällen streng durch, bei Ligaspielen der IPL macht der israelische Fußballverband das nicht«, beklagte der Unparteiische auf der Konferenz von »Kick It Out«.
Entweder werden Stadien zu einem Laboratorium des Zusammenlebens oder zum Brandbeschleuniger der ohnehin gesellschaftszersetzenden Spaltungen in Israel
Wenn wir den israelischen Fußball nicht reformieren und arabischen Spielern und Fans gleichermaßen einen sicheren Raum bieten, wird sich das rächen. Die Warnungen der UEFA – die eigentlich ein Weckruf hätten sein sollen – haben bisher nicht zu dem dringend notwendigen politischen Kurswechsel geführt, um Rassismus aus Israels Stadien zu verbannen.
Als Vater von drei Töchtern weiß ich, dass der Kampf gegen Rassismus in unseren Stadien nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist – er liegt im nationalen Interesse unseres Landes. Israels Platz in der UEFA zu bewahren, ist sowohl eine zivilgesellschaftliche als auch eine strategische Herausforderung. Der Kampf um eine gemeinsame, sichere Zukunft in Israel hat weit über die Tribünen hinaus Bedeutung: Entweder werden Stadien zu einem Laboratorium des Zusammenlebens oder zum Brandbeschleuniger der ohnehin gesellschaftszersetzenden Spaltungen in Israel.
Für uns sind die Fans der Schlüssel zum Wandel. Fortschritte werden nur erzielt, wenn wir mit ihnen arbeiten, nicht gegen sie. »Kick It Out« veröffentlicht keine kritischen Berichte, nur um Israel schlecht dastehen zu lassen. Wir suchen die Zusammenarbeit mit allen, die bereit sind, den Fußball, den wir lieben, von der Krankheit zu heilen, die ihn befallen hat. Gerade jetzt, im Schatten eines verheerenden Krieges, kann der Fußball eine Vorreiterrolle dabei spielen, die tiefen Wunden zu heilen, die die gesellschaftliche Spaltung gerissen hat.
Arabische Spieler und arabisch-israelische Vereine sind integraler Bestandteil unseres Sports, und es muss klar sein, dass Angriffe auf sie unter keinen Umständen akzeptabel sind. Die Forderungen von den Tribünen zur Freilassung der Geiseln – die bei vielen Spielen in den vergangenen beiden Jahren zu hören waren – verdienen es, als Beispiele für Solidarität hervorgehoben zu werden.
Das ist die Essenz des Fußballs: Fürsorge, Solidarität und Gleichberechtigung. Der ehemalige israelische Nationalspieler Biram Kiyal erinnerte uns auf unserer Konferenz im vergangenen Jahr daran: »Am 8. Oktober, dem Tag nach Kriegsbeginn, waren die einzigen Juden, die arabische Städte und Dörfer betraten, Fußballspieler.« Der Spielbetrieb war zwar erst einmal ausgesetzt. Dennoch erschienen jüdische Spieler demonstrativ, um gemeinsam mit ihren arabischen Kameraden zu trainieren. Der Fußball kann immer noch Wunder wirken.
Matan Segal