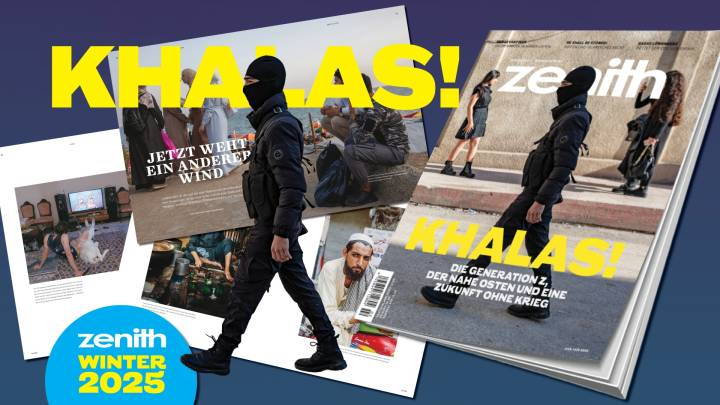Wie die Menschen im neuen Syrien den Übergang verhandeln und Normen ihrer neu gewonnenen Freiheit gestalten.
Unter Assad gehörten Unterdrückung und absolute Kontrolle jedes Wortes und jeder Handlung für Syrer zur bittere Alltagsrealität. Jeder wusste, dass das Überschreiten der unsichtbaren roten Linien des Regimes verheerende Folgen haben würde, deren volles Ausmaß während 14 Jahren brutalen Krieges deutlich wurde.
Für gewöhnliche Syrer, die in einem von Repression und Korruption zerfressenen System existieren mussten, hieß Überleben deshalb, einem ungeschriebenen Verhaltenskodex zu folgen: Die Situation und Umgebung musste schnell eingeschätzt und Worte sorgfältig gewählt werden, je nachdem wer gerade zuhören könnte; persönliche Kontakte wurden geknüpft und Schmiergeld zur richtigen Zeit am richtigen Ort bezahlt, um Alltägliches regeln zu können; und vor allem galt es, im Umgang mit staatlichen Behörden den Kopf einzuziehen und sich so unauffällig wie möglich zu verhalten.
Nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember 2024 wurden die Regeln, die einst das Leben in Syrien bestimmten, weitgehend über Bord geworfen. Fünf Monate später erkunden und testen Syrer immer noch die Grenzen ihrer neu gewonnenen Freiheit in einem unvertrauten und sich im Wandel befindenden Umfeld aus.
Rein rechtlich verspricht die im März unterzeichnete neue Verfassungserklärung Meinungs-, Informations-, Publikations- und Pressefreiheit, volle gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Rechte für Frauen und den Schutz der Rechte aller Syrer, unabhängig von Religion und ethnischer Zugehörigkeit. Gleichzeitig behält sie – wie die vorherige Verfassung – das islamische Recht als Grundlage bei: Syriens Präsident muss Muslim sein und dem islamischen Recht wird als Hauptquelle der Gesetzgebung zentrale Bedeutung beigemessen. Die Glaubensfreiheit soll gleichzeitig gewährleistet bleiben.
Doch in einer Gesellschaft, die über lange Zeit hinweg systematische Rechtlosigkeit erfahren musste, stiften Verfassungsversprechen allein wenig Vertrauen. Insbesondere das Massaker an Hunderten von Alawiten entlang der syrischen Küste, das im März 2025 begann, markierte für viele Syrer einen grausamen Wendepunkt. Ängste vor vermehrter konfessioneller Gewalt und einer neuen Regierung, die nicht in der Lage oder willens ist, dieser ein Ende zu setzen, wurden geschürt und angesichts der jüngsten tödlichen Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und drusischen Fraktionen weiter angefacht.
Auch wenn die meisten Syrer in dieser unbeständigen und schwer einschätzbaren Lage mit Vorsicht agieren, verstehen sie es dennoch, sich bietende Handlungsspielräume zu erkennen und für sich zu nutzen. So tragen sie aktiv dazu bei, die Grundlagen des künftigen Zusammenlebens mitzugestalten, anstatt sich den gerade neu entstehenden Strukturen widerspruchslos zu fügen.
Eine Reihe Beispiele illustriert, wie sich diese Dynamik vor Ort auswirkt: Im März löste eine Anordnung zur Schließung von Bars in einem christlichen Viertel von Damaskus öffentliche Empörung und Kontroversen bezüglich Religionsfreiheit und den Umgang mit Minderheiten aus. Doch nach einem Treffen zwischen Geschäftsinhabern und dem neuen Gouverneur der Stadt konnte die Entscheidung revidiert werden. Seither blieben die Geschäfte geöffnet – auch während des Fastenmonats Ramadan.
Entwicklungen wie diese geben Syrern Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Ein Alkoholhändler aus Aleppo, der wenige Tage nach Assads Sturz vorsorglich sein Ladenschild abmontierte, erklärt: »In ein paar Tagen wird das Schild wieder aufgehängt.«
Ähnlich regte sich in den sozialen Medien starker Widerspruch, als der neue Gouverneur von Aleppo in Zusammenarbeit mit einem syrisch-türkischen Konglomerat eine Kampagne zur »Verschönerung« der Stadt startete, die unter anderem die Entfernung der Märtyrerstatue des Saadallah-al-Jabri-Platz umfasste. In einem direkten Gespräch mit den Behörden argumentierten die Anwohner, dass die Entfernung der Statue einen Teil der historischen Identität des Platzes zerstören würde. Daraufhin wurde entschieden, sie an ihrem Platz zu belassen. »Dass die Behörden den Menschen zuhören, ist für uns ungewohnt«, sagt Natalie Bahhade, die verschiedene Kulturinitiativen in Aleppo leitet. »Wir sollten weiterhin auf der Hut sein, aber wir dürfen auch diese positiven Zeichen nicht übersehen. Ich sehe darin eine Chance, unsere Freiheiten zu erweitern.«
»Es gibt derzeit zahlreiche Beispiele dafür, wie Gemeinden auf lokaler Ebene Wege finden, mit den Behörden zu kommunizieren und sogar gegen bestimmte Missstände vorzugehen«, erklärt Haid Haid, Syrien-Experte des Chatham House Naher Osten- und Nordafrika-Programms. Doch obwohl vor Ort vergleichsweise mehr Freiheit und Handlungsspielraum besteht, gilt dies nicht unbedingt für andere Regierungsebenen. »Die Behörden reagieren oftmals selektiv auf Beschwerden, je nachdem, ob das Problem als strategisch wichtig oder politisch sensibel angesehen wird«, erklärt Haid Haid. »Die meisten Fälle auf lokaler Ebene sind für die Zentralregierung von geringer Bedeutung und werden daher schnell bearbeitet, um negative Reaktionen zu vermeiden und die Bevölkerung zu beschwichtigen.«
Syrern ist nicht entgangen, dass die neuen Machthaber alles daran setzen, ihr internationales Ansehen zu stärken und negative Schlagzeilen so gut es geht zu vermeiden. Während unter Assad ein falsches Wort in den sozialen Medien schwerwiegende Folgen nach sich gezogen hätte, nutzen Syrer diese Plattformen heute aktiv, um Druck auf Regierungsverantwortliche auszuüben.
Dies veranschaulicht der Fall des Kunstinstituts Madad in Damaskus. Wochen nach dem Sturz des Regimes versuchten mit den neuen Machthabern affiliierte Kräfte das Gebäude zu beschlagnahmen. Daraufhin mobilisierten lokale Künstlergemeinschaften Unterstützung in den sozialen Medien und als der Fall auch international Beachtung fand, griffen politische Entscheidungsträger ein, um das Problem zugunsten der Künstler zu lösen.
Solche Fälle geben Anlass zur Hoffnung auf eine konstruktive Beziehung zwischen Zivilgesellschaft und Regierung. Gleichzeitig bleiben insbesondere säkular eingestellte Syrer oder Angehörige von Minderheiten dem islamistischen Einfluss der neuen Regierung und dessen möglichen Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Dynamiken gegenüber misstrauisch. Es besteht die Angst, dass sich islamistische Hardliner in einem von ihren ideologischen Mitstreitern regierten Staat bestärkt fühlen könnten, anderen ihre Weltanschauung aufzuzwingen.
»Die Lage ist sehr instabil. Wir wissen nicht, ob wir unsere Lebensweise bewahren können oder ob wir die Nächsten sind«, bemerkt eine Frau während einer Diskussion in einem Kulturzentrum in Aleppo und spielt damit auf das Massaker an den Alawiten an. Dort werden wöchentlich Vorführungen von Filmen organisiert, die unter dem Assad-Regime verboten waren. Eine andere Teilnehmerin kommentiert: »Egal, was wir von der neuen Regierung halten, unter Assad hätten wir nicht einmal die Freiheit, hier zu sitzen, diese Filme anzusehen und unsere Ansichten zu diskutieren.«
Insbesondere in den Wochen nach dem Sturz des Assad-Regimes kam es zu offensichtlichen Provokationen: Lastwägen, die durch christliche Viertel fuhren, über Lautsprecher islamische Lieder spielten und zur Konversion aufriefen; der Start einer Kampagne zur Verteilung schariakonformer Kleidung an Frauen; oder die Plünderung von Spirituosenläden. Da viele dieser Vorfälle in der Hauptstadt Damaskus stattfanden und somit stark im medialen Fokus standen, wurden sie schnell aufgearbeitet. Seitdem blieben solche Ereignisse weitgehend Einzelfälle.
Jedoch weichen die sozialen Normen und Grenzen des Erlaubten in der Peripherie des Landes mitunter deutlich ab. Eine persönliche Begegnung in Idlib verdeutlicht, wie verschwommen und kontextabhängig diese Grenzen sein können: Als wir – das heißt ein syrischer Mann und eine unverschleierte ausländische Frau – die Straße überqueren, werden wir von einem Passanten angesprochen. Dem Blick seinem syrischen Landsmann zugewandt fragt er, ob seine weibliche Begleitung Araberin sei und impliziert, dass sie in diesem Fall verpflichtet wäre, einen Hidschab zu tragen. Trotz Zusicherung, dass sie Deutsche sei, mischt sich ein weiterer Passant ein: »Egal, ob sie Araberin ist oder nicht, alle Frauen hier müssen einen Hidschab tragen.«
In Idlib mögen solche Begegnungen keine große Überraschung sein. Seit 2018 war der größte Teil der Provinz als letzte große Anti-Assad-Hochburg vom Rest Syriens abgeschnitten. Während die islamistische Hayat Tahrir al-Sham die Region mit eiserner Hand regierte, war die Bevölkerung gleichzeitig dem anhaltenden Bombardement Assads und dessen Verbündeten Russland ausgesetzt.
Obwohl die territorialen Grenzen der ehemaligen Rebellenenklave nun nicht mehr existieren, sind die soziokulturellen Unterschiede noch immer deutlich. Doch anstatt Idlib als finstere Vorahnung dessen zu begreifen, was sich anderswo in Syrien zukünftig abspielen könnte, zeugen die heutigen Interaktionen zwischen Syrern von einer weitaus komplexeren und vielschichtigeren Wechselwirkung.
»Idlib ist nur eine halbe Autostunde von Aleppo entfernt, aber es fühlte sich jahrelang wie ein völlig anderes Land an«, sagt ein Ladenbesitzer aus Aleppo, während er eine Gruppe bärtiger Männer, die er als Idliber identifiziert, in einem touristischen Café in der Nähe der Zitadelle von Aleppo beobachtet. »Ja, wir sind alle Syrer, aber die haben in den letzten Jahren in einer völlig anderen Realität gelebt.«
»Einige Familien aus Idlib befürchten, dass ihre Kinder nun schädlichen Einflüssen und Praktiken wie Alkoholkonsum ausgesetzt werden. Manche jungen Männer haben noch nie eine unverschleierte Frau gesehen«, erklärt ein syrischer Bekannter, der ursprünglich aus Idlib stammt und seit Jahren im Ausland lebte. »Es ist ähnlich wie damals, als Syrer in westliche Länder flohen und erlebten, wie der Lebensstil dort ihre Kinder beeinflusste.«
Ein anderer Freund aus Aleppo erzählt von einer kürzlichen Begegnung, die ihn verblüffte: »Einer von „den Neuen“ [umgangssprachliche Bezeichnung für junge Kämpfer und Männer aus Idlib] kam ohne ersichtlichen Grund auf mich zu und fragte mich, woher ich käme. Ich nannte ihm die Nachbarschaft in Aleppo, in der ich geboren wurde. Er kannte sie nicht. Ich fragte ihn, woher er käme. Er sagte Idlib. Und das war’s. Früher wäre ich bei so einer Begegnung äußerst misstrauisch gewesen und hätte gedacht, es könnte jemand vom Geheimdienst sein. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Vielleicht war er einfach nur neugierig.« Er ahmt die Bewegungen eines Blinden nach, der vorsichtig ein Objekt abtastet, und fügt hinzu: »Es ist, als müssten wir erst mal wieder lernen, einander einzuordnen.«
Einander nach Jahren der Entfremdung, des Misstrauens und der Feindseligkeiten in einem komplett neuen Kontext wieder zu begegnen, ist sicherlich nicht ohne Herausforderungen in einem Land, in dem das Überleben der Menschen einst davon abhing, so schnell und genau wie möglich einzuschätzen, wen man vor sich hatte. Ein Streit mit der falschen Person konnte im schlimmsten Fall zu lebenslanger Haft in einem von Assads Foltergefängnissen führen. »Die neue Regel lautet: Man legt sich besser nicht mit jemandem mit einem Idlib-Kfz-Kennzeichen an.«, erklärt ein Taxifahrer aus Homs und fügt scherzhaft hinzu: »Idlib ist das neue Qardaha«, und meint damit die Heimatstadt der Assad-Familie. »Wenn ich heute einen Unfall hätte, wüsste ich nicht einmal, wen ich anrufen würde, um aus der Klemme zu kommen.«
Solche Vorfälle verdeutlichen, mit welcher Vorsicht Syrer aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Regionen täglich miteinander umgehen – wohl wissend, dass die Bedingungen für erneuten Konflikt, Missverständnisse und Gewalt weiterhin gegeben sind und jederzeit wieder aufflammen können. Ein klarer rechtlicher Rahmen und dessen konsequente Umsetzung sind entscheidend, um Spannungen zu vermeiden und Syrern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.
»Derzeit findet die Kommunikation zwischen lokalen Gemeinschaften und Behörden größtenteils informell statt, oft über WhatsApp«, erklärt Haid Haid. »Es ist ermutigend, dass die Bereitschaft besteht, den Sorgen der Menschen Gehör zu schenken, aber informelle Kanäle allein reichen nicht aus, um einen funktionierenden Staat aufzubauen«, glaubt der Experte. »Man braucht Zeit, Expertise, Institutionen, Gesetze und Vorschriften – vor allem aber Ressourcen. Derzeit fehlt es der Regierung schlicht an Kapazitäten, formelle Verwaltungskanäle zu etablieren, Gesetze durchzusetzen und Fälle systematisch zu bearbeiten.«
Obwohl die informelle Kommunikationsform Ähnlichkeiten mit Wasta aufweist – eine Form der Bevorzugung durch persönliche Beziehungen, die tief in Assads autoritärem System verwurzelt war – betont Haid, dass die aktuellen Praktiken von kommunalen und nicht von persönlichen Interessen Einzelner bestimmt werden.
Obwohl dies sicherlich eine Verbesserung darstellt, entsteht durch das Fehlen klarer staatlicher Strukturen auf lokaler Ebene ein Umfeld, das sich unberechenbar, willkürlich und von persönlichem Ermessen bestimmt anfühlt – insbesondere im Umgang mit Sicherheitskräften, Armee oder Polizei, deren rote Linien noch nicht bekannt sind. Ein Taxifahrer beklagt, wie ein Kollege an einem Kontrollpunkt zwischen Aleppo und Homs angehalten und über Nacht inhaftiert wurde, weil er einer Kundin erlaubt hatte, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Die Liste ähnlicher Vorfälle, bei denen Individuen in Machtpositionen ihre persönlichen Überzeugungen ohne rechtliche Grundlage durchsetzen, ist lang.
»Der Staat ist dafür verantwortlich, gegen dieses Verhalten vorzugehen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Menschen sicher fühlen können, ihre Rechte einzufordern. Die informellen Strukturen machen Fehltritte jedoch wahrscheinlich«, ergänzt Haid Haid. »Derzeit gibt es noch Spielraum für Widerstand, nichts ist in Stein gemeißelt. Sobald sich das ändert, haben wir ein großes Problem.«
»Wir alle testen nach dem Prinzip Versuch und Irrtum tagtäglich die Grenzen des Möglichen aus«, beschreibt ein Syrer aus Suweida den aktuellen Modus Vivendi. »Und ich denke, den Behörden geht es genauso. Auch sie wissen nicht, was sie sich erlauben können.« Nach einer kurzen Pause fügt er lachend hinzu: »Es wird immer klarer, dass noch nichts wirklich klar ist.«
Während Syrien an einem kritischen Scheideweg steht, wobei die Zukunft des Landes nicht nur von den Machthabern in Damaskus, sondern auch von den Menschen vor Ort gestaltet wird, bleiben die Grenzen zwischen Autorität, Recht und religiösen und gesellschaftlichen Normen verschwommen. Wenngleich nach dem Sturz des autoritären Regimes, das das Leben über ein halbes Jahrhundert hinweg kontrollierte, unter Syrern nun eine vorsichtige Zuversicht herrscht, birgt das derzeitige Fehlen staatlicher Strukturen die Gefahr von Fehlentwicklungen und Instabilität.
Insbesondere den Mangel an Ressourcen für den Aufbau eines effektiven Regierungssystems können die Syrer nicht allein beheben. Es bedarf nicht zuletzt eines anhaltenden internationalen Engagements – einschließlich der Aufhebung von Sanktionen und der Bereitstellung ausländischer Hilfe –, um gemäßigte Kräfte sowohl in der syrischen Regierung als auch in der Gesellschaft zu stärken. Lässt man Syrien hingegen in dieser entscheidenden Übergangsphase in der Schwebe hängen, besteht die Gefahr, dass wachsende Instabilität und ein Gefühl der Unsicherheit Hardliner stärken und eine Rückkehr zu autoritären Praktiken nach sich ziehen. Dann würde sich das Fenster der neu gewonnenen Freiheit, die Syrer gerade erst zu entdecken beginnen, schnell wieder schließen.