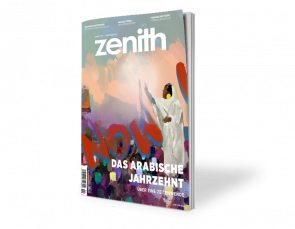Ägyptische Leichenhallen sind gefährliche Orte. Wer hier arbeitet riskiert seine Existenz. Über Menschen, die es trotzdem tun.
Ein Kühlschrank steht neben dem anderen. In der Luft liegt ein Geruch, der einen Würgereiz auslöst. Die Wände sind mit Koranversen dekoriert. Man könnte eine Stecknadel fallen hören, so leise ist es. Nur ab und zu wird die Stille durch das schrille Kreischen von Knochensägen unterbrochen. In dieser Leichenhalle leben und arbeiten diejenigen, die als »Freunde der Toten« bezeichnet werden – Gerichtsmediziner, Obduktionstechniker und Leichenwäscher.
»Eine der schwierigsten Momente meines Lebens war, als meine Tochter meinen Namen in der Zeitung las und herausfand, was ich in der Leichenhalle tatsächlich tue«, erinnert sich Youssef Mohammed, der eigentlich anders heißt. »Sie war schockiert und fragte mich: Warum tust du das? Wer macht so einen Job?« Die Worte der 13-Jährigen trafen ihren Vater wie ein Schlag ins Gesicht. Mohammad arbeitet als Obduktionstechniker in der Zeinhom-Leichenhalle im Süden Kairos.
»Wenn du erwachsen bist und Ärztin wirst, dann versteht du, dass diese Arbeit einen Sinn hat. Wir sind nicht einfach Schlachter, wie viele denken.« Verzweifelt versuchte Mohammad, seiner Tochter seine Beweggründe zu erklären. »Wir gehen den Dingen auf den Grund und ermöglichen den Menschen Gerechtigkeit. Jenen, die nicht mehr für sich selbst sprechen und die Wahrheit ans Licht bringen können.«
Der Teenagerin fiel es schwer, das zu verdauen. Sie fürchtete sich davor, in die Schule zu gehen und gefragt zu werden, womit ihr Vater sein Geld verdient. Der Mittdreißiger Mohammad zog ernsthaft in Erwägung zu kündigen. »Ich dachte daran, wieder an die Universität zu gehen, um einen anderen Abschluss zu erwerben. Ich wollte nicht, dass meine Familie wegen mir belästigt wird.«
Auch außerhalb der Familie hat Mohammad Probleme mit seinem Job: »Ich will nicht ständig meine Arbeit verheimlichen müssen. Die Menschen halten uns für Leichenfledderer.« Bei Behördengängen versucht er stets, seinen Ausweis nicht zu zeigen, denn darauf ist sein Beruf vermerkt. »Immer wenn ich meine ID zeigen musste, schauten die Beamten mich an, als sei ich Azazel, der Engel des Todes.«
Das Stigma begleitet ihn überall hin. »Niemand wusste von meinem Job. Nur meine Mutter, meine Geschwister und sehr enge Freunde waren eingeweiht. Sogar vor meiner Frau musste ich es verheimlichen,« erzählt Mohammed. »Als sie dann doch dahinterkam, brauchte sie eine ganze Weile, um sich damit abzufinden.«
Den Großteil seines Tages verbringt Mohammed zwischen Leichenkühlschränken. »Anfangs war es schwierig, zu akzeptieren, dass ich quasi mit Toten lebe, esse und schlafe. Immer habe ich den schier unerträglichen Gestank des Todes in der Nase. Inzwischen liebe ich meine Arbeit.« Für die Reaktionen aus seinem Umfeld hat er kein Verständnis. »Einige meiden mich, seit sie es herausgefunden haben – als wäre ich ein Außerirdischer oder ein Aussätziger. Ich mache doch nichts falsch. Ich bin kein Dieb oder Mörder.«
85 Prozent der forensischen Arbeit bestehen daraus, Menschen dazu zu bringen, gerichtliche Dokumente im Kontext von sexueller Belästigung und sexuellen Straftaten zu unterschreiben.
Mohammed versucht, mit dem Stigma zu leben. Er sucht Zuflucht in der Einsamkeit – Tote sind ihm lieber als Lebende. Aber wegen der Wirtschaftskrise im Land muss sich Mohammad nach einem zweiten Job umschauen – bislang ohne Erfolg: Niemand will einen Obduktionstechniker anstellen.
»Nachts kann ich nicht schlafen. Ich denke daran, wie eines Tages ein Mann kommen wird, der um die Hand meiner Tochter anhält. Seine Familie wird dann wissen wollen, womit der künftige Schwiegervater sein Geld verdient. Wird er meine Tochter deswegen verlassen? Werde ich der Grund für ihr gebrochenes Herz sein?«
Dina Shukri ist Professorin für forensische Medizin und Vorsitzende der Arabischen Union für Forensik und Toxikologie. Sie kritisiert die gesellschaftliche Wahrnehmung der Gerichtsmedizin: »Wir obduzieren nicht den ganzen Tag nur Leichen.« 85 Prozent der forensischen Arbeit bestehen daraus, Menschen dazu zu bringen, gerichtliche Dokumente im Kontext von sexueller Belästigung und sexuellen Straftaten zu unterschreiben. Außerdem betont sie, dass es »nicht akzeptabel« sei, Forensikern vorzuwerfen, Leichen zu verstümmeln oder zu verschandeln.
Solche Vorurteile führen zu einem Mangel an ausgebildetem Personal. Bereits jetzt gibt der Arbeitsmarkt kaum genug Gerichtsmediziner für alle Gouvernements des Landes her. Ayman Fouda, ehemaliger Leiter der »Ägyptischen Behörde für Forensische Medizin« (ÄBFM), erklärt im Gespräch mit zenith, dass Berufszulassungen in diesem Bereich vom Gesetzesdekret Nr. 96 aus dem Jahr 1952 geregelt werden – ein veraltetes Gesetz aus der Zeit von König Faruq, das bis heute Gesetzeskraft hat. Viele Fakultäten für forensische Medizin an den Universitäten bieten zwar vollwertige Ausbildungen an, aber die Absolventen arbeiten häufig nur in der Beratung. In Ägypten bekommen sie keine Zulassung, um Autopsien durchzuführen.
»Gerichtsmediziner verlassen Ägypten meist des Geldes wegen. Im Ausland verdienen wir problemlos das Zehnfache und können zusätzlich mit hochmoderner Ausstattung arbeiten«
Stattdessen werben andere arabische Staaten ägyptische Gerichtsmediziner ab. Fouda versuchtewährend seiner Amtszeit, die Forensiker-Emigrationeinzudämmen. Er ließ Entsendungen ins Ausland auf sechs Jahren begrenzen. »Wenn die Gerichtsmediziner ihre Zeit im Ausland verlängern wollten, mussten sie dafür ihre ursprüngliche Stelle in Ägypten aufgeben. Oder eben zurückkommen«, erklärt er.
Amani Abdel Hakim gehört zu denen, die das Land verließen. Von 2017 bis 2019 arbeitete sie als Assistenz-Professorin für Forensik in Saudi-Arabien. Inzwischen lebt sie wieder in Ägypten und unterrichtet an diversen Universitäten. »Gerichtsmediziner verlassen Ägypten meist des Geldes wegen. Im Ausland verdienen wir problemlos das Zehnfache und können zusätzlich mit hochmoderner Ausstattung arbeiten. Auch die Arbeitsbedingungen im Ausland sind einfach besser«. In den USA beispielsweise werden unter den Medizinern die Psychiater, Zahnärzte und Gerichtsmediziner am besten bezahlt.
Auch Hisham Mahmoud Farag, ebenfalls Obduktionstechniker in der Zeinhom-Leichenhalle, lebt mit den Stigmata, die sein Job mit sich bringt. »Die Menschen denken, wir seien herzlose Schlachter. Einigemeiner engsten Freunde machen meine Arbeit lächerlich und bezeichnen mich als Mörder. Aber das ist mir egal: Ich liebe meine Arbeit und bin stolz auf das, was ich tue.«
Vor sechs Jahren betrat er zum ersten Mal die Leichenhalle, erinnert sich Farag. Mit seltsamer Ehrfurcht starrte er auf die Leichenkühlschränke, all das im Raum verspritzte Blut. Aufmerksam beobachtete er die Mitarbeiter – besonders die Arbeit der Forensiker faszinierte ihn bis ins kleinste Detail. Ein solch düsterer und beklemmender Ort hätte die meisten wohl eingeschüchtert, nicht aber Farag. Er empfand eine tiefe Bewunderung und spürte, dass er eines Tages ein Teil dieses Ortes sein wollte.
Als sein Vater vom Wunsch des Sohnes erfuhr, war er sofort dagegen, obwohl er selbst als Radiologie-Techniker bei der ÄBFM arbeitete. Doch Farag beharrte darauf. Zum Entsetzen seines Vaters bewarb er sich bei der nächsten Gelegenheit. Schnell fand er sich in einer neuen Welt wieder, der Welt der Toten. »Ich liebte die Leichenhalle. Die Toten sind ruhig. Ich fürchte sie nicht. Man kann die Menschen dort so sehen, wie sie wirklich sind.«
Anfangs verlor Farag seinen Appetit zwischen all den Leichen – der entsetzliche Gestank des Todes war allgegenwärtig. Doch nach und nach passte er sich seiner düsteren Umwelt an. Aber nicht einmal die alltägliche Arbeit inmitten von Kadavern härtet vollkommen ab, konstatiert er mit bitterem Unterton. »Bis heute kann ich nicht aufhören, an die Leiche des jungen Mädchens zu denken, das bei der Explosion der Al-Warraq-Kirche 2013 starb. Sie trug ein weißes Hochzeitskleidchen und neue Sandalen. Als ich diesen kleinen Körper sah, brach ich in Tränen aus. Womit hatte sie einen solchen Tod verdient? Sie war ein unschuldiger Engel.«
Am 13. März 2016 brach Kamal Mustafa, der eigentlich anders heißt, Richtung Leichenhalle auf, um dort die notwendigen Geräte für die Autopsie des Gerichtsmediziners vorzubereiten. An diesem Tag fühlte er sich nicht gut. Bereits seit einiger Zeit war er ausgesprochen müde gewesen und hatte schlecht Luft bekommen. Seine Kollegen drängten ihn, einen Arzt aufzusuchen. Der schlaksige Mittdreißiger winkte ab, die Symptome würden bestimmt schnell wieder vorbeigehen. Doch das taten sie nicht. Bei der medizinischen Untersuchung wurde Tuberkulose (TB) diagnostiziert.
zenith traf Mustafa in seinem zweistöckigen Haus in der Küstenprovinz Beheira, wo er mit seiner Frau und den vier Kindern lebt. Nur unter der Bedingung der Anonymität willigte er ein, über seine Geschichte zu sprechen. »Ich habe zwei Jahre im Sicherheitssektor in den VAE gearbeitet. Nach meiner Rückkehr nach Ägypten bewarb ich mich bei der Leichenhalle – da sich nicht viele auf einen solchen Job bewerben, hatte ich gute Chancen. Ich bekam den Job als Obduktionstechniker.«
Nur wenige Monate später hatte sich sein Gesundheitszustand bereits drastisch verschlechtert, dann bekam er seine Diagnose. »Zuerst hatte ich Tuberkulose. Dann bekam ich auch noch rheumatoide Arthritis, was meine Schmerzen verstärkte und mich schläfrig machte.« Bevor Mustafa seine Stelle im Oktober 2012 antrat, hatten ihm diverse medizinische Tests attestiert, er sei »fit und gesund«.
»Besonders hart war es, als der Doktor forderte, dass sich auch meine Frau und die Kinder einem Tuberkulose-Test unterziehen. Glücklicherweise waren die Ergebnisse negativ«, erzählt Mustafa. »Diese Zeit war wirklich schrecklich. Täglich musste ich schon zwei Stunden vor dem Frühstück 23 Pillen schlucken – sechs Monate lang. Häufig musste ich unbezahlten Urlaub nehmen. Außerdem wurde ich operiert«, erinnert er sich.
»Unter dieser Krankheit wäre jeder zusammengebrochen. Einige der Ärzte boten mir Atteste an, um meine Arbeitsstunden zu verringern, aber ich konnte es mir nicht leisten, meinen Job zu gefährden«, fügt er hinzu. Seine Frau versuchte, Mustafa zur Kündigung zu bewegen, um sich nicht noch mehr Gefahren auszusetzen. Doch er weigerte sich. »Der Tod verfolgte mich überall hin. Die Welt um mich herum wurde dunkel.«
Was alles noch schlimmer machte: Mustafas Sohn wurde mit einem Loch im Herzen geboren, weshalb er regelmäßig zur Untersuchung ins Krankenhaus musste. Die Behandlungskosten für den Vater und den Sohn wurden zur schweren Bürde für die Familie.
»Sie schickten mir ihre Sicherheitsmäntel, die sie in den VAE immer nur für eine Autopsie verwenden. Wir wechseln unsere hingegen für ziemlich lange Zeiträume gar nicht«
Beide Brüder Mustafas arbeiten ebenfalls in der Gerichtsmedizin, allerdings in den VAE und unter völlig anderen Sicherheits-und Hygienevorkehrungen. »Sie schickten mir ihre Sicherheitsmäntel, die sie in den VAE immer nur für eine Autopsie verwenden. Wir wechseln unsere hingegen für ziemlich lange Zeiträume gar nicht.« Bis heute haben sich Mustafas Zukunftsaussichten nicht gebessert.
Niemals hätte er gedacht, dass sein Beruf einmal zur lebensbedrohlichen Gefahr werden würde. Amgad Al-Haddad, Leiter der Allergie-und Immunologie-Abteilung des Ägyptischen Impfinstituts, erklärt, dass Infektionskrankheiten nicht von Leichen auf lebende Menschenübertragen werden, solange präventive Vorkehrungen getroffen werden. »Tote atmen nicht und stoßen damit keine infektiösen Partikelaus«, erklärt Haddad auch im Blick auf das Covid-19-Virus. »Viren brauchen lebende Zellen, um sich zu vermehren.«
Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Richtlinien für den Umgang mit potenziell infektiösen Leichen während der Pandemie und bestätigt Haddads Aussagen: »Außer in Fällen von hämorrhagischen Fiebern (wie Ebola oder Marburg-Virus) und Cholera sind tote Körper nicht ansteckend. Nur die Lungen von Patienten können infektiös sein, wenn sie unsachgemäß gehandhabt werden.«
Gleichzeitig betont die WHO die Notwendigkeit von Hygieneausrüstung für Personal, das mit Leichen hantiert: »Unser Budget war in den letzten Jahren zu niedrig. Wir schickten 12 Handschuhpaare in forensische Abteilungen mit mehr als 50 Leichen. Obwohl sogar zwei Paar Handschuhe übereinander getragen werden sollten«, berichtet ein ehemaliger ÄBFM-Beamter unter der Bedingung der Anonymität. »Einige Mitarbeiter kauften sich daher auf eigene Kosten mehr Ausrüstung. Aber inzwischen sieht die Situation deutlich besser aus.«
»Jeden Tag zerlegen wir Körper, ohne dabei zu wissen, welche Krankheiten in ihnen schlummern – es ist eine Qual«
Auch Mohammed Ismail heißt eigentlich anders und kämpft mit gesundheitlichen Problemen. Schockiert erfuhr er per Zufall, dass einer der Toten, den er untersucht hatte, AIDS gehabt hatte. Die Nachricht traf wie ein Schlag. »Stell dir vor, du arbeitest an einem Kadaver, zersägst seine Knochen. Währenddessen spritzt das Blut des Toten überall herum, ist überall auf dir. Und dann findest du später heraus, dass diese Person AIDS hatte.« Ismail hat Angst. »Ich will mich testen lassen, aber ich fürchte mich vor dem Ergebnis. Jeden Tag zerlegen wir Körper, ohne dabei zu wissen, welche Krankheiten in ihnen schlummern – es ist eine Qual.«
Ismail wollte der Unsicherheit ein Ende bereiten und entschied, sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Doch er konnte sich die 1.000 Pfund (etwa 54 Euro) nicht leisten. Die ÄBFM, so Ismail, ermöglichte ihm keinerlei medizinische Untersuchungen oder präventive Maßnahmen, seit er in der Leichenhalle arbeitet.
Mohammed Sidqi, Leiter der Abteilung für Brustkrankheiten an der Al-Azhar- Universität, ist hingegen überzeugt, dass AIDS nur durch direkten Blut oder Körperkontakt übertragen wird. Es sei ausgeschlossen, dass AIDS von einer Leiche auf einen Lebenden übergehe.
Auch Dina Sukri hält die Infektionswahrscheinlichkeit durch Leichen für äußerst gering. Allerdings erklärt sie, dass ein Infektionsrisiko bestehe, wenn sich ein Mitarbeiter der Leichenhalle während der Autopsie schneide. »Dann besteht durch die offene Wunde direkter Blutkontakt.« Auch sie betont deshalb die Notwendigkeit präventiver Sicherheitsmaßnahmen während der Obduktion.
Die Zulagen sind in den letzten 25 Jahren um keinen Cent gestiegen.
Der anonyme ÄBFM-Beamte widerspricht den Vorwürfen, die Behörde würde ihrer Verantwortung in diesem Bereich nicht gerecht. Er erklärt, dass der Fonds für Gesundheit und den Öffentlichen Dienst des ägyptischen Justizministerium sogar alle Kosten für die Behandlung kranker Mitarbeiter trage, allerdings mit einer Kostendeckelung.
Ismails Darstellung scheint mit der von Ayman Fouda übereinzustimmen. Fouda betont, dass Autopsien hohe Risiken bergen, nicht nur was die Übertragung von Krankheiten von den Leichen auf die Lebenden angehe, sondern auch wegen freiwerdender giftiger Gase. Fouda fordert nicht nur Hygienemaßnahmen, sondern ein Gesetz zum Schutz von Gerichtsmedizinern und Gehälter, die den Risiken ihrer Arbeit angemessen sind.
Am 16. März 2020 forderte der Ägyptische Ärzteverband von Präsident Sisi eine Erhöhung von Zuschüssen bei der Arbeit mit infektiösen Krankheiten. Die Zulagen sind in den letzten 25 Jahren um keinen Cent gestiegen.
Doch zwischen den Kühlschränken der Zeinhom-Leichenhalle ergeben sich auch Räume für herzerwärmende Geschichten. Wie die von Scheich Said, dem ältesten Leichenwäscher, und Sadia Al-Sayed, seiner Assistentin. »Vor 47 Jahren brach ich die Schule ab, um meiner mittellosen Familie zu helfen, über die Runden zu kommen«, erinnert sich Said. Mit seinem Vater arbeitete er als Kupferstecher – 23 Jahre lang. Bevor er als Wäscher in der Zeinhom-Leichenhalle anfing.
Said ist heute 62 Jahre alt. Vor 15 Jahren lernte er Saida kennen, die ebenfalls im Arbeiterviertel Imbaba im Gouvernement Gizeh lebte. Sie hatte ihn um Unterstützung für ihre Bewerbung in der Leichenhalle gebeten. Ein islamisches Konzept verspricht Gottes Belohnung für diejenigen, die tote Menschen waschen. Auch Saida wollte in den Genuss dieser Belohnung kommen. Said half ihr, den Job zu kriegen, viele Jahre arbeiteten die beiden Seit an Seit. Zwischen all den Leichen blühte ihre Liebe auf – bis Said eines Tages um Sadias Hand anhielt. Sie sagte Ja.
Heute leben sie in einem bescheidenen Apartment in Imbaba. Scheich Said, oder der »Freund der Leichen«, wie ihn seine Freunde nennen, ist inzwischen Chefwäscher in der Leichenhalle. Die beiden haben zwei Töchter, zwei Söhne und 13 Enkelkinder, die alle in der Nähe wohnen. Zusätzlich hat Said noch drei weitere Frauen, die alle ebenfalls in der Leichenhalle arbeiten.
Die Hälfte seines Lebens hat Said mit dem Waschen von Leichen verbracht, fernab vom Trubel des Alltags. Er ist stolz auf seine Arbeit und erzählt allen davon. »Ich bin überzeugt, dass Gott mich belohnen wird.« Jeden Morgen setzt der weißbärtige Mann seine Kopfbedeckung auf und macht sich auf den Weg zu seinen Leichen. Den Großteil des Tages verbringt er im Waschraum, der direkt an die Leichenhalle anschließt. Erst spät abends kommt er nach Hause, dann verbringt er die Zeit mit seinen Liebsten.
Niemals, so sagt Said, werde er den Tag 2012 vergessen, an dem 74 Menschen im Stadion von Port Said getötet wurden. »Ich wusch die Körper der jungen Männer des Ultras Ahlawy Clubs. Im einen Moment trugen sie ihre roten T-Shirts, im nächsten waren sie in weiße Leichentücher gehüllt. Ich weinte und weinte.«
Saida arbeitete insgesamt 15 Jahre lang in der Leichenhalle und ging dort ihrem Ehemann zur Hand. Bis sie eines Tages in einen Nachbarschaftsstreit geriet und eine schwere Augenverletzung erlitt. Seitdem konnte sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen.
Auch Saida ist überzeugt, für ihre Arbeit von Gott belohnt zu werden, und schämt sich kein bisschen dafür. Im Gegenteil: »Ich liebe die Leichenhalle und bin stolz auf meine Arbeit dort. Wenn ich noch einmal entscheiden müsste, würde ich es sofort wieder tun.«
Sehr lebendig erinnert sie sich an ihre schwersten Momente in der Leichenhalle: Eines Tages kam der Körper einer jungen Frau, die an ihrem Hochzeitstag verbrannt war. »Ich konnte noch die Henna-Tattoos auf ihrer Hand sehen. Es brach mir das Herz.« Ein anderes Mal wusch sie die Körper einer Mutter und ihres Babys, die in einem Brand miteinander verschmolzen waren. »Ich weinte und schluchzte. So etwas belastet auch die eigene Psyche.«
Die »Freunde des Todes« haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Gesellschaft ihre Arbeit eines Tages anerkennt und respektiert. Mohammad und Farag kämpfen noch immer mit den sozialen Stigmata. Mustafa muss wegen seiner Krankheit bis heute das Bett hüten. Ismail hat noch immer keine Klarheit darüber, ob er nun AIDS hat oder nicht. Nur Said und Sadia genießen ein ruhiges Leben mit ihren Enkelkindern. Sie haben ihre Arbeit lieben gelernt.
Ahmed Saied Hassanein ist freier Journalist und lebt in Kairo. Diese Reportage wurde durch den Candid Journalism Grant gefördert.