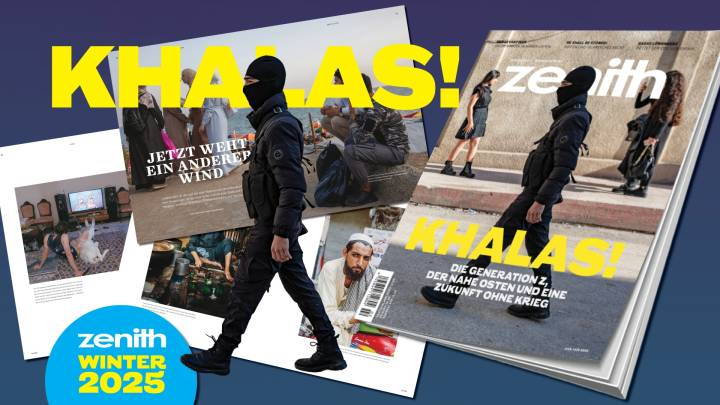Irans ethnische Minderheiten wie Aseris und Belutschen legten im Krieg strategische Zurückhaltung an den Tag und veranschaulichen die Kluft zwischen den theoretischen Sicherheitsängsten des iranischen Regimes und den praktischen Realitäten vor Ort.
Der Krieg zwischen Israel und Iran, der im Juni 2025 begann, markiert einen Wendepunkt in der strategischen Landschaft der Region. Was einst als verdeckter Konflikt begann, eskalierte zu einem offenen Krieg, bei dem Israel beispiellose Angriffe auf iranische Städte und militärische Infrastrukturen startete. Die israelische Führung verlagerte ihren Schwerpunkt von der Bekämpfung iranischer Stellvertreter auf direkte Angriffe auf das zentrale Kommando des Regimes, mit dem Ziel einer operativen Enthauptung anstelle von Eindämmung.
Inmitten dieser hochbrisanten Konfrontation legten Irans ethnische Gruppen – die oft als anfällig für ausländischen Einfluss oder als separatistische Bedrohung dargestellt werden – bemerkenswerte Zurückhaltung und Solidarität an den Tag. Trotz jahrelanger Stigmatisierung als potenzielle Werkzeuge fremder Mächte vermieden diese Gemeinschaften weitgehend jede Handlung, die solche Narrative hätte bestätigen können. Im Gegenteil, viele von ihnen, insbesondere die jüngere Generation, entwickelten starke nationalistische Gefühle und schlossen sich der breiteren iranischen Gesellschaft im Angesicht ausländischer Angriffe an. Diese Reaktion stellt lang gehegte Annahmen über die innere Fragilität Irans in Frage und wirft ein Licht auf die Komplexität ethnischer Identität im nationalen Rahmen.
Mit der Eskalation des Konflikts traten Oppositionsgruppen – insbesondere Monarchisten unter der Führung von Reza Pahlavi – aktiv als alternative Kraft zum Regime auf. Am 17. Juni erklärte Pahlavi, dass Iran »am Rande des Zusammenbruchs« stehe, und präsentierte einen 100-Tage-Plan für eine Übergangsregierung. Wenige Tage später bezeichnete er den Krieg als den »Berliner-Mauer-Moment« Irans und forderte die westlichen Staaten auf, der Islamischen Republik keinen »Rettungsanker« zu bieten. Gleichzeitig rief er Polizei und Militär zur Abkehr vom Regime auf. In einer Rede in Paris bot er an, »den Übergang zu führen«.
Neben den Monarchisten unterstützten radikalere Oppositionsfraktionen offen die israelischen Angriffe und argumentierten, dass ein ausländisches Eingreifen – auch zu einem hohen menschlichen und infrastrukturellen Preis – notwendig sei, um das Regime zu stürzen. Auf persischsprachigen Satellitensendern und in den sozialen Medien bezeichneten einige Stimmen die israelischen Angriffe als »den einzigen Weg zur Freiheit« und verbreiteten Hashtags wie #IsraelOurFriend und #StrikeTheRegimeNotThePeople. Andere zogen Parallelen zu Deutschlands und Japans Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und vertraten die Ansicht, dass sich Iran nach dem Zusammenbruch des Regimes wieder aufbauen könne, selbst wenn der Krieg vorübergehende Zerstörung bringe.
Die starke Fokussierung auf Repression gegen Minderheiten hat in vielen dieser Regionen Misstrauen und tiefsitzende Ressentiments hinterlassen
Demgegenüber lehnten viele Iraner – sowohl im Land als auch im Exil – eine ausländische Intervention strikt ab. Sie warnten vor der Gefahr, dass Iran zu einem zweiten Libyen, Irak oder Syrien werden könnte, und betonten die langfristigen Traumata eines Krieges sowie das Risiko nationaler Fragmentierung oder Fremdbestimmung. Diese kontroverse Debatte über Krieg und Regimewechsel bildet den Ausgangspunkt für eine genauere Betrachtung der ethnischen Gemeinschaften Irans, deren Reaktionen auf den Krieg viele der in diesen Diskussionen verankerten Annahmen infrage stellen.
Wann immer sich Iran in einer Krise befindet – sei es durch Wellen öffentlicher Proteste oder infolge groß angelegter Konflikte wie im jüngsten Krieg mit Israel – gewinnt regelmäßig das Argument an Fahrt, dass die ethnische Vielfalt des Landes zu einem Instrument der Zersplitterung werden könnte. Analysten, Oppositionsfiguren und Regimetreue spekulieren in solchen Momenten häufig, ob Irans ethnische Gruppen die Krise nutzen könnten, um separatistische Ziele zu verfolgen und somit die territoriale Integrität des Staates zu gefährden.
Iran ist ein ethnisch vielfältiges Land, in dem neben den Persern unter anderem Aseris, Kurden, Araber, Belutschen und Turkmenen leben. Viele von erleben politische Marginalisierung, kulturelle Unterdrückung und wirtschaftliche Benachteiligung. Der iranische Staat ist diese ethnischen Fragen historisch mit einer Doppelstrategie aus Sicherheitsmaßnahmen und selektiver Integration angegangen: einerseits durch strikte Kontrolle der Minderheitenregionen, andererseits durch begrenzte Einbindung lokaler Eliten. Die starke Fokussierung auf Repression hat jedoch in vielen dieser Regionen Misstrauen und tiefsitzende Ressentiments hinterlassen.
Der Krieg offenbarte komplexere Schichten von Identität, Loyalität und nationaler Zugehörigkeit
Phasen interner Schwäche oder äußerer Bedrohung – etwa der Iran-Irak-Krieg, die Grüne Bewegung von 2009, die Proteste von 2017 und 2019 sowie die landesweiten Aufstände 2022 – haben in der politischen Elite immer wieder die Sorge geweckt, dass ethnische Gruppen sich mit ausländischen Akteuren verbünden oder separatistische Bewegungen initiieren könnten. Dieses Narrativ hat das Regime aktiv genutzt, um Dissens als Bedrohung für die nationale Einheit darzustellen und harte Repressionen zu rechtfertigen.
Wie ernst und realistisch dieses Szenario in der aktuellen Situation tatsächlich ist, bleibt eine offene Frage. Ob es sich dabei um eine bewusste Strategie Israels handelt, ist ebenfalls unklar. Dennoch kursieren Berichte und Kommentare, die dieses Narrativ aufgreifen. Die Zeitung Israel Hayom veröffentlichte etwa einen Kommentar, der die israelische Regierung dazu auffordert, direkte Verbindungen zu kurdischen Kräften in Iran, insbesondere zur Freiheitspartei Kurdistans (PAK), aufzubauen, die als »natürlicher Verbündeter« mit »israelischen Werten« beschrieben wurde.
Das Portal The New Arab berichtete, dass kurz nach Kriegsbeginn vier große iranisch-kurdische Parteien – die Demokratische Partei Kurdistan-Iran (KDP-I), die Komala-Partei des Iranischen Kurdistan, die PAK, die Partei für ein freies Leben in Kurdistan (PJAK) – die Kurden dazu aufriefen, sich aktiv am Sturz des Regimes zu beteiligen. PJAK forderte gar, »alle Kräfte zu mobilisieren, um eine neue Phase der Frauen-Leben-Freiheit-Revolution einzuleiten.« Der Middle East Forum Observer ging noch weiter und folgerte: »Die Verantwortung, das zu vollenden, was externe Mächte nur beginnen können, liegt nun auf den Schultern der nationalen Minderheiten Irans.«
Auf iranischer Seite nahm man diese Vorschläge ebenfalls zur Kenntnis. Tasnim News zitierte einer Abgeordneten aus Kermanshah, der dass, »während des 12-tägigen israelischen Angriffs Schiiten, Sunniten, Kurden, Belutschen und Türken Seite an Seite standen, um das Land zu verteidigen«, und stellte damit Minderheiten als integralen Bestandteil der Widerstandsfähigkeit der Islamischen Republik dar. Während diese Sichtweise dem üblichen staatlichen Narrativ in Krisenzeiten entspricht, erfasst es nicht die tieferliegenden gesellschaftlichen Dynamiken innerhalb der ethnischen Gemeinschaften Irans. Der Krieg offenbarte komplexere Schichten von Identität, Loyalität und nationaler Zugehörigkeit, die die Reaktionen dieser Gruppen geprägt haben.
Der Scheich Al-Islam von Zahedan richtete sich seine Rhetorik zunehmend auf übergreifende nationale Anliegen aus – Wirtschaftskrise, Außenpolitik, Menschenrechte
Iranische Sunniten bilden eine der sozial kohärentesten Gruppen innerhalb der ethnischen Vielfalt des Landes und machen schätzungsweise etwa 20 Prozent der Bevölkerung aus. Diese Gruppe umfasst Belutschen, Kurden, Turkmenen und Araber. Im Gegensatz zu externen Narrativen, die oft von separatistischen Tendenzen ausgehen, zeigen neuere Entwicklungen eine zunehmende Ausrichtung sunnitischer Führungspersönlichkeiten auf eine nationale Agenda.
Eine zentrale Rolle spielt Maulana Abdolhamid Mollazahi, der Scheich Al-Islam von Zahedan, der als bedeutendste Führungspersönlichkeit iranischer Sunniten gilt, insbesondere in den Ostprovinzen. Obwohl Mollazahi während der landesweiten Proteste im Jahr 2022 kritisch gegenüber der Regierung auftrat, richtete sich seine Rhetorik zunehmend auf übergreifende nationale Anliegen aus – Wirtschaftskrise, Außenpolitik, Menschenrechte – anstatt auf rein konfessionelle oder ethnisch-religiöse Themen.
Diese Rhetorik stärkte das Gefühl der nationalen Verantwortung und der Zugehörigkeit unter den Sunniten maßgeblich. Gleichzeitig ist jedoch die religiöse Identität keineswegs verblasst. Nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 und der anschließenden Eskalation in der Region trat die palästinensische Frage wieder stark in den Vordergrund innerhalb der sunnitischen Gemeinschaft. Die israelischen Angriffe auf Iran verbanden hier die islamistische Solidarität mit nationaler Verteidigung.
Anstatt sich im Krieg vom Regime abzuwenden, rückten viele sunnitische Gemeinden, insbesondere in Grenzregionen, näher an den Staat heran. Der Widerstand gegen Israel wurde als religiös motivierte und zugleich als patriotische Pflicht interpretiert. Dieses duale Zugehörigkeitsmodell, in dem sich Islam und Nationalstolz ergänzen statt zu konkurrieren, erklärt, warum iranische Sunniten sich angesichts externer Bedrohung solidarisch zeigten, obwohl Beobachter im Ausland oft das Gegenteil erwarten. So hat etwa die turkmenische Gemeinschaft in der Provinz Golestan öffentlich den Tod ihrer jungen Soldaten bei israelischen Angriffen betrauert und damit eine patriotische Solidarität zur Schau gestellt.
Ethnisches Bewusstsein und kulturelle Eigenständigkeit existieren neben einem starken Gefühl nationaler Solidarität
Zu den wichtigsten Entwicklungen des jüngsten Krieges zählte der israelische Angriff auf die Stadt Tabriz, die Hauptstadt der Provinz Ost-Aserbaidschan und das kulturelle sowie politische Zentrum der turksprachigen aserbaidschanischen Bevölkerung Irans. Auf strategischer Ebene hob der Angriff die militärische Bedeutung der Region hervor, da Tabriz wichtige Luftverteidigungssysteme, militärische Infrastruktur und logistische Knotenpunkte beherbergt, die den nordwestlichen Korridor Irans absichern. Auf symbolischer Ebene stellte er die iranischen Aseri buchstäblich an die Frontlinie des Krieges.
Diese Botschaft erfüllte zwei Zwecke: Erstens betonte sie, dass iranische Aseri aktiv an der Landesverteidigung gegen einen ausländischen Aggressor beteiligt waren, und zweitens war sie ein öffentliches Bekenntnis zu ihrer nationalen Loyalität und Integration, das sich explizit gegen externe Narrative richtete, die versuchen, iranische Aseri durch das Prisma des pan-turkischen Separatismus zu deuten.
Während Irans Sicherheitsapparat historisch gegenüber pan-turkischen Ideologien misstrauisch ist – insbesondere aufgrund der transnationalen kulturellen Verbindungen zur Türkei und zur Republik Aserbaidschan – demonstrierte die Reaktion der iranischen Aseri während des Krieges eine beträchtliche gesellschaftliche Kohäsion und Stabilität. Trotz der Bemühungen pan-turkistischer Gruppen, insbesondere solcher, die von außerhalb Irans operieren, eine ethno-nationalistische Agenda zu fördern, mobilisierte sich die Mehrheit der aserischen Gemeinschaft innerhalb Irans nicht entlang separatistischer Linien.
In diesem Sinne fügt die Erfahrung der iranischen Aseri während des Krieges der Analyse der ethnischen Politik Irans eine entscheidende Dimension hinzu: Ethnisches Bewusstsein und kulturelle Eigenständigkeit existieren neben einem starken Gefühl nationaler Solidarität – besonders in Momenten, in denen die territoriale Integrität und Souveränität des Landes als von außen bedroht wahrgenommen wird.
Hessam Habibi Doroh ist Politikwissenschaftler und arbeitet unter anderem für die Consulting-Agentur Khayrion. Javad Heiran-Nia ist Direktor der Persian Gulf Studies Group am Center for Scientific Research and Middle East Strategic Studies in Iran.