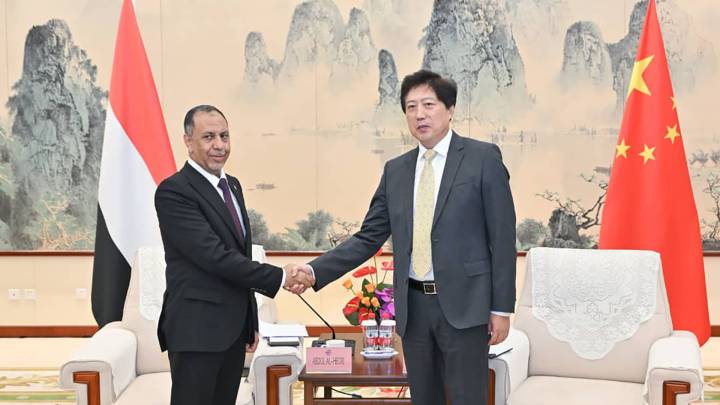Der Zermürbungskrieg im Jemen verschafft weder der saudisch-geführten Koalition noch den Huthis einen militärischen Vorteil. Dafür zwingt er die Menschen in die Knie. Eine Reise durch ein Land, das verhungert.
Ibrahim Al-Abid ist 14 Jahre alt und trägt einen sandfarbenen Kaftan. Er führt uns durch die Altstadt von Sana՚a und bleibt vor den Trümmern eines Gebäudes stehen. »Meine Cousins und Onkel hatten sich eingefunden, um gemeinsam im Innenhof zu Abend zu essen. Sie warteten auf Ahmeds Rückkehr vom Bäcker. Als er zurückkam, wollte der Hund ihn nicht reinlassen. Ahmed nahm einen Stein und versuchte ihn zu verscheuchen. Aber der Hund wollte ihn nur warnen. Wenige Minuten später wurde das Gebäude, in dem sich zehn unserer Verwandten aufhielten, von einer Rakete getroffen. Alle starben.«
Von seinem Zimmer aus habe er nichts gehört, sagt Ibrahim: »Im Krieg lernt man schon als Kind, dass es zu spät ist, wenn man den Einschlag hört.« Er spürte, wie die Mauern erzitterten. Dann eilte er hinaus, um die Toten aus dem Schutt zu bergen und nach Überlebenden zu suchen. Ibrahims Cousin hätte überleben können, hätte der Krankenwagen Sauerstoff gehabt.
Mit einer Hand zeigt er, wie die Wände wackelten. Er schaut in den Himmel und beschreibt das Geräusch der Drohnen. »Wir sind es mittlerweile gewohnt«, sagen seine Cousins, Mohammed und Kamal, jeweils zwölf und elf Jahre alt. Sie gehen nicht zur Schule, sondern wollen Kampfpiloten werden. »Um das Land zu schützen«.
Auch der prophetische Hund überlebte die Bombennacht und bewacht noch immer den Eingang der Ruinen im Erdgeschoss. Vor dem Luftangriff waren hier ein Bad und eine Küche. Es scheint, als würde das Tier die Erinnerung an die Opfer beschützen.
Der Eingang zur Altstadt, zwischen den Checkpoints der Huthis und ihrer allgegenwärtigen Propaganda, versprüht trotz allem noch immer den Charme des altarabischen Handelszentrums. Ein geschäftiges Durcheinander zwischen den Lehmhütten, der Geruch von Weihrauch und Gewürzen liegt in der Luft. Ein Sinnbild der vielen Widersprüche, die diesen Konflikt im Süden der Arabischen Halbinsel prägen.
Die Stände auf den Märkten sind prall gefüllt: Obst, Gemüse – und Qat. Auch in den Ladenzeilen stehen Brot und Mehl in den Regalen. Gleiches gilt für die Auslagen in den Apotheken. Und dennoch sind die Kühlschränke in vielen Haushalten leer und die Notaufnahmen der Krankenhäuser voller unterernährter Kinder. Das sind die Folgen des Wirtschaftskrieges, der seine Opfer indirekt trifft und dessen Täter ungestraft davonkommen.
Der Eingang des Al-Sabeen-Krankenhaus in Sana’a ist schon seit dem frühen Morgen überfüllt. Mütter, Neugeborene und Senioren warten geduldig vor dem Empfangsschalter, von dem aus sie auf die Stationen weitergeleitet werden. Jede medizinische Einrichtung im Land, die den Betrieb noch aufrechterhält, ist mittlerweile mit Fachbereichen für Unterernährung und Cholera ausgestattet.
Dr. Abdullah Aji desinfiziert seine Hände und Schuhe, setzt seinen Mundschutz auf und betritt das Versorgungszelt. »Erst gestern haben wir 70 Kinder mit Verdacht auf Cholera aufgenommen. Alle plagen die gleichen Symptome: Durchfall, Erbrechen, Dehydrierung. Die Kinder wurden in extremer Armut geboren, ihre Mütter sind unterernährt. Wir verlegen sie von einer Abteilung zur nächsten. Wir behandeln die Cholera, dann die Mangelernährung«, berichtet er vom Alltag auf seiner Station. »Dann schicken wir sie nach Hause oder in die Flüchtlingslager, aus denen sie gekommen sind. Und es beginnt von vorne. Es ist ein Teufelskreis. Sie haben nichts zu essen, kein Trinkwasser. Wer Glück hat, schafft es ins Krankenhaus. Die anderen sterben. Und die Mehrheit der Toten schafft es nicht in die Statistik, weil sie in abgelegenen Dörfern sterben.«
»Wir waren bereits arm, jetzt sind wir Bettler«
Dr. Aji klopft an jede Tür der Station. In jedem Raum sind zwei oder drei Kinder untergebracht. Die gleiche Diagnose für jedes Kind. »Asma ist eineinhalb Jahre alt. Sie sollte zehn Kilo wiegen, wiegt allerdings nur vier. Mohamed ist zehn Jahre alt. Er sollte acht Kilo wiegen und bringt gerade einmal zweieinhalb auf die Waage.« Fatima, seine Mutter, ist 29 Jahre alt und hat sieben weitere Kinder. Obwohl sie nicht weint, erkennt man in ihren flüsternden, einsilbigen Antworten die Resignation derjenigen, die jeden Tag ums Überleben kämpfen.
Sie bringt auch nicht die Kraft auf, beim Anblick ihres Sohnes, dessen Rippen sich unter der Haut abzeichnen, in Tränen auszubrechen. Durch den dünnen schwarzen Schleier lassen sich die Schmerzen nur an ihren Augen ablesen. Ihre müde Stimme sagt: »Wir waren bereits arm, jetzt sind wir Bettler. Wir sind zu einem Land der Bettler geworden.« Ihr Mann, so berichtet sie, hätte in Saudi-Arabien als Fahrer gearbeitet. Nach Kriegsbeginn verlor er seinen Job. Ab und an bringe er tausend jemenitische Rial nach Hause, umgerechnet 3,65 Euro – das reicht kaum für eine Tüte Mehl und Zucker. »Doch wir haben seit drei Monaten nichts mehr erhalten«, sagt Fatima. »Uns fehlt es an allem.«
Die Situation wird sich sicherlich noch verschlimmern, in dem Maße, in dem sich Hilfsorganisationen gezwungen sehen, aufgrund nicht eingehaltener Finanzierungszusagen den Betrieb einzustellen. Damit steht etwa die Versorgung mit Nahrungsrationen für zwölf Millionen Menschen auf dem Spiel, ebenso die Grundversorgung für zweieinhalb Millionen unterernährte Kinder. Ende Oktober drohen die medizinischen sowie die Trinkwasserprogramme, darunter spezielle Angebote für etwa eine Million Frauen auszulaufen.
Der Jemen steckt in der weltweit schwersten humanitären Krise. Das UN-Büro der Vereinten Nationen für die Koordination humanitärer Angelegenheiten (OCHA) erklärte, dass die meisten Impfkampagnen seit Mai ausgesetzt wurden, ebenso der Nachschub an Medikamenten. Tausende Angestellte im Gesundheitswesen erhalten keine finanzielle Unterstützung mehr.
Im Februar 2018 wurde den UN und anderen im Land tätigen humanitären Akteuren ein Betrag von 2,6 Milliarden US-Dollar zugesagt. Bislang ist weniger als die Hälfte dieses Betrages eingegangen.
Die Pläne für den Bau von 30 neuen Ernährungszentren wurden auf Eis gelegt, 14 »safe houses« und vier auf Frauen ausgerichtete Einrichtungen für psychische Gesundheit mussten dichtmachen. Eine Kläranlage für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen wurde im Juni stillgelegt. Lise Grande, die Nothilfe-Koordinatorin der Vereinten Nationen für den Jemen, beschrieb die Situation mit den Worten: »Wir alle schämen uns für die Situation. Es ist herzzerreißend, Familien in die Augen zu sehen und ihnen zu sagen, dass wir kein Geld haben, um zu helfen.«
Auf einer Jemen-Konferenz im Februar 2018 wurde den Vereinten Nationen und anderen im Land tätigen humanitären Akteuren ein Betrag von 2,6 Milliarden US-Dollar zugesagt – Nothilfen für etwa 20 Millionen Menschen. Bislang ist weniger als die Hälfte dieses Betrages eingegangen. »Wir bekämpfen Cholera und Diphtherie. Der Krieg hat Krankheiten hervorgebracht, die vor Jahren verschwunden waren. Diphtherie ist hochansteckend, vielen Familien fehlt das Geld für den Treibstoff, der benötigt wird, um ins Krankenhaus zu fahren«, fährt Dr. Abdullah Aji im Al-Sabeen-Krankenhaus von Sana՚a fort. »Unter normalen Umständen würde ein Impfstoff ausreichen, um die Epidemien einzudämmen. Aber die Blockade verhindert, das medizinisches Fachpersonal, Medikamente und Ausstattung ins Land kommen.«
Seit Kriegsbeginn im Jahr 2015 hat die von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Norden des Landes eine See- und Luftblockade verhängt. Nach Angaben des »Yemen Data Project«, das Daten über Luftangriffe sammelt, wurden seit Kriegsbeginn fast 18.000 Zivilisten getötet oder verwundet. Die Koalition flog rund 20.000 Angriffe, von denen ein Drittel zivile Standorte traf: Krankenhäuser, Schulen, Infrastruktur.
Die Straße nach Norden, an die Grenze zu Saudi-Arabien, passiert die Huthi-Hochburg Saada. Sie durchquert abgelegene Täler, kleine Dörfer und Flüchtlingslager zwischen Bergen und Wüsten. Hier stehen Hütten aus Laub und Schlamm, ständig mangelt es an Strom und Wasser. Fast alle Vertriebenen im Lager Khamir, etwa 20 Kilometer nördlich von Sana՚a, kommen aus Saada, das seit 2015 als militärisches Ziel ohne Rücksicht auf zivile Opfer bombardiert wird.
Allerdings, sagt sie, wird sie gegenüber ihren Kindern manchmal gewalttätig, wenn die Erinnerungen an die Flucht, den Luftangriff und den Körper ihres Mannes auf dem Asphaltboden sie einholen.
Die 35-jährige Alima Mussala Abdallah ist Mutter von acht Kindern. Sie versuchte, in einem Bus mit Dutzenden anderen aus dem Umland von Saada zu fliehen, als das Fahrzeug von einer Rakete getroffen wurde. Ein Schrapnell traf eines der Kinder in den Rücken, während ihr Mann einen Herzinfarkt erlitt und starb. Seitdem, so erzählt sie, muss sie sich allein um alle kümmern. Die Familie lebt in einer wenige Quadratmeter großen Höhle. »Manchmal haben wir etwas zu essen und zu trinken, manchmal gibt es nichts. Manchmal erhalten wir Essenslieferungen, jeden Tag kommt weniger an. Deswegen gehe ich betteln, außerhalb des Lagers. Oder ich sammle Plastik und verkaufe es für eine Handvoll Rial, aber es reicht kaum über einen Tag hinaus.«
Alima scheint, wie andere Mütter auch, vom Kampf ums Überleben benommen zu sein. Sie beschwert sich nicht. Allerdings, sagt sie, wird sie gegenüber ihren Kindern manchmal gewalttätig, wenn die Erinnerungen an die Flucht, den Luftangriff und den Körper ihres Mannes auf dem Asphaltboden sie einholen. Für sie gibt es keine Möglichkeit, diese Schmerzen zu verarbeiten.
Ali Nassir lebt mit seinen sieben Kindern und seiner Frau in einem Zelt nur wenige Meter weiter. Er floh aus Saada, wo er als Fahrer gearbeitet hatte. Nach Ausbruch des Krieges konnte er sich das Benzin nicht mehr leisten. »Ich hatte die Wahl zwischen Benzin oder Essen«, sagt er. Doch selbst wenn er das Geld für den Treibstoff aufbrächte, könnten sich die Menschen den Transport nicht mehr leisten.
Als sie aus Saada flohen, war seine Frau im neunten Monat schwanger. Er konnte ihr nicht beim Gehen helfen, weil er seinen behinderten Sohn, damals dreizehn Jahre alt, auf seinen Schultern trug. Heute sind die Knie des Jungen voller Schwielen und Ali kann sich keinen Rollstuhl leisten. Der Junge ist gezwungen, durch Staub und Sand zu kriechen.
In den letzten Jahren wurden Felder und Brunnen immer wieder gezielt von Kampffliegern ins Visier genommen
Seine jüngste Tochter wurde im Lager geboren. Sie leidet an akuter Unterernährung. Um der Familie zu helfen, schickt Ali seine vierzehnjährige Tochter Fatima zum Betteln auf die Straße. Fatima geht nicht zur Schule, wie die anderen Kinder. »Es ist nicht unsere Schuld«, sagt Ali Nasser und zeigt auf die leeren Trinkwassertanks. »Es könnte Nahrung und Wasser für alle hier geben. Und doch lassen sie unsere Kinder verhungern.«
Der jemenitische Krieg wird mit wirtschaftlichen und militärischen Mitteln geführt, die das Land in die Hungersnot geführt haben. Dies zeigt sich am deutlichsten in der Hafenstadt Hodeida, einem Knotenpunkt für die Einfuhr humanitärer Hilfsgüter und damit Schauplatz heftiger Kämpfe.
65 Prozent der Jemeniten leben noch immer in Dörfern, verstreut und weit entfernt von urbanen Zentren, und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf die Landwirtschaft als Einkommensquelle für ihre Familien angewiesen. In den letzten Jahren wurden Felder und Brunnen immer wieder gezielt von Kampfjets ins Visier genommen. Ein beträchtlicher Teil der jemenitischen Wirtschaft fiel so dem Krieg zum Opfer.
Laut einer Studie der London School of Economic (LSE) über die Auswirkungen des Krieges auf die Landwirtschaft in den ersten Jahren des Konflikts wurden landwirtschaftliche Nutzflächen in den Governements Schabwa und Mahwit besonders häufig unter Beschuss genommen. Beide Provinzen liegen an wichtigen Zufahrtswegen nach Sana՚a, entsprechend heftig toben die Kämpfe um die Kontrolle der Transportwege.
Die Strategie der von Saudi-Arabien geführten Koalition zielt darauf ab, die Nahrungsmittelproduktion in von den Huthi kontrollierten Gebieten zu zerstören. Die Kontrolle der Nahrungsmittelimporte und die Schwächung der Landwirtschaft sollen die Bevölkerung aushungern. Eine vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzte Expertengruppe bestätigte Anfang September in einem Bericht diesen Vorwurf und prangert Kriegsverbrechen aller Parteien im Jemen-Konflikt an.
Die UN-Experten schreiben, dass die jemenitische Regierung und die Koalition, die sie unterstützt, auf der einen Seite und die Huthi-Rebellen auf der anderen Seite seit Jahren humanitäre Hilfe blockieren und Hunger als Methode der Kriegführung nutzen. Der Bericht verurteilt zudem die Luftangriffe sowie die Anwendung von Folter und sexueller Gewalt im Jemen-Krieg.
Der Bericht listet auch Straftaten auf, bei denen verbündete Staaten – also die USA, Großbritannien, Iran oder Frankreich – als Komplizen für einige dieser Verbrechen ausgemacht werden können, indem sie »spezifischen Einfluss auf die Konfliktparteien« nehmen, etwa durch nachrichtendienstliche oder logistische Unterstützung und Waffenverkäufe.
Diese Strategie wird seit Jahren verfolgt und hat den Zusammenbruch des Jemenitischen Rial und einen starken Anstieg der Inflation verursacht. Dies führte zu einer raschen Erschöpfung der Devisenreserven und damit zu erheblichen Ausgabenkürzungen bei der Zentralbank des Jemen.
Der Krieg wird in dem vollen Wissen geführt, dass die umgesetzten Strategien eine Hungersnot auslösen würden. Und das in einem Land, das bereits vor dem Krieg das ärmste in der Region war.
Diese Strategie wird seit Jahren verfolgt und hat den Zusammenbruch des Jemenitischen Rial und einen starken Anstieg der Inflation verursacht. Dies führte zu einer raschen Erschöpfung der Devisenreserven und damit zu erheblichen Ausgabenkürzungen bei der Zentralbank des Jemen, wie ein Bericht der World Peace Foundation von Anfang September nachzeichnet.
Nada ist acht Monate alt, wiegt aber nicht einmal eineinhalb Kilogramm. Ihr Vater legte sie auf ein Strohbett. Er sieht sie an, als ob er darauf wartet, dass sie stirbt. Wie so viele Eltern im Jemen, die ihren Kindern beim Verhungern zusehen, weint er nicht. Er schreit nicht. Er weiß, dass es nicht helfen würde. Nada ist das jüngste von neun Kindern.
Ihre Mutter Mariam Hussein Ali Agrabi weiß nicht genau, wie alt sie selbst ist. Ihr Dorf liegt 15 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, Aslam, in der Provinz Hajjah, nordwestlich von Sana՚a. Die Familie hat nur zwei Kanister Wasser und einen Sack Mehl vorrätig. Mariam berichtet, dass sie seit drei Tagen nichts zu essen für Nada hat. Und wenn das Baby vor Hunger schreit, bleibt ihr selbst die Luft weg.
»Ich trage eine Last auf meinem Herzen, ich ersticke. Ich ersticke«, wiederholt sie, als sie flüstert, dass das Wasser schmutzig ist und sich ihre kleine Tochter deswegen immer wieder erbricht. Doch für den Transport zum Krankenhaus ist kein Geld übrig. Die ausgemergelten Körper sind der sichtbare Ausdruck der Gewalt, denen die jüngsten Opfer dieses Kriegs ausgesetzt sind.
Der Krieg im Jemen steuert nicht auf eine Lösung hin. Stattdessen verschieben sich Allianzen, neue Akteure treten auf den Plan, der Konflikt fragmentiert. Und die Regionalmächte verfolgen weiterhin ihre eigenen Interessen, ohne Rücksicht auf die humanitäre Tragödie, die ein fruchtbares Umfeld für Radikalisierung schafft.
In einem Geschäft in der Altstadt von Sana՚a sitzt ein Mann auf einem schmalen Holztisch. Er kaut müde sein Qat. Auf dem Boden stehen Plastikflaschen in verschiedenen Größen, gefüllt mit Sesamöl, das mit einer alten, traditionellen Ölpresse hergestellt wurde. In dieser Ölmühle werden die Sesamsamen aus der Holzpresse gewonnen, die von einem Kamel angetrieben wird, das jeden Tag im Kreis um den Mühlstein läuft. Das Kamel macht einen Schritt nach dem anderen, aus der Presse läuft das Öl.
Es ist ein gedrungener, dunkler Raum, vier mal vier Meter groß. Aber das Kamel kriegt davon nichts mit. Sein Blick ist mit Lederblenden bedeckt. So geht es um den Felsen herum und zieht die Presse stundenlang, jeden Tag. Ohne zu springen, ohne zu stolpern. Jeder Schritt produziert einen Tropfen Öl, bis der Körper des Tieres ermattet.
Draußen schaut sich eine Gruppe von Kindern Fotos von gefallenen Huthi-Soldaten an, Schnappschüsse vom Tod an der Front.
Mohammed, einer der Aufpasser, den das Informationsministerium unter Kontrolle der Huthis den Journalisten bei ihren Besuchen im Land an die Seite stellt, beobachtet die Fußstapfen des Tieres und seinen unermüdlichen Gang im Kreis. »Das Kamel hat ein gutes Gedächtnis und ist nachtragend. Es vergisst nicht und rächt sich für das Unrecht, das es erlitten hat. Wenn seine Augen plötzlich frei wären und es verstehen würde, dass es jahrelang so gelebt hatte, würde es verrückt werden. Und es würde Rache nehmen. Deshalb ist es dazu bestimmt, für immer Scheuklappen zu tragen.«
Draußen schaut sich eine Gruppe von Kindern Fotos von gefallenen Huthi-Soldaten an, Schnappschüsse vom Tod an der Front. »Das ist mein Onkel«, ruft einer von ihnen und zeigt auf das Bild oben links. »Der da kämpfte bei einem Angriff auf Saada«, sagt ein älterer Junge und zeigt mit dem Finger auf ein Bildnis, das sich von den anderen abhebt. »Und der war in meinem Alter, vierzehn Jahre alt«, sagt der Dritte.
Dann wenden sie sich alle ab und laufen die Straße entlang, die zum Hotel Burj Al-Salam führt, einst ein Ziel für Besucher aus aller Welt, und mittlerweile aufgegeben. Sie lachen, sie springen um einen Ball. Plötzlich rufen sie »Allahu akbar, al-mawt li-Amrika, al-mawt li-Israil, al-la nah 'ala' l-yahud, an-Nasr lil-Islam« – ein beliebter Huthi-Slogan, übersetzt bedeutet er soviel wie: »Gott ist groß, Tod für Amerika, Tod für Israel, Fluch den Juden, Sieg dem Islam.«
Sie ähneln dem Kamel, das in einem lichtlosen Raum gezwungen ist, im Kreis zu laufen. Mit ihren Schreien unterstützen sie etwas, dessen Konturen sie nicht kennen; und rufen den Namen eines Feindes, der ausgerottet werden soll.