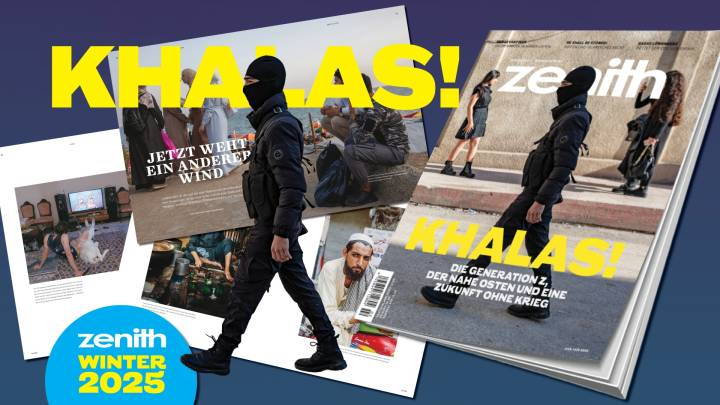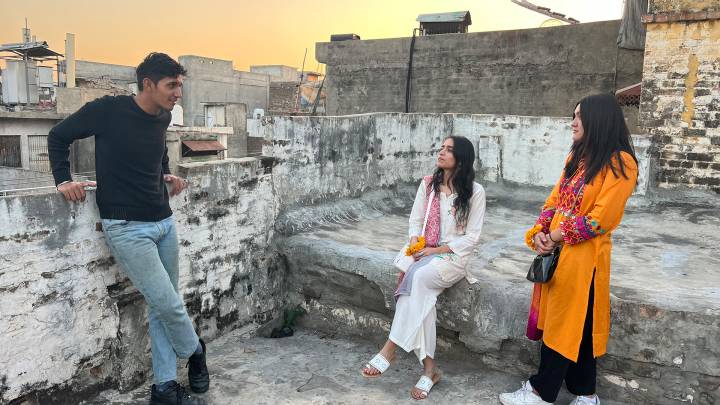Das New Yorker Met-Museum feiert die Rückgabe einer Jahrtausende alten Statuette an den Irak – und bleibt dennoch viele Antworten schuldig.
»Wenn es ein rituelles Objekt ist, dann bewegt es sich zwischen der Welt der Menschen und der Welt des Göttlichen«, beschreibt die Kuratorin Kim Benzel in einem YouTube-Video eine circa 4.500 Jahre alte mesopotamische Kupferfigur eines Steinbocks, dessen Pupillen aus Lapislazuli hervorstechen. Die gut erhaltene Statuette war unter dem Namen »Vessel Stand with Ibex«, auf Deutsch »Gefäßständer mit Steinbock«, im Metropolitan Museum of Arts in New York City, auch »Met« genannt, ausgestellt. Das Artefakt aus dem 3. Jahrtausend vor Christus ist ein Vorzeigebeispiel für das sogenannte Wachsausschmelzverfahren. Es erlaubt große Gegenstände aus Metall zu gießen und dabei einen hohen Detail- und Komplexitätsgrad beizubehalten. Nach Ansicht der Kuratorin könnte es sich beim »Vessel Stand with Ibex« um das früheste Beispiel dieser Technik weltweit handeln.
Das 11-minütige Video selbst, in dem die Kuratorin spricht, wurde anlässlich einer Zeremonie am 30. September 2025 aufgenommen. Darin verkündeten die irakische Botschaft in Washington D.C. und das Met, dass die Statuette in den Irak zurückgeführt wird. Innerhalb seiner 2023 ins Leben gerufenen »Kulturgutinitiative« hat sich das Met der Provenienzforschung verschrieben. Das Haus geht also der Frage nach, woher Objekte der eigenen Sammlung überhaupt stammen und unter welchen Umständen sie erworben wurden. Die Ibex-Statuette wurde 1974 vom Met »akzessioniert«, das heißt gekauft. Im Rahmen der internen Recherchen als Teil der »Kulturgutinitiative« habe sich dann herausgestellt, dass die Ibex-Statuette aus dem heutigen Irak stammt und die Republik Irak der rechtmäßige Besitzer ist. Daraufhin habe das Met den Botschafter und das Irakische Museum in Bagdad kontaktiert und eine Rückführung in die Wege geleitet.
Dass Kulturgut in einem anderen Land zur Schau gestellt oder aufbewahrt wird, als aus dem es ursprünglich stammt, ist eine weitverbreitete Realität
Dass Kulturgut in einem anderen Land zur Schau gestellt oder aufbewahrt wird, als aus dem es ursprünglich stammt, ist eine weitverbreitete Realität. Bekannte Beispiele sind die Friese vom Parthenon in Athen und die Steinskulpturen von der sogenannten Osterinsel, die alle im British Museum in London ausgestellt sind, oder der Pergamon-Altar aus der Türkei und die Büste der Nofrete aus Ägypten, die beide in Berlin zu sehen sind. In Bezug auf Irak und Syrien ist die Liste der Artefakte außerhalb dieser Länder lang: Groβe assyrische Skulpturen, die geflügelte Stiere mit Menschenkopf darstellen, sind in London, Paris, Berlin und New York City ausgestellt, während das Israel Museum in Jerusalem ein Felsrelief mit sumerischer Inschrift und die private Schøyen-Sammlung in Oslo zahlreiche Keilschrifttafeln und Stempelsiegel besitzen.
Befürworter eines Verbleibs antiker Artefakte in Museen und Privatsammlungen im Westen verweisen unter anderem auf frühere Verträge und die zeitgenössische Rechtslage, die den Schutz von Kulturgut, geschweige denn den Begriff »Kulturgut«, nicht kannte. Erwerb und Abtransport in ein anderes Land waren im 19. und 20. Jahrhundert nicht weiter problematisch und der Gedanke an einen kulturellen Verlust für die Bevölkerung im Ursprungsgebiet war kaum von Belang. Das hat sich inzwischen geändert. Jüngstes Beispiel: Das »Deutsche Zentrum Kulturgutverluste« untersuchte von 2023 bis 2025 im Rahmen des Forschungsprojekts »Legal – Illegal? Die Umstände der Grabungen und Ausfuhr archäologischer Objekte aus Sam’al, Didyma und Samarra im Osmanischen Reich nach Berlin während des frühen 20. Jahrhunderts« eine Reihe von Objekten, die bis heute im Besitz von Museen in Berlin sind.
Die »Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten« im Jahr 1954 und das UNESCO-»Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut« aus dem Jahr 1970 hatte zum Ziel, weltweit ein Bewusstsein für die Fragilität von Kulturerbe zu schaffen: Weder dürfen kulturelle Güter wie während des Zweiten Weltkriegs gezielt zerstört werden, noch dürfen sie wie in den Kolonialreichen des 19. und 20. Jahrhunderts gehandelt oder entwendet werden. Das Konzept von Kulturgutschutz war dank solcher Dokumente auch rechtlich greifbar.
Auf die Umstände, wie die Ibex-Statuette vom Irak in die USA gelangen konnte, geht das Met in seinem Video trotz der Provenienzforschung im eigenen Haus nicht ein
Plünderungen und illegalen Handel mit Kulturgütern können die Konventionen dennoch nicht verhindern. Im Zuge der US-Invasion des Iraks etwa nutzten Kriminelle das Chaos aus und raubten das Irakische Museum in Bagdad im April 2003 großflächig aus. Sie stahlen über 10.000 Artefakte. Ebenso sprang in den Wirren des Bürgerkriegs die Zahl der Raubgrabungen in Syrien ab 2011 an. Interpol spricht hierbei auf seiner Webseite von »Kulturerbeverbrechen« und beschreibt diese als »profitables, risikoarmes Geschäft für Kriminelle mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen«.
Auf die Umstände, wie die Ibex-Statuette vom Irak in die USA gelangen konnte, geht das Met in seinem Video trotz der Provenienzforschung im eigenen Haus nicht ein. Wer »Elias David, New York« war, dem das Met laut seiner Webseite das Objekt 1974 abgekauft hat, oder welche Lehren aus diesem Erwerb gezogen wurden, wird ebensowenig thematisiert. Im Vordergrund stehen die gegenwärtig gute Zusammenarbeit mit den irakischen Behörden und das Artefakt als beeindruckendes Kunstobjekt selbst.
Kuratorin Kim Benzel spekuliert nur kurz über die Funktion der Ibex-Statuette, sagt jedoch kein Wort zu dessen Fundkontext. Das lässt Raum für die Vermutung, dass auch dieses Artefakt aus einer Raubgrabung stammen könnte, bei der die Hoffnung auf schnellen Umsatz die Möglichkeit eines besseren Verständnisses der Vergangenheit buchstäblich untergräbt. Umso wichtiger wäre es, wenn die feierliche Rückgabe einher geht mit einer umfassenden Aufarbeitung, die nachzeichnet, wie die Ibex-Statuette überhaupt nach New York gelangte.