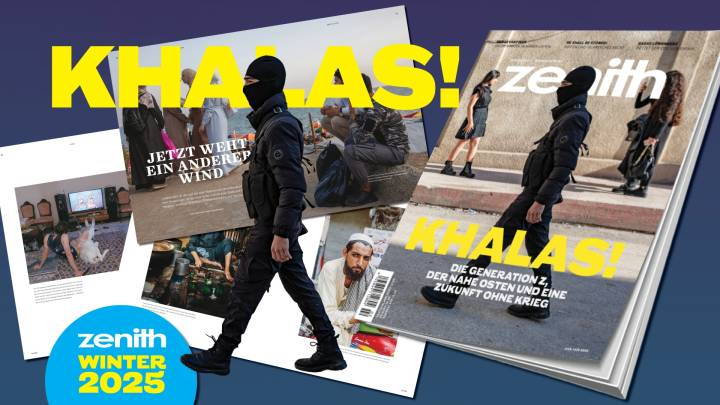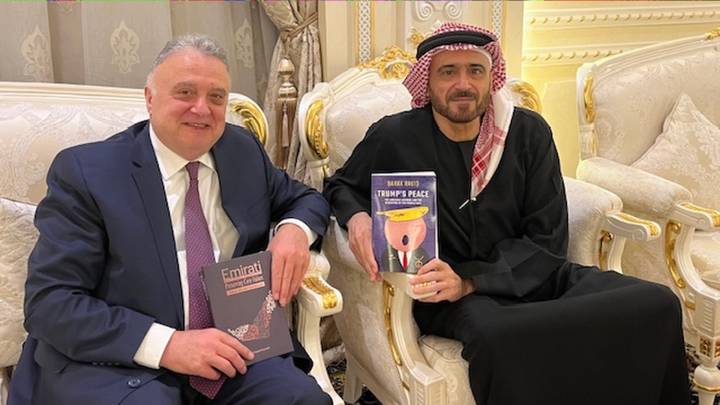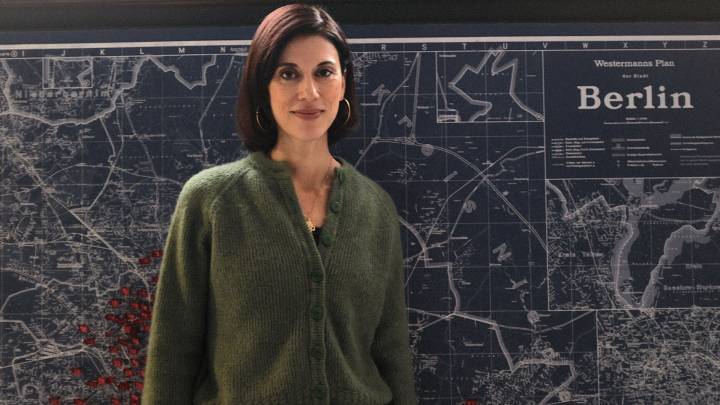Die alte Handelsstadt im Punjab gilt selbst ihren Bewohnern als uncool. Ein junger Stadtforscher legt mit alternativen Stadttouren frei, wie stark die Geister der Teilung des Subkontinents bis heute nachwirken.
Wer etwas auf sich hält in der punjabischen Metropole Rawalpindi, der hat genau einen Traum, so heißt es: Rawalpindi zu verlassen und schnellstmöglich ins benachbarte Islamabad zu ziehen. So ist es seit Jahrzehnten. Und so wird es vielleicht noch lange sein. Knapp 15 Kilometer sind die Stadtzentren der beiden Schwesterstädte voneinander entfernt. Islamabad: die erst in den 1960er-Jahren vom griechischen Stararchitekten Constantinos Doxiadis ersonnene moderne Planstadt. Pakistanische Vorstadtidylle in autofreundliche Raster unterteilt, sauber, grün und steril. Rawalpindi: die alte Handelsstadt dagegen: heruntergekommen, chaotisch, spröde und dazu noch Sitz des Militärs.
Hassaan Tauseef kann mit den Vorurteilen wenig anfangen. Er ist hier aufgewachsen, nicht weit entfernt von der Altstadt. Sein Blick auf seine Heimatstadt hat sich verändert. »Ich habe gelernt, sie mit all ihren Feinheiten und verfallenen Baudenkmälern als das zu sehen und wertzuschätzen, was sie heute ist«, erzählt er im Gespräch mit zenith. »Es gibt hier so viel zu entdecken.«
Als Jugendlicher habe er die Straßen und ihre Geschichten für sich erschlossen, auf langen Touren verwunschene Stadthäuser, Schreine und verlassene Tempel entdeckt. Über diese Fundstücke berichtete er in seinem Blog. Später begann Tauseef, über Instagram Kulturerbe-Touren anzubieten. Ehrliches Storytelling nennt Tauseef das Konzept. Und es kommt an. Hunderte Touren habe er schon durchgeführt, schätzt der 22-jährige Architekturstudent.
Im äußersten Norden des Punjabs gelegen, wo von Pinien bewaldete Hügel, die letzten sanften Ausläufer des Himalaya, auf das fruchtbare Pothohar-Plateau treffen, kreuzten sich schon seit jeher die Handelswege. Das antike Taxila, Hauptstadt des sagenumwobenen antiken Gandhara-Reiches, liegt gleich in der Umgebung.
Bis in die Mogulzeit blieb die Siedlung recht unbedeutend. Unter den Sikh-Herrschern im 18. Jahrhundert erlebte die Grenzgarnison Rawalpindi dann aber einen steilen Aufschwung. Neben den Sikh siedelten sich viele hinduistische und muslimische Händler in der Stadt an, später auch Parsen und iranische Juden. Ein florierender Handelsplatz am Fuße der Bergwelten Kaschmirs und Afghanistans.
Auf die Sikhs folgten die Briten, die die Stadt wegen ihres vergleichsweisen milden Klimas schätzten, und noch mehr ihre Nähe zu den Bergen. 70 Kilometer entfernt erbauten sie auf über 2.000 Metern Höhe die »Hill Station« Murree. Im Frühjahr zog die Kolonialadministration mit Sack und Pack hoch in die Berge, um der Hitze des Pothohar-Plateaus zu entfliehen und kehrte im Herbst ins Tal nach Rawalpindi zurück.
Das klare Quellwasser eignete sich zudem bestens zum Bierbrauen. Die gleichnamige Murree-Brauerei produziert seit 1860 bis heute. Das pakistanische Lager besitzt in Künstlerkreisen von New York bis Melbourne Kultstatus. Die Dyer-Familie trat die Brauerei in den 1940er-Jahren an die parsische Bhandara-Dynastie ab. Der Name Dyer ist bis heute eng mit einer der dunkelsten Stunden des britischen Raj verbunden. Brauersohn und Colonel Reginald Dyer gab am 13. April 1919 den Befehl, das Feuer auf eine Menschenmenge im Jallianwala Bagh, ein Park unweit des goldenen Tempels in der ostpunjabischen Stadt Amritsar, zu eröffnen. Mindestens 300 friedliche Demonstranten starben. Wahrscheinlich weit mehr.
Dabei war Rawalpindi beileibe keine imperiale Metropole. So wie die Hauptstädter eines großen Reiches mit entsprechendem Selbst- und Sendungsbewusstsein, etwa die Einwohner von Lahore oder Delhi, ticken die Bewohner Rawalpindis nicht. Das britische Empire schätzte die Stadt zwar als wichtigen Militärposten. Aber die Briten machten den Ort nie zu einer kolonialen Metropole im Rang von Kalkutta, Madras oder Bombay.
Stattdessen waren es stolze Händler, die den Stadtethos prägten. Ein merkantiler und kosmopolitischer Geist der Basargilden und religiösen Prozessionen der unterschiedlichen Konfessionen. »Es wurde mit viel Liebe gebaut, das zeigt sich in den Details der alten Gebäude«, erzählt Tauseef. »Und auch daran, wie die Menschen über die Stadt reden, die sie vor der Teilung erlebt haben. Sie erzählen mit so viel Herzblut und Begeisterung. Ein irrer Gegensatz zu heute.«
Die Teilung teilt auch die Erinnerung an Rawalpindi. In ein Rawalpindi der Vergangenheit, einen geliebten Sehnsuchtsort auf vergilbten Schwarz-Weiß-Bildern im Exil. Und ein Rawalpindi der Gegenwart, in der die Bewohner mit dem Erbe der Stadt nie so richtig warm wurden.
Die Teilung bezieht sich auf die Aufteilung des indischen Subkontinents in zwei unabhängige Staaten im Jahr 1947, das mehrheitlich hinduistische Indien und Pakistan, gedacht als sichere Heimstätte der Muslime des Subkontinents. Das letzte Erbe des britischen Vizekönigs Lord Mountbatten, bevor das Königreich seine Lieblingskolonie in die Unabhängigkeit entließ. Ausgearbeitet von dem britischen Kolonialbeamten Cyril Radcliffe, der nie einen Fuß nach Indien gesetzt hatte. Und dessen Grenzziehung quer durch die Provinzen Bengalen und Punjab Millionen Familien zu Flüchtlingen machte. Hundertausende kamen in den Wirren der Teilung ums Leben.
Die Teilung veränderte die Stadt für immer. Rawalpindi wurde von einer mehrheitlich Sikh-hinduistischen Stadt zu einer mehrheitlich muslimischen. Die Sikhs und die Hindus flohen vor marodierenden Horden nach Indien. Die Einschussspuren finden sich noch heute an den verlasseneren Tempeln. Während ihrerseits von einem enthemmten Mob aus ihren Heimatstädten in Indien vertriebene Muslime ihren Platz einnahmen. Auch Tauseefs Großeltern kamen so aus Delhi und der Stadt Firozpur nach Rawalpindi. Diese Menschen suchten eine sichere Zuflucht, die Feinheiten ihrer neuen Heimat waren erstmal zweitrangig.
»Einige Geschichten nimmt man sofort als seine eigenen wahr, andere nicht«, glaubt Tauseef. Weil Rawalpindi so offensichtlich eine Stadt der Sikhs und Hindus war, haben die heutigen Bewohner dieses Erbe nicht als Teil der eigenen Vergangenheit anerkannt. Sie zogen zwar in die Hüllen der prächtigen Stadtpalais der Händlerfamilien, der Tempel und Geschäfte. Die Seele der Stadt blieb aber auf der Strecke.
Kein Wunder also, dass die neuen Bewohner voll auf die futuristische Vision von Constantinos Doxiades (1913-1975) ansprangen, die nur wenige Kilometer entfernt in Islamabad entstehen sollte. Eine moderne Planstadt, sauber und geordnet, ein neues Leben, sicher vielleicht auch vor den Erinnerungen an die Vergangenheit.
Vielleicht kam hinzu, dass Doxiades selbst Flüchtling war. Als Kind musste er mit in den langen Wirren der Auflösung des Osmanischen Reiches seine Heimatstadt Stanimaka in Süden des heutigen Bulgariens verlassen und wie hunderttausende Griechen aus dem Balkan und Anatolien nach Griechenland umsiedeln, während ihrerseits Bulgaren aus Griechenland die verwaisten Ortschaften an der Schwarzmeerküste und den Rhodopen besiedelten. Die Flucht in die Zukunft brachte freilich ihre eigenen Probleme. Die urbanen Visionen des Zeitalters des Autoverkehres, die Doxiades auch in Riad und Sadr City in Bagdad erträumte und umsetzte, haben sich anderswo längst zu realen stadtplanerischen Albträumen der Gegenwart entwickelt.
Die Geister der Vergangenheit leben dagegen im Internet weiter. Eine junge Generation von Anthropologen, Historikern und Denkmalpflegern hat sich über die Nationengrenzen des Subkontinents hinweg vernetzt. Tauseef tauscht sich fast täglich mit Kollegen aus, teilt alte Fotos und neue, hat viele Freunde gewonnen. Immer wieder melden sich aus den Exil Nachfahren von Familien bei ihm, die 1947 die Stadt verlassen mussten. Er hilft dann dabei, bruchstückhafte Familienerinnerungen zusammenzusetzen.
In Lahore und Peschawar hat sich eine aktive Denkmalpflegeszene entwickelt. Viele Häuser in der Altstadt konnten vor dem Verfall bewahrt werden. Auch in Rawalpindi stehen jetzt Renovierungen von Stadtdenkmälern in der Altstadt auf der Agenda. Hassaan Tauseef sieht der Zukunft positiv entgegen will sich als nächstes mit einem Masterstudium fortbilden. Und ist ziemlich zufrieden. »Meine Arbeit lässt mich wirklich gut fühlen«, sagt er und lächelt.