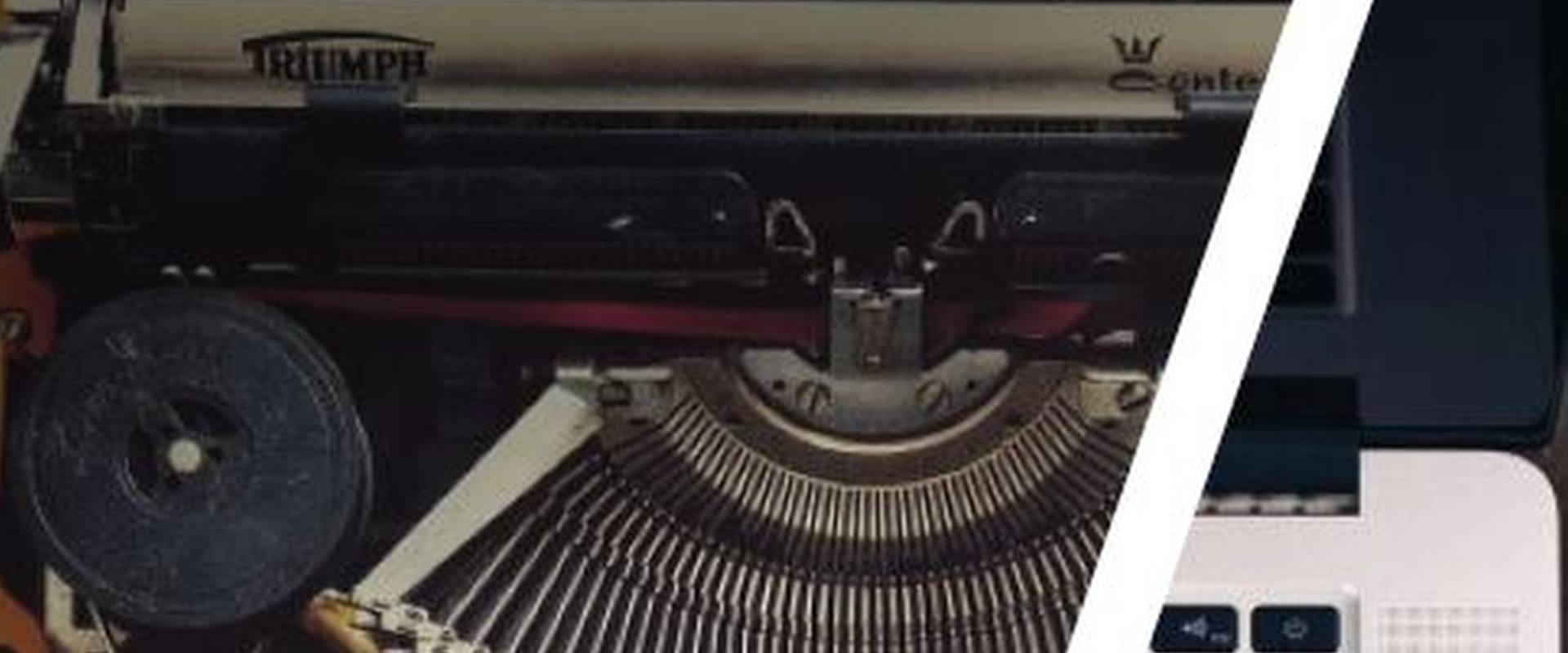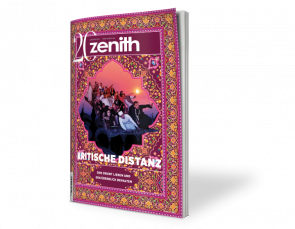Mehr und vielfältiger – hat sich die Berichterstattung über den Nahen Osten tatsächlich verbessert? Eine Bestandsaufnahme, in der Peter Scholl-Latour nur ein einziges Mal vorkommt.
»Plagiat, Paraphrase und Stuß – gehen nahtlos ineinander über.« Das Urteil des Experten über den vermeintlichen Experten fiel verheerend aus. 1992 entlarvte der Hamburger Islamwissenschaftler Gernot Rotter den erfolgreichen Sachbuchautor Gerhard Konzelmann als »Allahs Plagiator«. Konzelmann, Jahrgang 1932, lange Jahre Korrespondent der ARD in Beirut und Autor einer Vielzahl von Bestsellern über die arabische Welt, verbreitete, so Rotter, ein rassistisch geprägtes Zerrbild des Orients.
Auch Peter Scholl-Latour, das bekannteste Gesicht unter den Nahost-Journalisten und acht Jahre älter als Konzelmann, genoss in der Fachwelt keinen guten Ruf. Zu paternalistisch, zu kulturalistisch war sein Blick auf die islamisch geprägte Welt und die Menschen, die dort leben, so der Vorwurf. Nun wäre es unfair, die Berichterstattung jener Zeit zu reduzieren auf zwei ältere Herren mit dem Hang zur fabulierenden Welterklärung.
Darauf, wie die arabische Welt in deutschsprachigen Medien dargestellt wurde, hatten auch andere alte Männer Einfluss: Rudolph Chimelli in der Süddeutschen Zeitung, der 2019 gestorbene Arnold Hottinger in der Neuen Zürcher Zeitung oder, etwas jünger, Volkhard Windfuhr für den Spiegel und Wolfgang Günther Lerch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieben klug und kenntnisreich aus und über die Region.
Der Wunsch, weniger global über die islamisch geprägte Welt zu berichten, Einblicke in den Alltag zu ermöglichen und auch häufiger Stimmen aus den Ländern selbst zu hören, war ein Antrieb für die Gründung von zenith. Als Schüler von Gernot Rotter in Hamburg inspirierte viele von uns sein politisches und publizistisches Engagement, seine Bereitschaft, zu gleichermaßen rustikalen wie klugen Diskussionen anzuspornen. Wir wollten einen »anderen« Nahostjournalismus.
Ob Berichterstattung nachhaltig und vielfältig ist, hängt davon ab, in welche Länder Medienhäuser ihre Korrespondenten schicken und wen sie schicken.
Die Voraussetzungen, die wir dafür mitbrachten, waren aber eher mittelprächtig: Als Studenten der Islam- und Geschichtswissenschaft waren wir zwar naturgemäß einige Jahrzehnte jünger als die Altvorderen, an denen wir uns abarbeiteten, die wir – eher unausgesprochen – aber auch irgendwie bewunderten. Eine Frau suchte man in unseren Reihen zu Anfang vergeblich, und auch hatte niemand von uns das, was Ende der 1990er-Jahre den Namen Migrationshintergrund bekam. Wie beschränkt der eigene Blick ist, wie begrenzt die sprachlichen Möglichkeiten trotz aller Bemühungen waren, war uns bewusst. Es zu thematisieren gehört bei zenith dazu, doch die eigene Perspektive loszuwerden ist ebenso zweifelhaft wie unmöglich, da hilft auch die x-te Lektüre von Edward Saids »Orientalism« nichts.
Bleibt die Frage, ob und wie sich die Berichterstattung in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat, nicht nur bei zenith, sondern generell in der deutschsprachigen Medienlandschaft.
Ein Versuch in drei Thesen: Erstens: Die Berichterstattung über den Nahen Osten ist umfangreicher geworden, findet nicht mehr nur im Politikressort statt. Zweitens: Sie zeichnet sich durch mehr Vielfalt aus, auch unter den Journalisten, die aus der Region berichten. Und drittens: Journalisten laufen Gefahr, als Partei in einem zunehmend polarisierten Diskurs wahrgenommen zu werden.
Eine Zäsur waren die Anschläge am 11. September 2001, wurden sie doch von vielen auch wegen ihrer Bildgewalt als Angriff auf die westliche Zivilisation wahrgenommen. Die ein paar Jahre zuvor aufgestellte These von Samuel Huntington, dass der Welt ein »Kampf der Kulturen« bevorsteht, schien Nahrung zu bekommen. Es ist den deutschen Medien hoch anzurechnen, dass sie – nicht alle, aber doch im Wesentlichen – sich nicht auf ein vereinfachtes Freund-Feind- Schema einließen, sondern versuchten zu verstehen.
Berichtet wurde nicht nur im Politikteil der Zeitungen, auch in den Feuilletons entfalteten sich lebhafte Debatten. Redaktionen bemühten sich um arabische oder afghanische Gesprächspartner und Gastautoren – was sicher auch an Entwicklungen in der arabischen Medienwelt selbst lag. Mit der Gründung des Satellitensenders Al-Jazeera (1996) und seiner wachsenden Bedeutung wurde bei allen teils berechtigten, teils unberechtigten Vorbehalten deutlich, dass es nicht möglich ist, zu verstehen, »Wie der Araber tickt«, wenn man nicht mit ihm selbst spricht.
Die Welle des Interesses hielt – verstärkt durch die Kriege in Afghanistan und im Irak – recht lange an. Einen Eindruck, wie vielfältig die Stimmen aus den arabischen Staaten sind, ermöglichte 2004 die Frankfurter Buchmesse, die die arabische Welt als Gastland einlud – mit entsprechendem Widerhall in den Medien.
Für die Journalistin Charlotte Wiedemann, deren Buch »Der lange Abschied von der weißen Dominanz« in diesem Herbst erscheint, hat die große Aufmerksamkeit, die die arabische Welt seither erhalten hat, auch Schattenseiten: »Die Tendenz, den Nahen und Mittleren Osten wie ein Synonym für die islamische Welt als Ganzes zu behandeln, hat sich leider noch verstärkt. Für eigenständige Entwicklungen in der nicht-arabischen muslimischen Mehrheitswelt fehlt jegliche Neugier; die Berichterstattung zu Indonesien war vor zwei Jahrzehnten umfangreicher und kenntnisreicher als heute.«
Einen Eindruck, wie vielfältig die Stimmen aus den arabischen Staaten sind, ermöglichte 2004 die Frankfurter Buchmesse.
Auch Carola Richter, Professorin für interkulturelle Kommunikation an der Freien Universität Berlin, kritisiert, dass das Mehr an Berichterstattung äußerst ungleich verteilt ist. Kurzfristig geraten einzelne Länder in den Blickpunkt, sagt sie. Beispielsweise habe es über den Libyen-Krieg 2011 »massive Berichterstattung gegeben, die nach Abflauen der Kampfhandlungen noch ein bisschen anhielt und auch die sozialen und kulturellen Aspekte des Landes und der Bevölkerung aufzeigte, dann aber komplett nachließ«. Ähnlich, so Richter, verhalte es sich mit politischen Ereignissen in Tunesien, Algerien, Sudan.
Auf kurzfristige Aufmerksamkeit folge bald wieder »völlige Dunkelheit«. Auf die aufregenden Zeiten seit dem Arabischen Frühling 2011 folgte ein »aufmerksamkeitsökonomischer Rückfall«, bemerkte 2016 die Zeit-Online-Redakteurin Andrea Backhaus: Das habe mit der Repression in Ländern wie Ägypten zu tun, aber auch damit, dass Kriegsländer wie Syrien, Jemen oder Libyen für unabhängige Journalisten schwer zugänglich seien. Ob eine breitere Berichterstattung tatsächlich nachhaltig ist und ob sie auch vielfältiger ist, hängt somit stark von strukturellen Fragen ab: Etwa davon, in welche Länder Medienhäuser ihre Korrespondenten schicken, und auch davon, wen sie schicken.
»Als ich als junger Journalist in Kairo ankam, trafen sich die deutschen Korrespondenten einmal die Woche bei einem gepflegten Glas Whiskey, um die Lage zu besprechen, allesamt Männer und kaum jemand, der Arabisch konnte«, erinnerte sich Karim El-Gawhary in der zenith-Rubrik »Scholl-Latours Erben«. Ende der 1980er, Anfang der 1990er-Jahre war der Islamwissenschaftler, Sohn eines Ägypters und einer Deutschen, noch ein Exot unter den Korrespondenten.
Fachjournalisten, die sich hintergründig mit den Ländern im Nahen Osten befassen, werden in den sozialen Medien schnell als Islamversteher geschmäht.
Das hat sich etwas geändert. Zum einen hat die Islamwissenschaft den Status des Orchideenfachs nach dem 11. September und durch bessere berufliche Möglichkeiten etwas verloren. Zum anderen trauen sich mehr deutsche Medienhäuser, Frauen und Menschen, deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind, als Korrespondenten in die Region zu schicken. Als gehörte Mut dazu. Natalie Amiri, Deniz Yücel, Yassin Musharbash und andere haben gezeigt, dass sie nicht nur gute Journalisten sind, sondern durch ihr sprachliches und kulturelles Verständnis häufig einen besseren Einblick haben als Kollegen ohne Migrationshintergrund. Allerdings sind sie weiterhin in der Minderheit. »Der typische Korrespondent wird zwar jünger und ein bisschen weiblicher, in der Mehrheit ist er aber immer noch weiß«, konstatiert Carola Richter.
Ein Befund, der übrigens auch für zenith noch gilt. Dass es nicht mehr nur ein paar alte Platzhirsche gibt, die den Diskurs bestimmen, ist für Charlotte Wiedemann aber noch keine hinreichende Bedingung für Qualität: »Am Beispiel Iran zeigt sich, dass die neu entstandene Vielfalt der Beitragenden keineswegs nur Vorteile hat. Selbst angesehene Medien publizieren heute kostengünstige Iran-Newcomer-Beiträge, die von sachlichen Fehlern nur so strotzen. Solange die politische Richtung stimmt, gegen die Islamische Republik, ist keine Suppe zu dünn.« Wenn es um kontroverse Themen geht, wie etwa den Konflikt um das iranische Atomprogramm, sind Journalisten nicht nur Berichterstatter – sie stehen auch unter erhöhter Beobachtung. Melden sie sich auch noch in Netzwerken wie Twitter oder Facebook zu Wort – wo Meinungen stärker wahrgenommen werden als Artikel, in denen mehrere Seiten eines Konfliktes zu Wort kommen –, dann wird ihnen schnell Parteilichkeit vorgeworfen. Fachjournalisten, die sich hintergründig mit den Ländern im Nahen Osten befassen, werden dann schnell als Islamversteher geschmäht.
Das Phänomen ist jedoch im Grundsatz keineswegs neu, sagt Carola Richter. Sie verweist auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. »Es wurde schon immer versucht, Nahostjournalisten der einen oder der anderen Seite zuzuordnen. Viele Journalisten vertreten aber auch relativ klare Meinungen zum Nahostkonflikt und ordnen sich in ihrer Bewertung von Schuld und Verantwortung auch durch die Wortwahl stärker oder weniger stark einer Seite zu. Es besteht also nicht nur die Gefahr, dass sie als parteiisch wahrgenommen werden, sondern angesichts der gesellschaftlichen Polarisierung auch zunehmend, dass sie sich selbst als parteiisch verstehen und dann auch so berichten.«
Neu ist allerdings die Vielzahl der Themen aus dem Nahen Osten, die in Deutschland kontrovers und emotional diskutiert werden. Die Rolle Irans in der Region, der Krieg in Syrien, die türkische Innen- und Außenpolitik. Dazu kommen die Themenfelder, die Deutschland konkreter betreffen: Integration, Flucht und Muslime in Deutschland. Der Diskurs über sie polarisiert und nimmt ressortübergreifend breiten Raum in den Medien ein. Mehr heißt aber auch hier nicht unbedingt besser: So manche Kopftuchdiskussion aus dem Jahr 2019 hätte genauso auch schon vor 20 Jahren geführt werden können. Und sie wurde es auch.
Moritz Behrendt gehört zu den Gründern und Herausgebern von zenith. Er arbeitet als freier Journalist für den Sender Deutschlandfunk Kultur sowie für verschiedene Zeitungen.