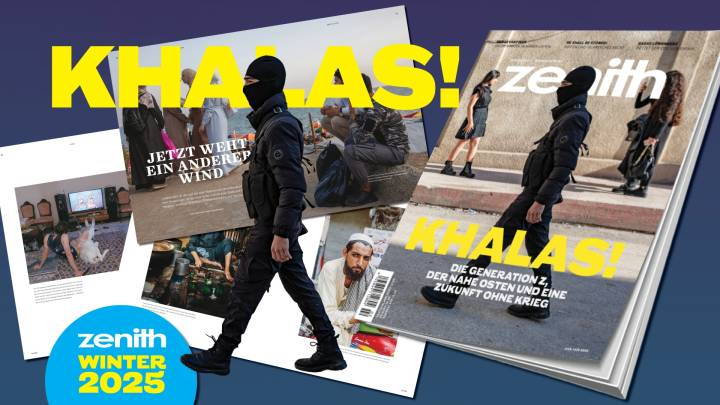Drei Lehren, die man in der arabischen Welt aus dem Fall von Kabul ziehen wird.
Es war eine der denkwürdigsten Szenen der Nachrichtenwelt 2021. Die BBC-Reporterin Lyse Doucet wird in einer Live-Schalte aus Kabul gefragt, ob sie die Reuters-Meldung vom Abflug der letzten amerikanischen Truppen bestätigen könne. Sie antwortet lapidar: »Horchen Sie mal!« Überall in der Stadt schießen Taliban-Kämpfer Freudenfeuer in den Himmel.
Der Rückzug der von den USA geführten internationalen Streitkräfte aus Afghanistan war einerseits peinlich für die Supermacht, andererseits konnte sich die Biden-Regierung sicher sein, dass sie die öffentliche Meinung in der Heimat hinter sich hat. Das betraf nicht die Wahl der Mittel, aber das grundsätzliche Ziel, den Afghanistan-Einsatz zu beenden. Aber läuft dieser Abzug tatsächlich amerikanischen Interessen zuwider? Und folgte er einer »Bloß raus hier«- Logik ohne Rücksicht auf Verluste? Das kommt wie immer auf die Perspektive an.
Nach 20 Jahren Afghanistan-Einsatz haben die USA auf dem geopolitischen Schachbrett nicht gerade ihre Macht vermehrt. Im Laufe der Jahre wurden vielmehr diejenigen Kräfte gestärkt, die von den USA tendenziell als Gegenspieler angesehen werden. 2001 sorgte sich Washington wenig um eine Rückkehr Russlands auf die Bühne der Weltpolitik. Mit ihrer Präsenz in Afghanistan nahmen die Koalitionskräfte stellvertretend russische Sicherheitsinteressen an der Südgrenze der Föderation wahr – und stärkten indirekt auch die mit Russland verbündeten Staaten Zentralasiens.
Das gilt auch für die Islamische Republik Iran, wenngleich die iranische Führung immer wieder betonte, dass sie sich von den USA an ihrer Ostgrenze belagert fühlt. In den 1990er Jahren hatte Iran große Probleme mit den Taliban. Die afghanische Grenze band Ressourcen. Iran erlebte Flüchtlingswellen aus Afghanistan, die in der lokalen Wahrnehmung jene in Deutschland 2015 übertrafen. Der Sturz der Taliban lag also in iranischem Interesse, so sehr, dass man US-Nachrichtendiensten 2001 sogar bei der Zielaufklärung half. Der iranische Einfluss in Afghanistan hat seitdem zugenommen und Ressourcen für Einsätze in den westlichen Nachbarstaaten freigesetzt.
Warum die Bekämpfung der Aufstände in Syrien und im Irak gelang, in Afghanistan aber nicht
Auch China hat mit seinem One-Belt-One-Road-Projekt zur wirtschaftlichen und geostrategischen Erschließung Zentralasiens von der Präsenz europäischer und amerikanischer Truppen profitiert – was man von den westlichen Staaten nicht behaupten kann. In geringerem Maße gilt das sogar für die Regionalmacht Türkei. Von Indien abgesehen, können die meisten Anrainer mit einem stabilen, islamistischen Taliban-Staat leben. Zerfällt Afghanistan in einem neuen Bürgerkrieg, wird dies die Mächte der Region beschäftigt halten.
Rivalitäten werden sich verschärfen und in einem Nullsummenspiel münden, wie wir es in den vergangenen Jahren im Nahen Osten und am Persischen Golf verfolgen konnten: Egal, ob ich gewinne, Hauptsache, mein Feind verliert. Und es könnte durchaus sein, dass sich die USA für längere Zeit auf diese Logik einlassen. Darüber hinaus ist zu hinterfragen, ob die »Schmach von Kabul« einen Reputationsverlust darstellt, der die amerikanischen Interessen langfristig beschädigt.
Der Fall von Afghanistan wurde vielfach als Fortsetzung des amerikanischen Rückzugs von der Weltbühne betrachtet, insbesondere aus den instabilen Regionen des Nahen Ostens und der muslimischen Welt. Einige Kommentatoren meinen, dass die USA deshalb von ihren Rivalen nicht mehr gefürchtet werden müssten.
Die Furcht vor der amerikanischen Militärmacht wird ein bestimmender Faktor bleiben
Hatte Barack Obama nicht 2013 angekündigt, dass das Überschreiten seiner »roten Linie« – der Einsatz von Chemiewaffen – ein militärisches Eingreifen zur Folge in Syrien haben werde? Und hat er dann seine Drohung etwa beherzigt? Hatte nicht Donald Trump, der Bluffer, der mal damit drohte, ganze Staaten zu vernichten, dann wieder erklärt, die Welt und besonders Amerikas Verbündete sollten sich gefälligst um ihre eigene Sicherheit kümmern?
Bidens Afghanistan-Politik wirkt da wie die Fortsetzung einer Tendenz. Dabei wäre es trügerisch zu glauben, die USA würden nicht mehr ernst genommen, wie man es immer wieder von europäischen Experten hört. Auf den Nahen Osten jedenfalls trifft das gewiss nicht zu: Die Ansicht, dass hinter jedem Zug aus Washington ein großer strategischer Plan steckt, ist in der arabischen Welt nach wie vor sehr weit verbreitet. Die Machthaber und politischen Eliten schauen noch immer nach Amerika – ganz gewiss nicht nach Europa –, um das Schicksal der Welt und ihr eigenes zu lesen.
Das hängt einerseits mit der Markt- und Finanzmacht der USA zusammen, aber auch mit ihrem gewaltigen Schadenspotenzial. Man weiß aus langjähriger Erfahrung, dass die Amerikaner keine Scheu haben, mit massivem Druck und militärischer Gewalt vorzugehen, wenn ihre Interessen oder gar ihre Sicherheit gefährdet sind. Schnell und manchmal überraschend.
Die normative Kraft dieser Gewaltbereitschaft wird auch weiterhin die Beziehungen zwischen den USA und den Staaten der Region bestimmen. Zur Zeit der neokonservativen Bewegung in Amerika, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, kam Machiavellis Diktum in Mode, wonach es für einen Fürsten besser ist, gefürchtet als geliebt zu werden. Angesichts der – insgesamt wenig progressiven – politischen Mentalität der Führer der arabischen Staaten wird die Furcht vor der amerikanischen Militärmacht ein bestimmender Faktor bleiben.
In puncto Machterhalt ist weniger entscheidend, ob ein System parlamentaristisch oder diktatorisch regiert wird
Man soll die ethnische und kulturelle Gemengelage in Afghanistan nicht mit jener in der arabischen Welt gleichsetzen. Aber einige gemeinsame Maßstäbe gibt es doch. Der Fall von Kabul zeigt: In puncto Machterhalt ist weniger entscheidend, ob ein System parlamentaristisch oder diktatorisch regiert wird. Es kommt auf zwei Faktoren an: die Möglichkeit, die Bevölkerung massenhaft zu mobilisieren, sowie die Unterstützung durch internationale Mächte mit großer Feuerkraft.
Dem syrischen Regime im Nahen Osten gelang dies mit einer Mischung aus Mobilisierung bestimmter Volksgruppen und russischer sowie iranischer Schützenhilfe, die zum Teil arbeitsteilig verlief. Man konnte so Aufständische niederschlagen, obwohl diese über militärtaktische Erfahrung verfügten, starke ausländische Unterstützung und den Rückhalt eines kritischen Anteils in der Bevölkerung genossen.
Im Irak, wo ein zwar defizitäres, aber immerhin parlamentarisches System besteht, gelang die Niederschlagung des so genannten Islamischen Staats (IS). Es mag zwar politisch opportun erscheinen, den IS als ausländische Terrorgruppe oder Verschwörung darzustellen. Diejenigen Iraker, die an der Front kämpften, wissen allerdings, dass das nur ein Teil der Geschichte ist. Der Kampf des IS hatte Merkmale eines sunnitischen Aufstands – mit einem gewissen, wenngleich nicht kritischen Rückhalt in der Bevölkerung.
Die irakische Regierung bekämpfte diesen einerseits mit Hilfe internationaler Mächte (Iran, USA, Nato-Staaten), andererseits mit dem Mittel der Volksmobilisierung. Dies geschah nach dem Aufruf des schiitischen Großayatollahs Ali Sistani im Sommer 2014 an die Bevölkerung, die Heimat zu verteidigen. Es folgte just die Gründung einer paramilitärischen Streitmacht, der Volksmobilisierung (Al-Haschd al-Schabi). Sistanis Fatwa hatte sich an alle Iraker gerichtet, angesprochen fühlten sich natürlich die Schiiten.
Das afghanische Beispiel zeigt zumindest der arabischen Welt, was passiert, wenn die 'Asabiya fehlt
Und ausschlaggebend für den inneren Zusammenhalt und die Moral des Haschd waren nicht nur Patriotismus und der finanzielle Anreiz für mehr als 100.000 großenteils arbeitslose junge Männer, sondern die ethno-konfessionelle Solidarität. Selbst wenn sich sunnitische Kräfte, etwa Stämme, und religiöse Minderheiten der Bewegung anschlossen, war der schiitische Faktor entscheidend.
Auch im pseudosäkularen Syrien spielte eine paramilitärische Volksmobilisierung (Quwat Al-Difaa Al-Watani) eine entscheidende Rolle in einer kritischen Phase des Krieges. Implizit handelte es sich dabei um ein Instrument der ethnisch- konfessionellen Mobilisierung: Alawiten, Christen – Sunniten nur, sofern sie aus bestimmten loyalen Gegenden mit einer historischen Bindung zum Assad-Regime kamen.
Diese innere Kohäsionskraft wirkte auch bei den zahlreichen mafiös organisierten Freischärlermilizen, die auf eigene Rechnung, aber an der Seite des Regime kämpften. Unter Bezugnahme auf den arabischen Soziologen Ibn Khaldun wird diese Solidarität beziehungsweise Kohäsionskraft auch 'Asabiya genannt.
Während man in Syrien diese Streitkräfte später zurückbaute und versuchte, die staatliche Kontrolle über sie wiederzuerlangen, wurde der irakische Haschd nach seiner nominellen Integration in die staatlichen Streitkräfte zu einer gewaltigen politischen Kraft, die der Regierung und dem parlamentarischen System allerhand Probleme macht.
Das afghanische Beispiel zeigt zumindest der arabischen Welt, was passiert, wenn eine solche 'Asabiya fehlt: Man verlässt sich selbst auf eine professionelle Armee, gerade um die ethnisch-konfessionellen Spaltungen zu überwinden, und steht mit den Taliban einer Streitmacht gegenüber, die in sich zwar divers sein mag, aber über drei Kohäsionskräfte verfügt: paschtunische Solidarität, das Narrativ einer nationalen Widerstandsbewegung und die islamistische Ideologie. Durch den Sieg der Taliban werden sich diejenigen im Nahen Osten bestätigt sehen, die von der Wirksamkeit der paramilitärischen Mobilisierung auf Grundlage der 'Asabiya überzeugt sind – und ihre Strategie anhand dieser Logik ausrichten.
Ähnlich mussten sich die Anhänger Ayatollah Khomeinis fühlen, als der Schah 1979 das Land verließ, ohne unter den Demonstranten ein Massaker anzurichten
Ihr Titel lautet »die Höhle«, und diese 18. Sure des Koran ist literarisch besonders interessant. Sie gibt unter anderem die muslimische Sicht auf die Legende der Siebenschläfer wieder: Junge Männer werden im heidnischen Römischen Reich als Christen verfolgt und in einer Höhle eingemauert, wo sie unbehelligt für 300 Jahre schlafen und erst wieder aufwachen, als der Glaube an den wahren Gott sich durchgesetzt hat. Ihr Problem löste sich sozusagen im Schlaf.
Diese anrührende Legende lässt viele Interpretationen zu, für islamistische Widerstandsbewegungen allerdings vor allem eine: Wer geduldig ist und auf Gott vertraut, kann auch übermächtige Gegner bezwingen. Die Taliban und selbst Al-Qaida-Veteran Ayman Al-Zawahiri – letzterer buchstäblich in einer Höhle sitzend – müssen überzeugt gewesen sein, dass Gottes Hand im Spiel war, als den Taliban fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Einmarsch der Koalitionstruppen in Afghanistan die Macht wieder in die Hände fiel.
Ähnlich mussten sich die Anhänger Ayatollah Khomeinis fühlen, als der Schah 1979 das Land verließ, ohne unter den Demonstranten ein Massaker anzurichten. Die schiitischen Widerstandsgruppen und -parteien konnten 2003 ihr Glück nicht fassen, als die US-Koalition erst ihren Peiniger Saddam Hussein absetzte und ihnen danach das politische System des Irak auf einem Silbertablett servierte.
Oder die Muslimbrüder in arabischen Ländern 2011 nach jahrzehntelanger Unterdrückung: Sie hatten den Arabischen Frühling nicht vom Zaun gebrochen, aber profitierten von der Gunst der Stunde. Eine obskure schiitische Widerstandsgruppe im Irak hat sich gar nach den Gefährten der Höhle (Ashab Al-Kahf) benannt und schwört, die Amerikaner aus dem Irak zu vertreiben.
Die islamistischen Kräfte denken langfristig und haben den seltenen Luxus, sich auf ein Thema zu konzentrieren
Es sind diese Kräfte, die sich heute auf der richtigen Seite der Geschichte sehen. In Europa und den westlichen Demokratien ändern sich die politischen Prioritäten schnell – die Aufmerksamkeitsökonomie ist manchmal schwer vorhersehbar: Klimawandel, Mindestlohn, Corona, Migration.
Regierungen kommen und gehen. Zudem sind 16 Jahre Merkel oder Kohl im europäischen Vergleich die Ausnahme. Die islamistischen Kräfte denken – wie ihre Gegenspieler in den arabischen Regimen – langfristig und haben den seltenen Luxus, sich auf ein Thema zu konzentrieren: die Machtübernahme beziehungsweise den eigenen Machterhalt.
Das Problem bei ideologisch gestählten, islamistischen Kräften, selbst wenn sie sich in demokratische Prozesse einbetten: Es gibt keine größere Pein für ein politisches System als Menschen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und dass sie sich ihr Recht auf die Macht durch jahrzehntelange Entbehrungen verdient haben, weil ihr Sieg von Gottes Gnaden ist. Sie sind gewissermaßen aus moralischer Erhabenheit heraus korrupt.
Was Europa betrifft, so wurde die Rolle der Muslimbrüder in den vergangenen Jahren auf groteske Weise überzeichnet – mehrheitlich aus populistischen Motiven. Aber trotz ihrer strukturellen Mängel und der massiven und zum Teil auch unverhältnismäßigen Repressionen, die sie in großen Teilen der arabischen Welt erleben – laut Berichten von Menschenrechtsgruppen wurden zuletzt mehrere Muslimbrüder in Ägypten gezielt und ohne Gerichtsverfahren liquidiert –, wird die islamistische Mobilisierung nicht von der Landkarte verschwinden.
Die Islamisten sind sozusagen wieder in der Höhle. Und der Sieg der Taliban bestätigt, dass man dort nur lange ausharren muss
Die Islamisten sind sozusagen wieder in der Höhle. Und der Sieg der Taliban bestätigt, dass man dort nur lange ausharren muss. Auch wenn die Höhle ein Gefängnis ist. Vor diesem Hintergrund müssen sich auch die islamistischen Kräfte in der syrischen Provinz Idlib bestätigt fühlen – wenngleich sich deren derzeitiger politischer und militärischer Erfolg unter anderen Vorzeichen einstellt.
Unter dem türkischen Schutzschild und bestärkt durch das Kalkül westlicher Staaten, dass ihre Niederschlagung die Migrationsströme in Gang setzen und das Assad-Regime stärken würde. Die in Idlib vorherrschende islamistische Miliz Hayat Tahrir Al-Scham dürfte sehr aufmerksam verfolgen, wie die Staatengemeinschaft mit dem Taliban-Regime verfährt.
Einer ihrer Anführer, Muhammad Al-Jolani, ehemals Kopf der dschihadistischen Al-Nusra-Front, propagiert eine national-islamistische Agenda und hofft, dass sich in Idlib langfristig ein Emirat errichten lässt, welches auf die Toleranz der westlichen Staatengemeinschaft hoffen könnte, solange es in Europa keine Terroranschläge verübt, die anti- westliche Propaganda einhegt und nicht zum Anziehungspunkt junger europäischer Dschihadisten wird.
Ein gewagtes Kalkül für Jolani, aber mangels Alternativen wohl das taktisch richtige, wenn man den eigenen Machterhalt zum Maßstab nimmt und nicht das Wohlergehen der Bevölkerung.