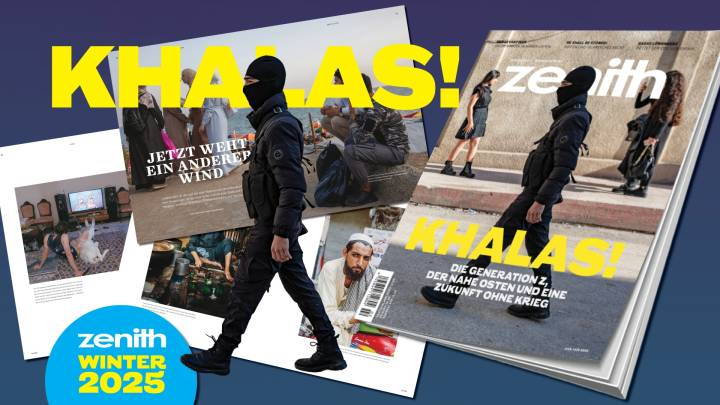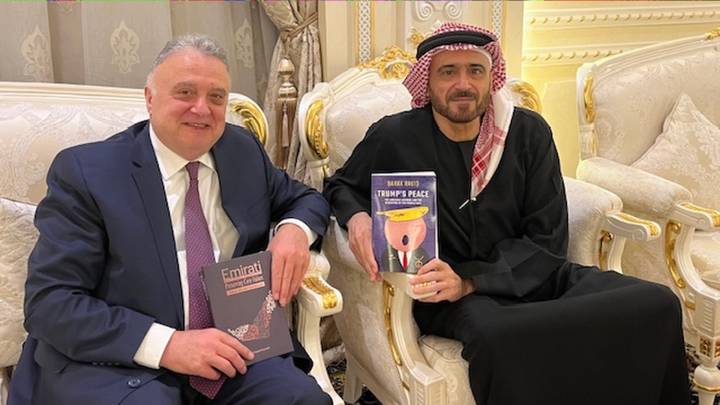Iran ließ die Frist verstreichen, die Sanktionen gegen Teherans Atomprogramm sind wieder in Kraft. Die Folgen reichen für das Regime weit über die Außen- und Sicherheitspolitik hinaus – und stoßen auch in der Gesellschaft Debatten an.
Das Atomabkommen von 2015 (JCPOA), das mit dem Konsens der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und Deutschlands ausgehandelt wurde, stellte einen seltenen Erfolg in der multilateralen Nichtverbreitungspolitik dar. Trumps Austritt im Jahr 2018 reduzierte es auf eine rechtliche Formalie und veranlasste Iran, die Einhaltung des Abkommens einzuschränken und Uran bis zu 60 Prozent anzureichern. Bis September 2025 meldete die Internationale Atomenergieorganisation IAEO einen Bestand von 441 Kilogramm hochangereichertem Uran in Teheran.
Trumps Rückkehr ins Amt im Jahr 2024 belebte die Diskussion um ein neues Abkommen, allerdings unter deutlich härteren Bedingungen. Während er und sein Sondergesandter Steve Witkoff gewisse Kompromissbereitschaft signalisierten, drängten Hardliner auf militärischen Druck. Trump warnte Ayatollah Ali Khamenei in einem persönlichen Brief, dass militärische Angriffe erreichen könnten, was die Diplomatie nicht könne. Die Verhandlungen begannen im April 2025, scheiterten jedoch nach den israelischen Angriffen auf iranische Atom- und Militäranlagen am 13. Juni – unterstützt durch US-Angriffe –, die einen zwölftägigen Krieg auslösten und die Haltung Teherans verhärteten.
Für Iran bestätigte das Timing die Vermutung, dass der IAEO-Bericht als Vorwand für die Aggression diente. Das Fehlen internationaler Verurteilung ließ auch das letzte Vertrauen in das Nichtverbreitungsregime schwinden. Daraufhin setzte Teheran die Zusammenarbeit mit der IAEO aus, was einen entscheidenden Bruch verursachte und zukünftige Verhandlungen erschwerte.
Präsident Pezeshkian schlug vor, die Verhandlungen könnten wieder aufgenommen werden, wenn die Sanktionen aufgehoben würden – was de facto die Fortsetzung des Stillstands bedeuten würde
Nach dem Krieg machte Iran die Wiederaufnahme der Gespräche mit den USA von Sicherheitsgarantien abhängig und bestand auf indirekten Verhandlungen. Die europäische Trojka E3 (Großbritannien, Frankreich, Deutschland) verknüpfte jedoch die Aufhebung der Sanktionen mit drei Forderungen: direkte Gespräche zwischen den USA und Iran, erneute Zusammenarbeit mit der IAEO und Offenlegung des verbleibenden auf 60 Prozent angereicherten Uranbestands. Iran lehnte diese Bedingungen ab, schloss aber eine begrenzte, von Kairo vermittelte Vereinbarung mit der IAEO. Die E3 sahen diesen Schritt als unzureichend, da ohne Zeitplan keine verlässliche Bewertung der Anreicherung oder der Schäden durch die Angriffe im Juni möglich sei. Am 28. August 2025 initiierte die Trojka formell den Sanktionsmechanismus im UN-Sicherheitsrat, während eine russisch-chinesische Resolution für einen Aufschub aufgrund des Widerstands der westlichen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats scheiterte.
Daraufhin setzte Irans Oberste Sicherheitsrat die Zusammenarbeit mit der IAEO aus, obwohl Teheran die formelle Benachrichtigung zurückhielt, um Raum für informelle Gespräche während der UN-Generalversammlung Ende September zu schaffen. Das Kompromissangebot, das Uran auf 20 Prozent anzureichern und der IAEO begrenzten Zugang zu gewähren, lehnte Washington ab, woraufhin die Verhandlungen in New York scheiterten. Präsident Masud Pezeshkian erklärte später, eine Einigung mit den E3 sei möglich gewesen, kritisierte aber die US-Forderung nach der vollständigen Übergabe des Urans als Grund für das Scheitern der Verhandlungen. Nach der Aktivierung des Mechanismus verweigerte Iran den IAEO-Inspektoren den Zutritt, und das Parlament verabschiedete ein Gesetz zur vorläufigen Einstellung der Zusammenarbeit.
Die Wiedereinsetzung des Sanktionsmechanismus verlieh den Debatten in Iran über die Nuklearpolitik neue Brisanz. 71 Abgeordnete forderten eine Überarbeitung der Verteidigungsdoktrin und machten dabei einen Unterschied zwischen der Fatwa des Obersten Revolutionsführers aus dem Jahr 2011, die den Einsatz von Atomwaffen verbietet, und der potenziellen Herstellung von Atomwaffen zur Abschreckung. Die Abgeordneten bestätigten öffentlich, dass ein Austritt aus dem NPT ernsthaft geprüft werde; die gesetzgeberischen Verfahren seien offenbar abgeschlossen. Ayatollah Khamenei erklärte zwar Gespräche mit den USA für »zwecklos«, Präsident Pezeshkian schlug jedoch vor, die Verhandlungen könnten wieder aufgenommen werden, wenn die Sanktionen aufgehoben würden – was de facto die Fortsetzung des Stillstands bedeuten würde.
Angst und Erschöpfung bestehen neben Ablenkung und kontrollierter Entspannung nebeneinander, wodurch sichergestellt wird, dass der gesellschaftliche Unmut diffus bleibt, obwohl das Gefühl der Unsicherheit zunimmt
»Snapback«, also die Wiedereinsetzung des UN-Sanktionsmechanismus – im Persischen Mekanism-e Masheh (in etwa »Auslöse- oder Entsicherungsmechanismus«) genannt – hat in Iran eine starke symbolische Bedeutung inne. Wie der entsicherte Abzug eines Gewehrs ruft er ein Gefühl von Unvermeidlichkeit und Angst hervor: Einmal ausgelöst, folgen die Konsequenzen automatisch. Für viele Iraner verstärkt die neuste Entwicklung im Atomstreit den Eindruck, dass das Land in einem Teufelskreis gefangen ist, in dem äußerer Druck kaum Raum für Verhandlungen lässt. Der Begriff selbst prägt die öffentliche Meinung und verstärkt das Gefühl, dass das tägliche Leben von geopolitischen Konflikten bestimmt wird.
Konkret schlägt sich dieses Gefühl in der wirtschaftlichen Belastung nieder: starke Inflationsspitzen, Währungsabwertung und finanzielle Härten für Haushalte, die ohnehin auf informelle Märkte angewiesen sind. Familien kürzen Ausgaben, junge Menschen haben kaum Beschäftigungschancen, und kleine Unternehmen leiden unter digitalen Beschränkungen und Internetblockaden. Der Staat setzt gleichzeitig auf Repression – mehr Hinrichtungen, gezielte Verhaftungen von Lehrern, Gewerkschaftern und Minderheitenaktivisten – um Unruhen im Kaim zu ersticken.
Gleichzeitig verfolgen die Behörden eine selektive Liberalisierung: Sie lockern die Hijab-Kontrollen, erlauben Konzerte und Freizeitveranstaltungen und signalisieren mehr Toleranz in kulturellen Bereichen. Diese Maßnahmen sind weniger Zugeständnisse an die Bevölkerung als vielmehr kalkulierte Politikinstrumente, um Druck aus dem Kessel zu nehmen und der Protestbewegung im Land keinen Auftrieb zu geben.
Das Ergebnis ist eine paradoxe gesellschaftliche Situation. Einerseits geraten Privathaushalte häufiger in finanzielle Schieflage, Vertrauen in die Institutionen sinkt stetig, während immer mehr Menschen nur och die Emigration als Ausweg sehen. Andererseits werden den Menschen begrenzte persönliche Freiheiten und Unterhaltungsangebote ermöglicht, die als Ventil für potenziellen Widerstand dienen sollen. Diese Strategie aus Repression und selektiver Lockerung zielt darauf ab, das politische System zu stabilisieren, indem Missstände lediglich gemanagt, aber nicht gelöst werden. In diesem Sinne verstärkt der Sanktionsmechanismus nicht nur den äußeren Druck auf die iranische Gesellschaft, sondern löst auch eine innere Umorientierung aus: Angst und Erschöpfung bestehen neben Ablenkung und kontrollierter Entspannung nebeneinander, wodurch sichergestellt wird, dass der gesellschaftliche Unmut diffus bleibt, obwohl das Gefühl der Unsicherheit zunimmt.
Kann der Staat den erhöhten Druck mit seiner bestehenden Sicherheitsdoktrin bewältigen oder muss er seine Außenpolitik und Abschreckungsstrategie grundlegend überdenken?
Die Wiedereinsetzung der Sanktionen hat die iranische Atomfrage in eine neue, instabilere Phase geführt. Gewaltandrohungen und Druckdiplomatie überschatten die Verhandlungen. Dieser Wandel wird das tiefe Misstrauen in Teheran verstärken, während er in den westlichen Hauptstädten die Überzeugung festigt, dass Druck, nicht Kompromiss, das wichtigste Instrument bleibt.
Innerhalb Irans dürften die Debatten im Rahmen des politischen Systems an Schärfe zunehmen. Hardliner verweisen auf die Sinnlosigkeit des Engagements und erwägen den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag, während Pragmatiker taktische Flexibilität fordern, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern. Diese Spannung verdeutlicht ein größeres strategisches Dilemma: Kann der Staat den erhöhten Druck mit seiner bestehenden Sicherheitsdoktrin bewältigen oder muss er seine Außenpolitik und Abschreckungsstrategie grundlegend überdenken?
Gleichzeitig verstärkt die Wiedereinsetzung der Sanktionen die inneren Widersprüche Irans. Die Herausforderung für die iranische Führung besteht darin, nicht nur äußeren Bedrohungen zu begegnen, sondern auch die Legitimität im Innern zu stärken, indem sie das empfindliche Gleichgewicht zwischen Kontrolle, Zugeständnissen und Überleben in einer Gesellschaft bewahrt, die zunehmend von Unsicherheit geprägt ist.
Symbolisch steht der Übergang vom JCPOA – in Iran als BARJAM bezeichnet, einem Begriff, der mit dem Wort Farjam (in etwa »gutes Ende«) assoziiert wird – zum Mekanism-e Masheh für den Wandel von Hoffnung zu Enttäuschung. Während Regierungsvertreter betonen, dass die Wiedereinsetzung der Sanktionen illegal sei und die Unterstützung Russlands und Chinas die Auswirkungen abmildern könne, bleibt ungewiss, welches Narrativ – Widerstand, Verzweiflung oder Anpassung – in der iranischen Öffentlichkeit dominieren wird.
Hessam Habibi Doroh ist Forscher am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement (IFK) am Landesverteidigungsakademie in Wien. Javad Heiran-Nia ist Direktor der Persian Gulf Studies Group am Center for Scientific Research and Middle East Strategic Studies in Iran.