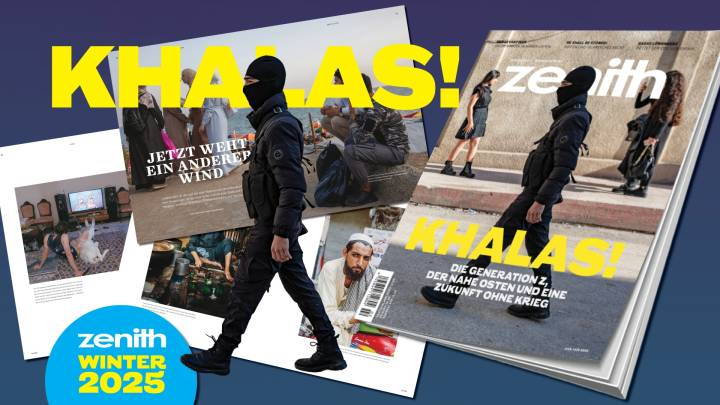Der türkische Präsident fürchtet den populären Bürgermeister Istanbuls als Herausforderer. Ekrem İmamoğlus Stärke, der Rückhalt in der urbanen Mittelschicht, ist Erdoğans Schwäche. Die Türkei steht am Scheideweg.
Was sich am 23. März 2025 in der Türkei ereignete, war ein neuer politischer Tiefpunkt: Ekrem İmamoğlu, der populäre Bürgermeister von Istanbul, hätte an diesem Tag offiziell als Präsidentschaftskandidat der oppositionellen Partei CHP nominiert werden sollen. Stattdessen wurde er wenige Tage davor verhaftet. Und mit ihm – in einer konzertierten Polizeiaktion – mehr als hundert weitere Parteimitglieder, darunter Bezirksbürgermeister, Wahlkampfleiter und Strategieberater.
Am 18. März hatte die Universität Istanbul ihm nach mehr als 30 Jahren seinen Bachelorabschluss aberkannt – ein bürokratischer Akt mit klarer politischer Stoßrichtung. Denn laut türkischer Verfassung darf nur antreten, wer einen Hochschulabschluss besitzt. Die Botschaft war eindeutig: İmamoğlu soll nicht kandidieren. Nicht in seiner Partei. Nicht fürs Präsidentenamt. Am besten: gar nicht mehr in der Öffentlichkeit existieren.
Diese Eskalation ist kein isolierter Vorfall. Sie steht in einer Linie mit zahlreichen Maßnahmen des Erdoğan-Regimes, das in İmamoğlu seinen gefährlichsten Herausforderer erkennt. Recep Tayyip Erdoğan, seit 2003 an der Macht – erst als Premier, seit 2014 als Präsident –, hat das politische Spielfeld systematisch neu geordnet. Unter dem Vorwand von Rechtsstaatlichkeit wurden Institutionen ausgehöhlt, Medien gleichgeschaltet, die Justiz instrumentalisiert. Was nach Demokratie aussieht, ist in Wahrheit ein eng gestecktes Machtregime, das sich alle fünf Jahre von Wahlen legitimieren lässt – solange deren Ergebnis kontrollierbar bleibt.
İmamoğlu aber ist nicht kontrollierbar. Er hat 2019 in der wichtigsten Stadt des Landes zweimal gegen die AKP gewonnen – nachdem Erdoğan die erste Wahl annullieren ließ, holte İmamoğlu im zweiten Anlauf einen noch deutlicheren Sieg. 2024 gelang ihm die Wiederwahl – trotz wirtschaftlicher Erschwernisse, trotz juristischer Verfahren, trotz massiver Propaganda.
Was İmamoğlu gefährlich macht, ist nicht Radikalität oder Populismus, sondern Reichweite. Er kann säkulare, linke, nationalistische und religiöse Wählerinnen und Wähler gleichermaßen ansprechen. Er rezitiert öffentlich aus dem Koran, lässt gleichzeitig aber die Porträts Atatürks über den Bosporus wehen. Er kann kurdische Stimmen gewinnen, ohne sich vom Nationalismus zu distanzieren. Kurz: Er überwindet das, was Erdoğan seit einigen Jahren ausgenutzt hat – die Fragmentierung der türkischen Gesellschaft.
Die Masse der Verhaftungen im Umfeld İmamoğlus dient nicht nur der Zerschlagung eines Wahlkampfteams – sie soll die CHP insgesamt schwächen
Erdoğan agiert nicht aus Stärke, sondern aus politischer Sorge. Denn seine politische Bilanz ist desaströs. Die türkische Lira hat seit 2020 rund 85 Prozent ihres Wertes verloren. Die Inflation liegt laut offiziellen Angaben bei 50 Prozent – inoffiziell wird sie auf deutlich mehr geschätzt. Ganze Generationen gut ausgebildeter junger Menschen verlassen das Land. Die Immobilienpreise explodieren, die Kaufkraft sinkt, das Vertrauen in staatliche Institutionen ist erschüttert.
Diese ökonomische Misere ist kein Naturereignis. Sie ist direkte Folge von Erdoğan-Politik: etwa seiner jahrelangen Weigerung, die Zinsen zu erhöhen, weil er – entgegen jeder volkswirtschaftlichen Lehre – niedrige Zinsen als Waffe gegen Inflation betrachtete. Erst nach der Wahl 2023 wurde der Kurs unter internationalem Druck geändert. Doch zu spät. Das Vertrauen war dahin, und mit ihm der Rückhalt in der urbanen Mittelschicht. Und genau dort liegt İmamoğlus Stärke. In den Städten, bei den Jungen, den Akademikerinnen und Akademikern, den religiös Gemäßigten. Erdoğan kann keine überzeugende Mehrheit mehr gewinnen – also sorgt er dafür, dass der einzige Kandidat, der sie vereinen könnte, gar nicht erst antritt.
Die aktuelle Kampagne gegen İmamoğlu reicht über das Persönliche hinaus. Sie zielt auf die Republikanische Volkspartei CHP, die sich nach dem Abgang des langjährigen Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu neu aufgestellt hat. Unter Özgür Özel positioniert sie sich deutlich entschlossener gegen das autoritäre Regime. Doch auch das wird nun bestraft. Die Masse der Verhaftungen im Umfeld İmamoğlus dient nicht nur der Zerschlagung eines Wahlkampfteams – sie soll die Partei insgesamt schwächen, sie kriminalisieren, ihre innerparteiliche Demokratie lähmen.
Das geschieht unter Vorwürfen wie dem der Unterstützung einer terroristischen Organisation, konkret: angebliche Verbindungen zur kurdischen DEM/HDP beziehungsweise zur PKK. Dass die HDP eine legale Partei im türkischen Parlament war, spielt keine Rolle. Dass gleichzeitig Erdoğan selbst mit dem inhaftierten PKK-Führer Abdullah Öcalan über eine mögliche Versöhnung sprechen lässt, wird im staatlichen Narrativ ausgeblendet. Es geht nicht um Kohärenz. Es geht um Kontrolle.
Wer glaubt, autoritäre Systeme stabilisieren sich irgendwann von selbst, irrt. Sie destabilisieren zuerst sich selbst – und dann ihre Umgebung
Die Türkei steht am Scheideweg. Erdoğan hat das Zwei-Amtszeiten-Limit bereits durch formale Tricks unterlaufen. Nun steht die nächste Verfassungsänderung im Raum, die ihm faktisch unbegrenzte Wiederwahl ermöglichen würde. Doch dafür braucht es eine Mehrheit im Parlament – und möglichst wenig Widerstand auf der Straße. Genau deshalb muss eine Figur wie İmamoğlu verschwinden. Sie ist zu sichtbar, zu beliebt, zu mobilisierend.
Was wir hier erleben, ist der Umbau einer defekten Demokratie in ein geschlossenes autoritäres System – mit funktionierenden Wahlen, aber ohne echte Wahlmöglichkeit. Mit Gerichten, die urteilen, aber nicht unabhängig sind. Mit einer Opposition, die existieren darf, solange sie nicht siegt.
Die Reaktionen in Europa bleiben verhalten. Dabei ist die Türkei nicht irgendein ferner Staat. Sie ist Nato-Mitglied, EU-Beitrittskandidat, strategischer Partner – und Nachbar. Der Abbau demokratischer Standards dort geht uns direkt an. Wer glaubt, autoritäre Systeme stabilisieren sich irgendwann von selbst, irrt. Sie destabilisieren zuerst sich selbst – und dann ihre Umgebung.
Was in Ankara gegen İmamoğlu geschieht, ist kein parteipolitischer Machtkampf. Es ist ein Angriff auf die Idee der Demokratie selbst: dass politische Konkurrenz erlaubt ist, dass Institutionen unabhängig arbeiten, dass der Wähler, die Wählerin frei entscheiden kann. Erdoğan zeigt gerade, dass all das für ihn nur Mittel zum Zweck war.
Hüseyin Çiçek ist Türkei-Experte, habilitierter Politik- und Religionswissenschaftler an der Fakultät für Psychologie der Sigmund-Freud-Universität und am Institut für Religionswissenschaft der Universität Wien sowie Fellow am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies der Universität Bonn. Dieser Kommentar ist zuerst im Standard erschienen. Übernahme mit freundlicher Genehmigung.