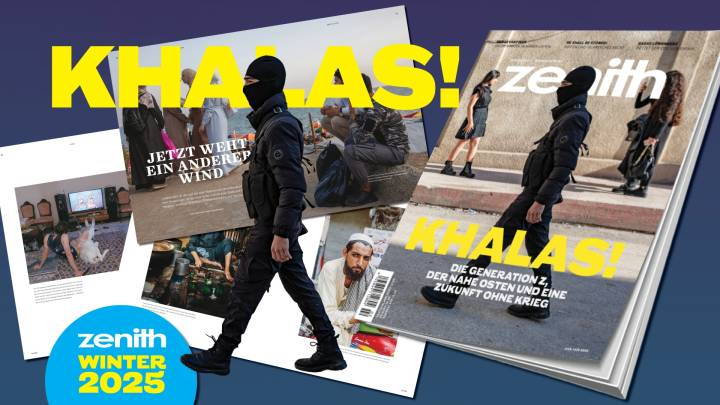Der Besuch des türkischen Präsidenten im Weißen Haus zeigt, wie sehr Recep Tayyip Erdoğan auf sein persönliches Verhältnis zu Donald Trump setzt – und warum er das heikelste Thema lieber ausklammerte.
Den Ton setzte Tom Barrack. »Die beiden sind Rockstars, die sich mögen.« Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Präsident Donald Trump seien große Führer, die viel erreichen können, erklärte der Mann, der im Geflecht der US-Außenpolitik weit mehr ist als nur Botschafter in Ankara. Barrack, langjähriger Unterstützer von Trumps Wahlkämpfen und selbst Investor, hat heute die Aufgabe, die einerseits engen, zugleich aber spannungsreichen Beziehungen zum türkischen Präsidenten zu stabilisieren und das strategische Verhältnis zwischen Washington und Ankara neu zu ordnen. Die Lobreden im Vorfeld des US-türkischen Gipfeltreffens kamen von einem Mann, der wie kaum ein anderer das Vertrauen Donald Trumps genießt und als dessen Sondergesandter für Syrien mitunter gar als »inoffizieller Außenminister« für den Nahen Osten bezeichnet wird.
Nach dem mehr als zweistündigen Tête-à-Tête zwischen Trump und Erdoğan zeigte sich der zum Diplomaten avancierte Unternehmer euphorisch. »More than great«, als »besser als großartig«, sei das Treffen verlaufen, erklärte er vor der Presse. An pompösen Worten mangelte es nicht. Trump überschüttete seinen Gast mit schmeichelhaften Formulierungen. Für Erdoğan war der Besuch im Weißen Haus seit jeher ein Herzensanliegen – unter Präsident Joe Biden blieb ihm dieser verwehrt. Der glanzvolle Empfang durch Trump symbolisiert daher auch außenpolitisch eine Kehrtwende.
Bis zu ihrer Schließung 1971 war das Institut in der Nähe von Istanbul die zentrale Ausbildungsstätte des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel
Dass Termine im Oval Office eine Eigendynamik entwickeln können, hat die Weltöffentlichkeit in den vergangenen Monaten mehrfach erlebt. Bei Erdoğan sollte es nicht anders sein: Trump empfing seinen türkischen Kollegen ungewöhnlich herzlich, stellenweise gar kumpelhaft. »Er ist ein hochgeachteter Mann. In seinem Land und in ganz Europa genießt er großes Ansehen. Es ist eine Ehre, ihn im Weißen Haus zu empfangen«, sagte Trump im Kreis ausgewählter Journalisten. Zum Lobgesang passte indes wenig der Hinweis, man kenne sich ja schon lange, die Beziehung habe selbst die Jahre seines Exils nach den »gefälschten« US-Wahlen von 2020 überdauert – verbunden mit der Bemerkung an Erdoğan: »Sie wissen, er kennt sich mit gefälschten Wahlen besser aus als jeder andere.«
Wer gehofft hatte, der Seitenhieb münde in eine Mahnung zu demokratischen Grundsätzen angesichts von Erdoğans zunehmend autoritärem Regierungsstil, wurde enttäuscht. Das Abdriften der Türkei in den Autoritarismus war kein Thema und ist – offenkundig – der aktuellen Administration keine Silbe wert.
Abgesehen von dieser Szene, die Erdoğan stoisch hinnahm, stand das Treffen unter dem erklärten Ziel, die bilateralen Beziehungen zu verbessern. »Wir sind in der Lage, die Beziehungen zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten auf ein neues Niveau zu heben«, sagte Erdoğan öffentlich. Sodann erwähnte er die Kürzel F-35 und F-16 sowie – etwas überraschend – die »Schule von Heybeliada«, besser bekannt als die Theologische Schule von Chalki. Bis zu ihrer Schließung 1971 war das Institut in der Nähe von Istanbul die zentrale Ausbildungsstätte des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel – und seither ein Dauerkonfliktpunkt im griechisch-türkischen Verhältnis sowie Gegenstand internationaler Kampagnen, nicht zuletzt der einflussreichen griechischen Lobby in den USA.
Mit überparteilicher Konsequenz verlangen die Amerikaner die Aussonderung der S 400, bevor eine Rückkehr der Türken in das F-35 Programm denkbar ist
Erdoğan dürfte geahnt haben, dass Trump das Kirchen-Thema ansprechen würde, und kam ihm zuvor: Er werde sich der Sache persönlich annehmen und Patriarch Bartholomaios treffen, erklärte er. Dieser war bereits zuvor im Weißen Haus empfangen worden und hatte Trump um Unterstützung gebeten. Für das Ökumenische Patriarchat ist die Wiedereröffnung der Schule eine existentielle Frage. Dass Trump sich des Themas annimmt, verweist einerseits auf seine Affinität zu religiösen Fragen, andererseits auf den Einfluss der griechisch-amerikanischen Lobby.
Im Zentrum der Gespräche standen jedoch Rüstung und Energie. Erdoğan drängt auf die Modernisierung seiner veralteten Luftwaffe. Während die Beschaffung weiterer Kampfflugzeuge vom Typ F-16 im Prinzip bereits von der Biden-Administration als Gegenleistung für Ankaras Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens genehmigt worden war, bleibt das F-35-Programm ein neuralgischer Punkt. Diese Flieger gelten momentan als die technologisch führenden Mehrzweckkampfflugzeuge, die aus den Arsenalen vieler NATO-Luftwaffen und mit den USA befreundeter Staaten nicht wegzudenken sind.
Ankara war ursprünglich Partner der ersten Stunde im F-35 Programm, geplant war die Lieferung von bis zu 100 Exemplaren des Flugzeugs für die türkische Luftwaffe, wobei türkische Firmen stark in die entsprechende Lieferkette eingebunden waren. Erdoğans Entscheidung, das russische Raketenabwehrsystem S 400 zu beschaffen, führte dazu, dass die Amerikaner die Türken kurzerhand aus dem F-35 Programm ausschlossen. Wie kein anderes Thema verhindern die russischen Raketen seither eine Normalisierung der rüstungspolitischen Kooperation zwischen Washington und Ankara. Mit überparteilicher Konsequenz verlangen die Amerikaner die Aussonderung der S 400, bevor eine Rückkehr der Türken in das F-35 Programm denkbar ist.
Turkish Airlines kündigte den Kauf von 75 Boeing-Flugzeugen an – 50 Festbestellungen und 25 Optionen
Präsident Trump hat nun gegenüber Erdoğan Gesprächsbereitschaft signalisiert. »Ich werde dafür sorgen, dass wir ihm das geben. Er braucht gewissen Dinge und wir benötigen gewisse Dinge«, formulierte Trump in der für ihn typischen Unbestimmtheit das Interesse an einem Deal. Doch bei Waffengeschäften mit dem Ausland ist der US-Präsident auf die Zustimmung des Kongresses angewiesen. Und dort sammelt sich bereits die kampferprobte Koalition der Pro-Griechenland- und Pro-Israel-Kräfte, um das Geschäft mit der Türkei zu blockieren. Mit einem schnellen Durchbruch ist somit nicht zu rechnen, auch der eingangs erwähnte Tom Barrack räumte ein, in Washington gebe es keine schnellen Lösungen.
Um Trump bei Laune zu halten, war Erdoğan nicht mit leeren Händen nach Washington gereist. Am Tag, an dem Donald Trump dem Gast aus der Türkei den Hof machte, wurde der Abschluss von milliardenschweren bilateralen Abkommen bekanntgegeben. Turkish Airlines kündigte den Kauf von 75 Boeing-Flugzeugen an – 50 Festbestellungen und 25 Optionen für die Langstreckenmodelle B787-9 und B787-10. Insgesamt wurde eine Vereinbarung über bis zu 150 Maschinen erzielt.
Darüber hinaus unterzeichneten Washington und Ankara ein »Memorandum über strategische Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Nuklearenergie«. »Wir haben einen neuen Prozess gestartet, der die langjährige und vielschichtige Zusammenarbeit zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten im Bereich der Kernenergie weiter vertiefen soll«, erklärte Energieminister Alparslan Bayraktar.
Er kenne Erdoğans Position nicht, er könne hierzu nichts sagen, stellte sich Donald Trump dumm, als ein Reporter ihn auf das Gaza-Thema ansprach
Bei dem zivilen Nukleardeal soll es nicht bleiben. Als Gegenleistung gleichsam für eine Neuorientierung der Beziehungen inklusive der von Ankara angepeilten Waffenkäufe, fordert Donald Trump nicht mehr und nicht weniger als eine energiepolitische Abkoppelung der Türkei von Russland. »Ich will, dass er aufhört, Öl von Russland zu kaufen, solange Russland diesen Amoklauf gegen die Ukraine fortführt«, sagte Trump im Oval Office. Nach offiziellen Angaben kamen 2024 66 Prozent der türkischen Ölimporte aus Russland, bei Gas waren es 41 Prozent. Diese Zahlen belegen die Abhängigkeiten und Verflechtungen der russischen und türkischen Energiemärkte, denen Trump nun zu Leibe rücken will. Die kolportierte Vereinbarung über eine 20-jährige Lieferung von US-Flüssiggas im Wert von 43 Milliarden US-Dollar dürfte diese Abhängigkeit kaum verringern. In der Türkei wächst bereits die Sorge vor steigenden Heizkosten, wie griechische Korrespondenten berichten.
Dass das amerikanisch-türkische Gipfeltreffen ohne Eklat über die Bühne gegangen ist, ja verschiedentlich gar das Attribut »historisch« zu hören ist, liegt in großen Teilen auch daran, dass die bekannten Streitfragen nicht öffentlich ausgetragen wurden. Denn Washington und Ankara liegen in mehr als einer Frage über Kreuz. In der Bewertung des Krieges in und um Gaza könnten die Differenzen kaum größer sein. Er kenne Erdoğans Position nicht, er könne hierzu nichts sagen, stellte sich Donald Trump dumm, als ein Reporter ihn auf das Gaza-Thema ansprach. Und auch Erdoğan sorgte dafür, dass die Reizthemen Gaza und Hamas die Partystimmung nicht verderben.
Im Pressegespräch mit den mitgereisten türkischen Journalisten im Flugzeug des Präsidenten, bei dem standesgemäß die wichtigsten Fragen zur Sprache kommen, fehlte jeder Verweis auf Israel und die Lage im Kriegsgebiet. Anstelle einer realistischen Bestandsaufnahme übte sich Erdoğan in politisch-diplomatischer Schönfärberei: Die Beziehungen zu den USA entwickelten sich »auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts«. Natürlich, so räumte Erdoğan ein, lassen sich nicht alle Fragen »in einem Treffen« lösen. Doch die Gespräche hätten ermöglicht, »in vielen Punkten substanziell voranzukommen«. Im Moment hat es den Anschein, allein Erdoğan ist in gutem Glauben in Vorleistung getreten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob der glanzvolle Besuch im Weißen Haus und die warmen Worte des Gastgebers das Geld wert sind, das die Türken dafür investiert haben.
Dr. Ronald Meinardus ist Senior Research Fellow bei der Hellenischen Stiftung für Europäische und Auswärtige Politik (ELIAMEP) in Athen.