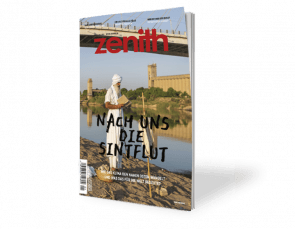Meeresschützer Hamdan Chowdhury über den Anstieg des Indischen Ozeans, die Bewahrung der Fischgründe und seine Liebe zu Haien.
zenith: Hamdan Chowdhury, Ihre Heimat Bangladesch ist eines der am schwersten von den Folgen des Klimawandels betroffenen Länder, wenn man sich anschaut, wie dicht das Land besiedelt ist und wie niedrig es liegt. Nun hat Ihre Regierung Schutzgebiete ausgerufen und Fangverbote erteilt.
Hamdan Chowdhury: Der Ansatz von Bangladesch beim Kampf gegen den Klimawandel mag vielleicht ein bisschen radikaler erscheinen als in anderen Ländern. Das liegt daran, dass wir die Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommen.
Bangladesch hat bisher nicht den Eindruck eines Vorkämpfers in Sachen Klima- und Umweltpolitik gemacht. Im Westen ist doch das Klischee sehr weit verbreitet, dass man es sich leisten können muss, über solche Dinge nachzudenken.
Außerhalb der industrialisierten Welt muss man kreativer und einfallsreicher sein. Denn Geld, also die Finanzierung für Maßnahmen, ist immer ein Problem. Aber es fehlt auch an politischer Planung über staatliche Institutionen insgesamt. Bangladesch ist ein sehr junger Staat, es gibt uns ja erst seit 1971. Das alles steht uns im Weg – aber gerade deshalb ist man vielleicht auch zu radikaleren Schritten fähig.
Die besonders den Fischfang betreffen.
Die Fischer in Bangladesch führten bis vor gar nicht langer Zeit ein gutes Leben, denn sie konnten täglich genug auf den Tisch bringen, um ihre Familien zu ernähren. Heute ist das nicht mehr so und wenn bei einer Bevölkerung von 160 Millionen selbst diejenigen nicht mehr genug zu essen haben, die für die Nahrungsmittelversorgung zuständig sind, haben wir ein Problem.
Weil das Land von der Fischerei abhängig ist?
Eine traditionelle Mahlzeit in Bangladesch besteht aus Reis mit Linsen und Fisch. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber ich denke, ein Großteil der Bevölkerung ist auf Fisch angewiesen. Der bengalische Nationalfisch heißt Hilsa – ein Fisch aus der Familie der Heringe. Dessen Fanggründe wurden nahezu leergefischt. Man musste also Fangverbote verhängen.
An die sich die Fischer hielten?
Meine Erfahrung ist, dass besonders die ärmsten Fischer diese Maßnahmen sofort verstanden und größtenteils umgesetzt haben. Sie erzählten uns: Wir verstehen, dass wir die Fischerei langfristig ganz vergessen können, wenn wir so weitermachen wie bisher. Sie haben die befristeten Verbote akzeptiert. Und manchmal reicht schon ein Monat, damit die Bestände sich erholen.
Nur ein Monat?
Man muss pragmatisch sein. Mehr geht eben auch nicht, denn die Menschen sind von der Fischerei ja abhängig. Es geht darum, eine halbwegs akzeptable Balance zu finden: zwischen Umwelt- und Klimafaktoren, Ernährung und wirtschaftlichen Aspekten. Aber ohne Konsequenzen und Einbußen geht es nun mal nicht. Deshalb sind wir in Bangladesch auch genervt, wenn man uns anderswo erzählt: Wir müssen den CO-Ausstoß verringern, aber dürfen niemanden vergrätzen.
Warum trifft das besonders ein Land wie Bangladesch?
Weil die Emissionsfrage hier ein Riesenthema ist, aber eben auch nicht alle Probleme abdeckt. Unser Land hat sich bei der Initiative für einen globalen Notfallplan an die Spitze gesetzt und 2009 eine Gruppe mitbegründet, die sich »Climate Vulnerable Forum« nennt und in der Premierministerin Sheikh Hasina eine führende Rolle spielt. Staaten wie die Malediven und Bangladesch waren deshalb federführend, weil bei uns der Klimawandel katastrophale und bereits sichtbare Folgen zeitigt. Für die industrialisierte Welt erscheint die Problematik oft abstrakt: Man sagt, wenn wir so weitermachen, haben wir 2050 alle Ressourcen des Globus verbraucht. Wir sagen: Schön, aber 2050 stehen wir hier schon unter Wasser.
Welche anderen konkreten Folgen sind zu erwarten?
Die Nahrungsmittelknappheit wird sich verschärfen, viele Menschen werden aus den Küstengebieten nach Norden wandern. Der Ozean rückt näher, wird aber weniger nutzbar. Je höher der Meeresspiegel, desto mehr versalzen die bislang noch fruchtbaren Böden. All das wird politische Konflikte weiter anheizen. Deshalb reden wir von einem »planetarischen Notfall«. Aber wir erzielen auch Erfolge.
Zum Beispiel?
Wir waren sehr stolz, als Leonardo di Caprio im Januar öffentlich die Bemühungen Bangladeschs lobte: Wir hatten gerade unser einziges Korallenriff zum Schutzgebiet erklärt. Bei Forschungsarbeiten sind wir dann auch auf andere artenreiche Gebiete gestoßen, die zum Glück noch nicht von der Fischerei erschlossen und ausgebeutet wurden. Dieses Gebiet im Golf von Bengalen trägt den kuriosen Namen »Der Flecken ohne Boden« und gehört zu den tiefsten Unterwasser-Canyons im Indischen Ozean – bis zu 1.340 Meter tief. Und es ist nun ebenfalls Schutzzone – eine wahre Autobahn der Tierwelt in der Tiefsee: Verschiedene Arten von Walen, Delfinen und Haien ziehen hier durch, weil die Strömung viel Nahrung nach oben spült. Hier findet sich etwa eine der größten stabilen Populationen des Blauflossenthunfischs.
Der weltweit als Delikatesse begehrt ist.
Bangladesch versucht nun einen Weg zu finden, daraus Nutzen zu ziehen, aber zugleich die Bestände nachhaltig zu schützen. Unsere heimische Fischerei stellt kaum eine Gefahr dar. Die kleinen Boote reichen mit ihren Netzen gar nicht so weit in die Tiefe. Aber leider sind da noch die die großen Trawler…
… chinesische Industriefischer.
Ja. Leider profitieren andere von den Erkenntnissen unserer Forschung und halten sich nicht an die Regeln.
Gibt es keine rechtlichen Mittel, um das Gebiet vor maritimer Wilderei zu schützen?
Rechtlich ja, praktisch nein. Es fehlen die Mittel, die Schutzgebiete zu überwachen und Patrouillen zu schicken, um dem illegalen Fischfang Einhalt zu gebieten. Und manche Fangfirmen kaufen Lizenzen, die die Regierung an Bangladeschs einheimische Fischer ausgegeben hat. Denn die sind eigentlich die einzigen, die in Gewässern vor unserer Küste auf Fischfang gehen dürfen. Aber die Lizenzen werden eben mitunter von Ausländern genutzt.
Was lässt sich dagegen unternehmen?
Eine Reihe von Aktivisten und Geschäftsleuten haben solche Lizenzen erworben und sorgen dafür, dass sie entweder gar nicht oder nachhaltig genutzt werden. Ich bin einer davon. Ich weiß, dass es ausländische Firmen gibt, die hohe Summen dafür bieten. Aber wir sind privilegiert genug, um zu sagen: Nein, uns ist der Schutz der Meere wichtiger. In Bangladesch operieren im Übrigen auch NGOs, die mit den Fischern arbeiten und zum Beispiel Wissen über Artenschutz und nachhaltige, umweltverträgliche Fischerei vermitteln. Die Zivilgesellschaft nimmt der Regierung hier viel ab.
Staaten wie Costa Rica sind durch das Flossenabschneiden bedrohter Hai-Arten in die Kritik gekommen – geliefert wird nach Asien. Begegnet Ihnen diese Praxis auch in Bangladesch?
Leider ja, es gibt immer wieder Berichte über die Verarbeitung von Haien an der Küste. Wenn den Fischern stabile Einkünfte fehlen, greifen sie darauf zurück. Haifang ist in Bangladesch eigentlich unüblich. Getrocknete Haiflossen werden zwar ähnlich wie Beef Jerky produziert und konsumiert. Aber im Wesentlichen sind es ausländische Industrien, die die Jagd auf Haie antreiben. Gesetzlich dürfen Haiflossen bestimmter Arten zwar nicht exportiert werden, aber sie werden dann eben umdeklariert – dann steht dort als Herkunftsland Myanmar. Bei Kontrollen hat man sogar Flossen einer Art gefunden, die so selten ist, dass sie noch kaum erforscht wurde. Der Ganges-Hai.
Im Ganges gibt es Haie?
Es handelt sich um einen Verwandten des Bullenhais. Die Art wurde vor etwa 60 Jahren zum ersten Mal identifiziert, doch sie ist kaum dokumentiert. Überhaupt gibt es noch so viel zu entdecken. Viele der faszinierenden Unterwasserwelten hier sind schwer zugänglich – nur die Schiffe der Marine können in solche Tiefen vorstoßen. Bangladesch hat einen sehr hohen Anteil an Smartphone-Nutzern und das kommt uns auch in der Kommunikation mit den Fischern zugute. Wenn die User etwas sehen, laden sie es in den Sozialen Medien hoch oder kommunizieren mit uns über WhatsApp. Sie sehen eine Flosse, schicken das Bild und wir können etwa eindeutig sagen: Das ist ein Orca.
Welches Erlebnis unter Wasser ist Ihnen als Taucher in letzter Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
Vor einigen Monaten bin ich vor unserer Küste an einer Stelle tauchen gewesen, die wir als Gebärstation von Tigerhaien kennen. Tigerhaie sind meine Lieblinge, obwohl ich auch Hammerhaie gerne mag. Vielleicht sind sie meine Seelenverwandten: Ich habe Exemplare getroffen, die sehr entspannt waren, andere, die sich aufführten und wieder andere, denen man besser aus dem Weg geht. Aber zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Über Jahre wurde diese Gegend so stark überfischt, dass davon nichts mehr übrig zu sein schien. Aber dann sah ich einen kleinen Tigerhai auf mich zuschwimmen – das erfüllte mich mit Glück. Später traf ich Fischer, die mir sagten: Die Regierung will nicht, dass wir hier fischen, also lassen wir es. Wir wollen nicht alles zerstören. Und dann zeigten sie nach draußen Richtung Horizont, auf die industriellen Fischtrawler ausländischer Firmen und sagten: Vielleicht solltet Ihr das denen mal erklären. Das ist natürlich traurig, aber es hat mir auch gezeigt: Diese Menschen verstehen das Problem und sorgen sich darum, dass es gelöst wird.
Hamdan Chowdhury wuchs in Bangladesch als Sohn einer bekannten Politikerdynastie auf. Er studierte Management und Politikwissenschaft an der Universität Toronto und belegte Kurse über die Biologie der Haie an der Georgetown University. Als freiwilliger Helfer nahm er an zahlreichen Meeresschutzprojekten teil, etwa dem »Shark Lab« auf Bimini (Bahamas). Chowdhury schloss sich dem Unterwasserfilmer-Kollektiv BEHIND THE MASK um den deutschen Filmemacher Florian Fischer an und begleitete diesen auf zahlreiche Expeditionen. Derzeit berät Chowdhury Projekte zum Schutz des Ozeans in Bangladesch sowie das bengalische Umweltministerium.