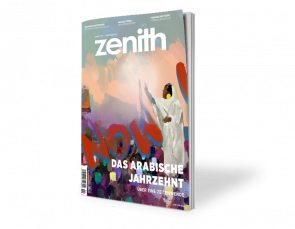Alawiten leben nicht nur in Syrien, sondern auch im Libanon. Im armen Grenzland von Akkar spüren sie besonders stark die Folgen von Krisen, Sanktionen und Weltpolitik.
Im Granatenbeschuss zwischen zwei Stadtvierteln verpuffte Hassan Bechlawis Hoffnung auf eine akademische Zukunft. »Du bist Alawit, wir werden auf dich schießen!«, drohten ihm Kommilitonen. 2012 war das, Bechlawi war 18 Jahre alt und hatte gerade sein Studium an der staatlichen Libanesischen Universität in der Hafenstadt Tripoli begonnen. Aus Angst vor den Drohungen brach er es ab – zumindest vorerst.
Schätzungsweise 120.000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Alawiten leben im Libanon, viele von ihnen fühlen sich Syrien verbunden. Der Krieg im Nachbarland prägt ihr Leben, ebenso wie die Wirtschaftskrise im Libanon und seit dem Frühjahr auch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.
Die meisten Alawiten im Libanon leben in dem hügeligen Landstrich von Akkar, der sich hinter Tripoli nach Norden ausbreitet. Ihr traditionelles Herkunftsgebiet ist das syrische Küstengebirge, der Stammsitz der syrischen Präsidentenfamilie Al-Assad, die selbst der alawitischen Glaubensgemeinschaft angehört. Entlang der Schotterstraßen in Akkar entfaltet sich ein für den Libanon ungewöhnliches Straßenbild. Wo sonst die politischen Führer des Landes wie Hizbullah-Generalsekretär Hassan Nasrallah oder der christliche Präsident Michel Aoun von Plakaten an Hauswänden herabblicken, hängen in Akkar lebensgroße Poster von Baschar Al-Assad.
So auch an einem Betonhaus in Massoudieh, einem verschlafenen alawitischen Dorf, nur wenige Kilometer vom libanesisch-syrischen Grenzzaun entfernt. An der Wand hängen zwei verblichene Portraitsdes syrischen Präsidenten. Vor ungefähr zehn Jahren hat Zahia Farahat die Poster an ihrer Hauswand befestigt. Die 46-Jährige lebt in ärmlichen Verhältnissen und kann weder lesen noch schreiben. Aufgrund der anhaltenden Wirtschaftskrise im Libanon ist sie auf die Unterstützung ihrer drei Schwestern angewiesen. Eine der Schwestern ist Farah.
Die Schwestern reden bereitwillig über ihre Sorgen, ihren richtigen Namen wollen sie aber lieber nicht in einer Zeitschrift sehen. Farah ist 40 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Ihr Mann arbeitet als Zeitarbeiter in der Landwirtschaft und verdient rund 10.000 libanesische Pfund am Tag – umgerechnet circa zwei Euro. »Ich kann meine Kinder kaum ernähren«, klagt Farah.
Die steigenden Preise im Libanon beunruhigen die Frauen. »Für den libanesischen Staat zählen wir nicht!«, wirft Zahia der Regierung vor. Die Explosion im Hafen Beiruts sehen die Schwestern als Bestätigung der Geringschätzung der Bevölkerung durch die Mächtigen: »Das libanesische Volk ist tot – die Menschen haben keine Chance, wieder ins Leben zurückzukehren.« Die Schwestern bewundern den Präsidenten des Nachbarlandes. Ihrer Meinung nach kümmert sich Assad um sein Volk – und er ist Alawit.
Regelmäßig sind sie früher gemeinsam über die Grenze gefahren, um in Syrien günstige Lebensmittel und Medikamente einzukaufen. Doch seit einigen Monaten ist das nicht mehr möglich. Aufgrund der Corona-Krise ist die Grenze geschlossen. Auch der Caesar Act, durch den Mitte 2020 schärfere US-Sanktionen gegen die syrische Regierung und Präsident Assad in Kraft getreten sind, haben die Geschäfte mit dem Nachbarn schwer beeinträchtigt, sagen die Farahats. Mehr Hunger, mehr Armut seien die Folge.
In einem Mehrfamilienhaus ein paar Straßen weiter wiegt Saly Hayder Yousef ein Kind in ihrem Arm. Es ist das jüngste von insgesamt drei Kindern. Obwohl ihr Mann beim Militär arbeitet, fühlt sie sich während der Wirtschaftskrise vom libanesischen Staat im Stich gelassen. An der Wand des Wohnzimmers hängt ein Bild des alawitischen Freiheitskämpfers Salih Al-Ali, der sich gegen die französische Besatzung in Syrien aufgelehnt hatte. Wie viele ihrer Freundinnen sehnt sich die 33-Jährige nach dem Diktator im Nachbarland, von einem starken Führer spricht sie, obwohl sie weiß, dass Syrien in Trümmern liegt und noch lange ein zerstörtes Land bleiben wird.
Manche Alawiten sehnen sich nach einem eigenen Staat, wie er von 1920 bis 1936 unter französischem Mandat an der Küste Syriens existiert hatte, bevor er 1937 in die Syrische Republik eingegliedert wurde. Dieser Traum, verbunden mit der Sehnsucht nach einem besseren Leben, ist anscheinend für viele Alawiten heute größer denn je. Als Hafiz Al-Assad 1970 die Macht in Syrien ergriff und viele Alawiten in Schlüsselpositionen seiner Diktatur einsetzte, wertete er die gesellschaftliche Stellung der Angehörigen der Religionsgemeinschaft auf. Zahlreiche Armeekommandeure und Chefs der diversen Geheimdienste sind Alawiten, vielfach aus Assads Heimatregion Latakia, eine Autostunde von der Grenze entfernt.
Diese Entwicklung hatte jedoch auch negative Folgen für die Alawiten – das Verhältnis zu den anderen Religionsgemeinschaften verschlechterte sich. Als die Proteste 2011 in Syrien begannen, setzte Baschar Al-Assad vor allem alawitische Kräfte zur Niederschlagung der anfänglich gewaltlosen Proteste ein. Im Verlauf der Kriegsjahre und mit wachsendem Widerstand der Sunniten wuchs auch die Angst vor Vergeltung für die jahrzehntelange Diskriminierung durch die alawitisch dominierte Führung.
»Für die Alawiten ist der Krieg in Syrien existenzgefährdend«, analysiert der Syrien-Experte Fabrice Balanche, Forschungsdirektor an der Universität von Lyon. Im staatlichen Sektor und auch in Kernbereichen der Wirtschaft seien die Alawiten bevorzugt worden. Die zunehmende Konfessionalisierung des Krieges machte die Alawiten zudem zu »Geiseln des syrischen Regimes«, so der Wissenschaftler. Diese Situation wirke sich auch auf die Lage der Alawiten im Libanon aus. Als sich Tripoli zum Nebenkriegsschauplatz Syriens entwickelte, rüsteten beide Seiten auf. Um sich gegen die Sunniten zu schützen, hätten sich die libanesischen Alawiten »mit Hilfe des großen Bruders Syrien« militärisch organisiert.
Die Straßen in den Dörfern von Akkar sind vielerorts heruntergekommen. Der Putz bröselt langsam von den Steinfassaden. In den Gassen spielen Kinder. In einem abgelegenen Haus in Massoudieh lebt der Versicherungsmakler Taha Zaytoun. Als Alawit, sagt er, werde er im Libanon aufgrund seiner konfessionellen Zugehörigkeit teilweise diskriminiert. Aber das sei normal, wenn man einer Minderheit angehöre.
Er bezeichnet sich als libanesischen Patrioten. Die wirtschaftliche Lage zwinge ihn aber dazu, regelmäßig nach Syrien zu fahren, um dort günstig einzukaufen. »Wir sind alle Teil eines großen Syriens, da kommen wir her. Aber wir leben im Libanon.«
Von Massoudieh ist es nicht mehr weit bis zur Grenze, es geht bergauf, an beiden Seiten des Weges reihen sich Gewächshäuser und Äcker dicht aneinander. Auf den Feldern in Sichtweite zum Grenzzaun arbeiten kleine Jungen und Mädchen, die Kinder syrischer Flüchtlinge. Sie sind oft die einzigen in der Familie, die etwas Geld verdienen. Am Straßenrand werden Obst und Gemüse verkauft. Landwirtschaft sichert das Grundeinkommen des überwiegenden Teils der hiesigen Bevölkerung.
»Der Staat kümmert sich nicht um uns. Wir sind Fremde im eigenen Land!« Abdullah Darwish steht am Fenster seines verschlafenen Kiosks, in Sichtweite der Grenze. »Direkt hinter dem Baum, da ist Syrien. Früher konnten wir einfach rüber gehen und mit den Nachbarn handeln und Waren tauschen. Heute geht das nicht mehr.« Er setzt sich auf das Sofa, auf dem er vor wenigen Minuten noch geschlafen hat. »Die Situation im Libanon ist schlecht. Aber in Akkar ist sie furchtbar.«
Akkar gilt als eine der ärmsten Regionen des Landes. Darwish ist Alawit, 64 Jahre alt und Mukhtar, eine Art Bürgermeister, in dem sunnitisch-alawitischen Dorf Semmaqiyeh. Etwa ein Drittel der Dorfbewohner seien Sunniten, gegenüber zwei Dritteln Alawiten, schätzt der Mukhtar. Er betont, dass sie hier friedlich miteinander leben.
Das Amt des Mukhtars hat er vor 22 Jahren von seinem Vater übernommen. Die Gemeinde hat zugestimmt. Der Mukhtar wird nicht vom Staat bezahlt, daher betreibt Darwish den Kiosk, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Vor dem Krieg kamen zahlreiche Syrer nach Akkar, um als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft zu arbeiten. Libanesen fuhren wiederum nach Syrien, um dort ihre täglichen Einkäufe zu tätigen oder sich medizinisch behandeln zu lassen.
Darwish fühlt sich eng verbunden mit den syrischen Nachbarn und steht damit nicht alleine da. Viele Menschen hier unterhalten engere Verbindungen in das syrische Latakia als in das nahegelegene Tripoli. Aufgrund der Corona-Krise kann Darwish die Grenze nach Syrien momentan nicht passieren. Mit seinen syrischen Freunden ist er jedoch über die sozialen Medien verbunden und erfährt, dass sie kostenlos die Schule besuchen und Medikamente erhalten könnten – dasselbe wünsche er sich auch für den Libanon.
Denn seit der Schließung der Grenze wird er immer wieder von Freunden um Geld gebeten. Das libanesische Gesundheitssystem können sich immer weniger Menschen im Land leisten. Die Wirtschaftskrise führt teilweise zu Engpässen in der medizinischen Versorgung, Medikamente fehlen und vielerorts streiken die Ärzte – die Katastrophe in Beirut verschärft die Lage weiter.
Bis in die 1990er Jahre wurden die Alawiten im Libanon nicht als religiöse Glaubensgemeinschaft anerkannt. Im konfessionellen Proporzsystem des Landes konnten Alawiten somit lange keine öffentlichen Ämter besetzen. Der Umschwung begann, nach dem sich in den 1970er Jahren alawitische Studenten zur »Jungen Alawitischen Bewegung« zusammenschlossen. Mit der Unterstützung von Rifaat Al-Assad, dem jüngeren Bruder von Hafiz Al-Assad, entwickelte sich die Organisation zur »Arabischen Demokratischen Partei« (ADP), den Vorsitz übernahm Ali Eid.
Mittlerweile stellen die Alawiten zwei Abgeordnete im libanesischen Parlament. Die ADP ist noch heute eine kleine politische Kraft im Libanon, den Parteivorsitz hat mittlerweile Rifaat Eid inne, der Sohn von Ali Eid.
Sein politischer Gegenspieler ist Khodr Habib. Von seinem Büro in Tripoli blickt er direkt auf das Meer, während auf zwei Bildschirmen die Nachrichten des Tages durchlaufen. Khodr Habib ist Alawit und Mitglied der Zukunfts-Bewegung, der Partei von Ex-Premierminister Saad Hariri. »Ali Eid hat die Alawiten in eine syrische Miliz im Libanon verwandelt. Das ist eine Katastrophe für die Menschen in Tripoli!« Habib spricht sich gegen den syrischen Einfluss aus, der während des Bürgerkriegs und noch Jahre danach im Libanon zu spüren war und seiner Ansicht nach auch heute noch bleibt.
Zwei Jahre lang, von 2012 bis 2014, tobte in Tripoli ein Nebenkrieg zwischen den Anwohnern in Bab Al-Tabbaneh, die Syriens Rebellen unterstützten, und den Anwohnern von Dschabal Mohsen, einem Viertel, in dem das syrische Regime noch Ansehen genießt. Die Auseinandersetzungen waren zugleich ein Stellvertreterkrieg: Das syrische Regime und die schiitische Hizbullah unterstützten die Alawiten, Saudi-Arabien und andere arabische Golfstaaten das sunnitische Lager. Rund 200 Menschen verloren während der Kämpfe ihr Leben, über 1.000 wurden verletzt.
Wer die treibenden Kräfte hinter den Auseinandersetzungen waren, offenbarte sich erst, als 2014 ein »Sicherheitsabkommen« zwischen Hariris Fraktion und der Hizbullah den Kämpfen ein rasches Ende bereitete. Danach nahm der junge Student Hassan Bechlawi sein Studium wieder auf. Inzwischen ist er Bankkaufmann und hat noch weitere Pläne. Er will mit seinem Bruder ein Café in Dschabal Mohsen eröffnen, dem vorwiegend von Alawiten bewohnten Stadtteil. Bechlawi bezeichnet sich selbst nicht als syriennah. Er ist im Libanon aufgewachsen und möchte »nirgendwo anders« leben.
»Wir wollen nicht mehr in Religionen denken. Wir sind Libanesen.« Seit dem Ausbruch der Proteste im Oktober 2019 geht auch er auf die Straße, um gegen Korruption, Misswirtschaft und Konfessionalismus zu demonstrieren. Hassan wünscht sich, wie viele junge Menschen im Libanon, einen säkularen Staat.
So wie eine Gruppe junger Männer in Halba, der Hauptstadt von Akkar. Dort steht ein Revolutionszelt, in dem sich die Demonstranten jeden Tag treffen. Für sie steht die Revolution auch während der Corona-Pandemie nicht still. Eine große libanesische Flagge schmückt das Zelt, in dem sich die jungen Männer über das weitere Vorgehen beratschlagen. Stolz erzählen sie von ihren Festnahmen und ihren Protestaufrufen über Whatsapp und Facebook.
Auf die Frage, ob in Akkar Angehörige aller Konfessionen auf die Straße gingen, antwortet der 30-jährige Ghayth Hammod: »Klar, ein Freund von mir ist Alawit, er demonstrierte auf den Straßen neben mir und neben Mitgliedern aller anderen Konfessionen.« Ghayth mag die Frage nach den Konfessionen nicht, über sich selbst sagt er nur, er sei Muslim: »Wir haben gemeinsam gegen das System protestiert, das uns alle, konfessionsübergreifend, ausnutzt und seine eigene Agenda verfolgt. Für uns spielt die Religionszugehörigkeit keine Rolle.« Für die Mehrheit der Alawiten, vor allem in den Dörfern, sprechen die jungen Männer aber vermutlich nicht.
Sina Schweikle ist freie Journalisten. Sie lebt und arbeitet in Beirut.