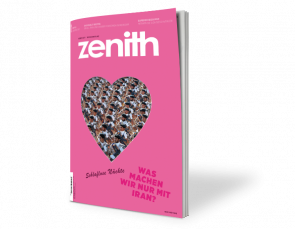Seit dem Olympia-Triumph der Taekwondoka Kimia Alizadeh Zenuzi wächst der Widerstand gegen die Diskriminierung von Frauen im Sport in Iran.
Der Triumph der Kimia Alizadeh Zenuzi ist nicht ohne Niederlagen zu verstehen. Nicht ohne ihre eigene. Und nicht ohne jene des stärksten Mannes in Iran. Nicht ohne die Niederlage Behdad Salimis.
Rio de Janeiro, die Sommerspiele der XXXI. Olympiade. Es ist der Abend des 12. Wettkampftages in Brasilien. Eine halbe Welt entfernt, am frühen Morgen des 17. August 2016, blickt ein Land von Teheran und Isfahan aus, von Maschhad, Khorramschahr und Taebris aus in eine 40 Jahre alte Messehalle eines Vororts von Rio, die, ihren frisch gestrichenen Wänden zum Trotz, dem brasilianischen Klima eher schlecht als recht standhält.
Riocentro 2, Gewichtheben, die Klasse über 105 Kilogramm, die stärksten Männer der Welt. Der stärkste von allen: Behdad Salimikordasiabi. Sein Sieg, seine Goldmedaille, eine Frage der Ehre. Eine Sache nationalen Stolzes. Der Mann aus Mazandaran, der Provinz zwischen den Bergen des Albors und den Ufern des Kaspischen Meers, der Provinz der starken Männer Irans, der Ringer und Gewichtheber, wird siegen. Behdad, der Stärkste von allen. Die iranischen Journalisten, die vor der Halle aus dem Bus steigen, sind guter Dinge. Der Wettkampf beginnt gut für Salimi. 216 Kilogramm im Reißen: Weltrekord. Die iranischen Fans jubeln, in Riocentro 2, daheim vor den Fernsehern. Doch es bleibt knapp. Die Armenier, die Georgier, die Goldmedaille. Auch eine Frage der Ehre für sie.
245 Kilo liegen auf für Behdad Salimi in der zweiten Disziplin, im zweiten Versuch. Er stemmt das Gewicht. Zwei von drei Kampfrichtern heben die weiße Fahne: gültig. Ungültig, entscheiden die Oberschiedsrichter der Jury. Der linke Arm, nicht durchgestreckt. Der Heber, seine Trainer, die Fans: außer sich. Auch der dritte Versuch scheitert. Die Trainer bestürmen die Jury, schreien, wittern eine Verschwörung zugunsten der Georgier, der Armenier. Das Security-Personal in der Halle ruft die Polizei. Gold und Bronze für Georgien, Silber für Armenien. Behdad Salimi weint. Binnen 24 Stunden wird der Instagram-Account des Internationalen Gewichtheberverbandes von 285.000 Kommentaren geflutet. »Gott verfluche Olympia«, heißt es unter anderem. Die Website des Verbands wird gehackt, auf der Homepage taucht ein Porträt auf. Es zeigt Behdad Salimikordasiabi.
Keine 48 Stunden später, vor der Halle Carioca 3 auf dem Olympia-Gelände. Drinnen läuft Taekwondo, die Kämpfe der Frauen in der Klasse bis 57 Kilogramm. Draußen läuft, 18 Jahre alt, Kimia Alizadeh Zenuzi aus Karadsch. Auf und ab. Mahru Komrani, ihre Trainerin, hält ihre Hand. Alizadeh ist aufgebracht, immer noch. Das Viertelfinale gegen die Spanierin Calvo Gomez ging soeben verloren, 7:8, aber die Iranerin war sich sicher: Betrug. Hatte sie nicht einen Treffer gelandet, in letzter Sekunde? Müsste sie nicht im Halbfinale stehen an Stelle der Spanierin? Schweigen zwischen Trainerin und Sportlerin, während sie in der Dämmerung von Rio auf und ablaufen. Betrug? Es ist keine Zeit für viele Worte. Es ist noch nicht vorbei.
Die olympischen Turniere bieten in den Kampfsportarten eine zweite Chance, die Möglichkeit, wenigstens eine Bronzemedaille zu erkämpfen. Kimia Alizadeh beruhigt sich, anders als Behdad Salimi zwei Tage zuvor. Erkennt die Chance. Erkämpft die Medaille. Drei Stunden später läuft sie mit der iranischen Fahne durch die Halle, hängt diese Medaille um ihren Hals. Kurz darauf halten fünf Hände diese Medaille, Kimia Alizadehs eigene und vier von Journalistinnen, die verfolgt haben, was da gerade passiert war. Eine Iranerin gewinnt eine Medaille bei Olympia – das gab es noch nie. Bis Kimia Alizadeh Zenuzi aus Karadsch, 18 Jahre alt, Bronze in Rio de Janeiro holt. »Diese Medaille«, sagt sie den Journalistinnen, die so offensichtlich stolz sind auf das, was die junge Frau geschafft hat, dass sie ihre Kollegen um dieses Gruppenbild mit Medaille bitten, »diese Medaille ist für alle iranischen Mädchen, ich möchte sie ihnen widmen. Und ich hoffe, dass mir viele Mädchen folgen werden.«
Karadsch, das ist jene Stadt westlich von Teheran, die dafür bekannt ist, für nichts bekannt zu sein außer den Stau auf der Autobahn dorthin, der die Teheraner auf ihrem Ausflug ans Kaspische Meer bremst. Zugleich ist Karadsch die am schnellsten wachsende Stadt in Iran, der Nähe zu Teheran wegen. Die Herkunft der jungen Frau, die in Rio de Janeiro iranische Sportgeschichte geschrieben hat, könnte kaum durchschnittlicher sein – im Kontext der gesellschaftlichen Umstände der Islamischen Republik ist das alles andere als unwesentlich.
In die Heimat kehrt Kimia Alizadeh als Heldin zurück. Sie wird am Flughafen vor der Toren Teherans begeistert empfangen, da hat Präsident Hassan Ruhani längst gratuliert, via Twitter. Über den Autobahnen in der Hauptstadt ist nicht das Gesicht Behdad Salimis zu sehen, sondern das von Kimia Alizadeh. Seht her, ist die Botschaft der Regierung Ruhani ans Volk, eine junge Frau hat sich durchgekämpft.
Neun Sportlerinnen waren Mitglieder der iranischen Olympiamannschaft, neun von 61. Eine von ihnen, die im Rollstuhl sitzende Bogenschützin Zahra Nemati, durfte die iranische Flagge bei der Eröffnungsfeier tragen. Doch Aufmerksamkeit in den Medien bedeutet kaum Geld zum Trainieren, das gilt überall auf der Welt, aber besonders für iranische Sportlerinnen. »Wenn man weiß, unter welchen Umständen die Frauen bei uns trainieren«, sagt ein iranischer Journalist nach Kimia Alizadehs Triumph, »wie viel weniger Geld sie bekommen, wie wenig die Funktionäre auf sie achten, dann ist diese Medaille dreimal so viel wert wie jedes Gold von einem Mann.« Der Wert dieser Bronzemedaille höher als mancher Olympiasieg der wie Helden verehrten Ringer und Gewichtheber? Vor allem andere Sportlerinnen haben begriffen, was in Rio geschehen ist.
Als im September 2016, drei Wochen nach Olympia, eine iranische Auswahl beim Berliner Frauen-Fussball-Festival »Discover Football« antritt, fällt schnell der Name Kimia Alizadeh. »Sie ist ein riesiges Vorbild, sie gibt uns Frauen eine Perspektive«, sagt die 22 Jahre alte Spielerin Tanin, die in Teheran als Personal-Trainerin in einem Fitnessclub arbeitet. Auch die Frauen, die sich seit Jahren, teils unter erheblichen persönlichen Risiken, für eine Aufhebung des Verbots des Besuchs von Spielen von Männermannschaften einsetzen, beim Fußball, Volleyball und Basketball, zitieren Kimia Alizadeh als Vorbild. »Das Thema Frauen und Sport ist voller Fallstricke«, sagt eine Teheranerin, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt in der Gruppe »Open Stadiums« für den Einlass zu Fußball und Volleyballländerspielen bemüht. »Oft fühlt man sich als Frau wie ein Anhängsel in unserer Gesellschaft. Kimia Alizadeh hat gezeigt, dass wir Weltspitze sein können. Sie hat uns Mut und Kraft gegeben.«
Irans Konservative müssen darum kämpfen, ihre ablehnende Sicht auf Sportlerinnen im Allgemeinen und deren öffentliche Auftritte im Besonderen weiter durchzudrücken
Es ist auch der Kampf um Anerkennung, das Training des eigenen Durchsetzungsvermögens, was Kampfsportarten in Iran, wie in vielen muslimischen Ländern, sehr beliebt macht. Neben Alizadeh stand in Rio die Ägypterin Hedaya Wahba als Bronzemedaillengewinnerin auf dem Siegerpodest, die im zweiten Kampf um Bronze die für Belgien startende Exil-Iranerin Raheleh Asemani besiegte. Olympiasiegerin Jade Jones aus Großbritannien sagte, auf die Frauen angesprochen, die während der Siegerehrung im Hidschab neben ihr standen: »Großartig. Taekwondo ist ein toller Sport für Mädchen. Es ist ein Sport, der dir Selbstvertrauen gibt, der dir Respekt verschafft.«
Doch auch die Konservativen haben längst begriffen, dass sie kämpfen müssen, wenn sie ihre grundsätzlich ablehnende Sicht auf Sportlerinnen im Allgemeinen und deren öffentliche Auftritte im Besonderen weiterhin durchdrücken wollen. Seit Alizadehs Medaillengewinn ist die Zahl der Einzelfallverbote eher gestiegen als gesunken. Eine 18 Jahre alte Schachspielerin wurde im Februar von der Weltmeisterschaft in Teheran ausgeschlossen, weil sie zuvor im Ausland ohne Hidschab gespielt hatte. Im Frühjahr 2017 wurde trotz vorheriger Zusage die Teilnahme von Frauen am Teheran-Marathon verboten. Die Läuferinnen sollten auf der Laufbahn im Azadi-Stadion ihre Runden drehen, nicht ins Zentrum laufen. Einige Läuferinnen verlegten ihren persönlichen Marathon daraufhin vor und joggten vor dem offiziellen Start der Männer in die Stadt. Andere Verbote wirken praktisch so durchsetzbar wie das Alkoholverbot im Land: Private Zumba-Kurse wird es weiterhin geben, auch wenn das Sport und Jugendministerium sie im Juni 2017 wegen angeblicher Unvereinbarkeit mit dem Islam verbot.
Und so bleibt das weithin bekannte, weil erkennbare Stadionverbot zentraler Streitpunkt in der Islamischen Republik. Die iranischen Sportverbände wissen, dass sie mit dem Ausschluss des jeweils anderen Geschlechts von den Tribünen die internationalen Regeln, allen voran die Charta des Internationalen Olympischen Komitees, verletzen. Ruhanis Regierung war das Problem in der ständigen Abwägung der Prioritäten nie wichtig genug, um die Konfrontation mit den Hardlinern und der geistlichen Führung in dieser Sache zu suchen.
Die internationalen Verbände mit geschäftlichen Interessen in Iran, allen voran der Internationale Volleyball-Verband FIVB, der seit 2016 mindestens zwei Turniere pro Jahr in Iran austrägt, lässt sich mit Versprechen und dem Besuch einiger Töchter, Frauen und Freundinnen von Spielern und Funktionären abspeisen, statt den freien Verkauf von Tickets durchzusetzen. Im Sommer 2017 aber stieg der Druck – dank Schützenhilfe der Fußballer.
Nachdem sich die iranische Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Folge für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte – was dem »Team Melli« zuvor nie gelungen war –, drängte Kapitän Masud Schojaei beim Empfang der Mannschaft durch Präsident Ruhani auf das Recht der Frauen zum Besuch der Spiele der Mannschaft. Ali Karimi, einst deutscher Meister mit dem FC Bayern München, schloss sich der Forderung an, Nationalspielerinnen machten via Instagram deutlich, dass es mit der Geschlechtersegregation in den Stadien ein Ende haben solle. Fixpunkt: das letzte, sportlich nicht mehr sonderlich relevante Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Syrien Anfang September in Teheran. Immer wieder vorgebrachtes Argument: Die schiitischen Geistlichen haben keinerlei Problem mit Besuchen weiblicher Fans bei den Fußballspielen irakischer Mannschaften, die in den letzten Jahren aus Sicherheitsgründen in Teheran stattfanden.
Die Social-Media-Abteilung des Iranischen Olympischen Komitees postet inzwischen mehrmals in der Woche Fotos und Videos von Sportlerinnen
Ohnehin sind die unterschiedlichen Initiativen, mit denen Sportlerinnen und Zuschauerinnen auf ihre Lage aufmerksam machen, vor allem dank Instagram, nicht blockiert, und Twitter, noch blockiert, untereinander vernetzt. Die Social-Media-Abteilung des Iranischen Olympischen Komitees postet inzwischen mehrmals in der Woche Fotos und Videos von Sportlerinnen – als digitale Motivationshilfe gewissermaßen. Dank des Internets ist das Engagement der Sportlerinnen längst nicht mehr auf die Hauptstadt beschränkt. Ende Juni verbreitete sich ein englisch untertiteltes Video aus der Heimat der starken Ringer und Gewichtheber.
»Mein Name ist Sahra Yazdani Tscharati. Ich bin 18 Jahre alt und lebe in Mazandaran«, erzählt eine junge Frau in Sportlerinnendress mit weißem Hidschab. »Mein Vater wollte mich zunächst vom Kuschti, vom Ringen, fernhalten. Aber jetzt sind mein Onkel und er meine größten Unterstützer. Sogar Reza Yazdani, mein Cousin, der Weltmeister ist, unterstützt mich und treibt mich an, obwohl er zunächst gar nicht so glücklich schien. Mein Bruder ist Zweiter der Junioren-WM, er trainiert mit mir. Wir haben nicht viele Trainingspartnerinnen und uns fehlen gute Trainerinnen. Also trainiere ich außerhalb der Halle mit meinem Vater. Kuschti stand uns so lange nicht offen – aber jetzt wollen wir gesehen werden!«
Die junge Ringerin schiebt in dem kurzen Video einen Peugeot rückwärts – Krafttraining in Mazandaran. Auch das ist symbolisch: Wenn es sein muss, wird rückwärts geschoben, um vorwärts zu kommen. Zur Hilfe kommt den Frauen dabei nicht nur das Internet, sondern auch die zunehmende Akzeptanz durch ihre Familien. Wenn eine Ringer-Dynastie wie die Yazdanis die Töchter auf der Matte kämpfen lässt, zeigt das deutlich: Die sozialen Normen haben sich verändert. Der Alizadeh-Effekt ist dabei nicht zu unterschätzen: Was ein Mädchen aus Karadsch schafft, mit sanfter Stimme, häufig schüchternem Blick und hartem Tritt, das kann jede schaffen. Und weil Familien und Freunde das akzeptieren, wirken die Konservativen mit ihrem Beharren auf alten und das Erschaffen neuer Verbote zunehmend in der Defensive.
m Juli 2017 gewann Kimi Alizadeh Zenuzi Silber bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft in Südkorea. Während der Wettkämpfe riss ihr das Kreuzband, statt eines Empfangs beim Präsidenten musste sie in diesem Sommer ins Krankenhaus, ausgerechnet an ihrem Geburtstag. Das jüngste Video zeigt ein Dutzend Frauen, angeführt von ihrer Trainerin, die am Krankenbett ein Geburtstagsständchen singen. Dazu gibt es Schokoladentorte. Doch trotz aller Freude, über Nacht ein Vorbild geworden zu sein – das große Ziel ist längst nicht erreicht. »Es tut mir leid, dass ich die Erwartungen der Iraner und meine eigenen enttäuscht habe«, hatte sie in Rio gesagt. Sie sprach leise, aber deutlich. »Diese Medaille ist für alle Mädchen in Iran. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal Gold gewinnen.«
Christoph Becker ist Sportredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).