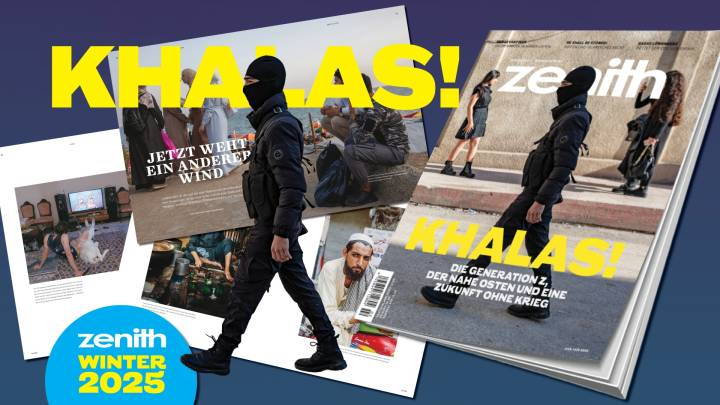Angesichts drängender Fragen des Wiederaufbaus stehen Übergangsjustiz und Aufarbeitung in Syrien derzeit nicht hoch im Kurs. Dennoch sind sie als Fundament für Staat und Gesellschaft der Post-Assad-Ära unerlässlich.
54 Tage nach der Flucht Assads aus Damaskus ereignet sich in Syrien erneut ein Umbruch, der über 54 Jahre als unerschütterlich geltende Selbstverständlichkeiten abermals ins Wanken bringt. Indem sich der einstige dschihadistische Kriegsherr und nun zum Staatsmann gewandelte Anführer der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir Al-Sham, Ahmed Al-Shar’a, in seiner Siegesrede am 29. Januar 2025 zum Übergangspräsidenten ausruft, bricht er nicht nur mit der tradierten Praxis, das syrische Präsidentenamt als dynastisches Erbe der Assad-Familie weiterzureichen, sondern tritt zugleich mit einer Vision für ein neues Syrien auf, die viele syrische Revolutionäre noch vor einem halben Jahr als unerreichbare Träumerei abgetan hätten.
Doch damit nicht genug: Al-Shar’a stellt die Opfer des Kampfes für ein freies Syrien in den Mittelpunkt seiner Rede und macht insbesondere den 2011 von Assads Sicherheitskräften zu Tode gefolterten Jungen Hamza Al-Khatib zur Integrationsfigur des Leidens, während er durch diese Symbolik eine Roadmap für die Erneuerung der geschundenen Nation entwirft. Sich als Diener der Bevölkerung und nicht als Herrscher präsentierend, kündigt er an, ein neues Kapitel in der syrischen Politik aufzuschlagen – eine Politik, die »echte Beteiligung aller syrischen Männer und Frauen im In- und Ausland, um ihre Zukunft in Freiheit und Würde aufzubauen, ohne Ausgrenzung und Marginalisierung« ermöglichen soll.
Obwohl er mit der Vision nicht korrupter Staatsinstitutionen, der Etablierung menschenwürdiger ökonomischer Lebensbedingungen sowie nicht zuletzt dem Versprechen freier und fairer Wahlen den zentralen Forderungen der syrischen Revolution Rechnung zu tragen versucht, fällt insbesondere seine Ankündigung in Bezug auf Übergangsjustiz nach 14 Jahren exorbitanter Gewalt besonders ins Gewicht. Den Opfern in dieser Rede eine solche Prominenz einzuräumen, diene laut Al-Shar’a dem übergeordneten Ziel, einen zivilen Frieden zu erlangen, indem jene zur Verantwortung gezogen werden, die »syrisches Blut vergossen und Verbrechen gegen uns begangen haben.«
Wer genau mit »uns« – also jenen, denen Gerechtigkeit widerfahren soll – und denen, die gerichtet werden, gemeint ist, bleibt unbestimmt, was eine Siegerjustiz vermuten lässt. Trotz der Zusicherung der neuen Machthaber, einen geordneten Übergang zu vollziehen, häufen sich in Latakia und rund um Homs Berichte über Selbstjustiz gegen ehemalige Regimeanhänger oder Personen mit alawitischem Identitätshintergrund.
Es gehört zur Wahrheit, dass die bewusst eingeschränkten oder möglicherweise tatsächlich unzureichenden Sicherheitskapazitäten der neuen Machthaber die Lage weiter destabilisieren
Auch wenn unbestreitbar bleibt, dass jede Information über sektaristische Gewalt in Syrien angesichts der Vielzahl kursierender Fake-News sorgfältig geprüft werden sollte, gehört es zur Wahrheit, dass die bewusst eingeschränkten oder möglicherweise tatsächlich unzureichenden Sicherheitskapazitäten der neuen Machthaber die Lage weiter destabilisieren. Die bittere Konsequenz ist, dass sich einige alawitische Individuen sowie Gemeinschaften nun jenen existenziellen Ängsten ausgesetzt fühlen, die Baschar Al-Assad stets als unausweichliche Folge seines Sturzes prophezeite.
Wenn Al-Shar’a sein Bekenntnis zur institutionellen Stabilität und zum Bruch mit der Vergangenheit ernst meint, muss er eine Übergangsjustiz schaffen, die das Bedürfnis nach Vergeltung befriedigt und zugleich einen Zustand des sozialen Friedens bewahrt. Dessen Vision einer heilenden Gesellschaft umzusetzen, hieße, über Siegerjustiz hinauszugehen. Übergangsjustiz müsste die Chance bieten, jenseits der offensichtlichen Verbrechen des Regimes einen Aufklärungsprozess zu initiieren, der dem syrischen Kollektiv eine generelle Auseinandersetzung mit der Dimension der Verantwortlichkeit in totalitären Lebensräumen ermöglicht.
Um den baathistischen Totalitarismus unter den Assads und insbesondere die brutale Gewaltherrschaft der letzten Jahre zu verstehen, reicht es nicht, nur den sichtbaren Zusammenbruch seiner Fassade zu betrachten. Vielmehr braucht es eine tiefere Einsicht in die Denkstrukturen und Mechanismen, die es ermöglichten, diese Herrschaft über Jahrzehnte hinweg zu stabilisieren und tief in der Gesellschaft zu verankern. Wie in allen totalitären Systemen beruhte der syrische Terror auf der Entmachtung individueller Selbstständigkeit und der Komplizenschaft einer atomisierten Gesellschaft. Daher ist der Erfolg des Oppositionsbündnisses nur ein kleiner Sieg in einer viel größeren Auseinandersetzung – einer, die nicht nur gegen die sichtbaren Vertreter des alten Regimes geführt werden muss, sondern gegen die tief verankerten Mechanismen von Angst, Opportunismus und eines aggressionsleitenden Opfermythos, die das System überhaupt erst ermöglicht haben.
Durch die gezielte staatliche Förderung verschwörungsideologischer Mentalitäten im politischen Diskurs und die bewusste Spaltung der Gesellschaft entlang sozialer und ethnischer Linien schuf das Regime kontinuierlich den Nährboden für eine Gewaltkultur, in der die eigene Opferrolle zur zentralen Legitimationsgrundlage für Gewalt wurde. Syriens Tyrannei fußt damit vor allem auf einer spezifischen Vorstellung von sozialer Realität, in der es bis zuletzt absolut normalisiert – ja sogar die soziale Mobilität gefördert hat –, die systematische Vernichtung politischer Gegner, die für die eigene Viktimisierung verantwortlich gemacht wurden, durch brutalste Methoden voranzutreiben. Damit diese Handlungslogik wirksam wurde, machte sich das Regime die Wahrheit zur Waffe des Machterhalts, indem es die Deutungshoheit über die Wahrnehmung der Menschen erlangte und eine verzerrte Wirklichkeitskonstruktion zum Fundament seines Unrechtsregimes machte.
Das Resultat war ein Zersetzungsregime, das durch ein kapillares Geheimdienstnetzwerk Verrat bis in die tiefsten Sphären der Privatheit trug
Gewalt legitimierte sich über Jahrzehnte durch eine autoritäre Erzählung, die gesellschaftliche Gruppen gegeneinander mobilisierte und den Staat als Schutzmacht inszenierte. Zentral war dabei die durch die Baath-Doktrin propagierte Vorstellung Syriens als Land im Kreuzfeuer imperialer Mächte und Opfer einer jüdisch-kolonialistischen Weltverschwörung. Obwohl der Baathismus vorgab, Syrien von kolonialer Gewalt zu befreien, blieb das Regime der von der französischen Kolonialherrschaft etablierten Teilen-und-Herrschen-Mentalität verhaftet.
Die baathistische Revolution hielt am Bild eines unbefriedbaren syrischen Kollektivs fest, das in einem andauernden Konflikt religiöser Identitäten gefangen war, und fundierte damit eine Erfahrungswelt, in der staatliche Disziplin als alternativlos und individuelle Ohnmacht als Normalität erschien. Während reale und imaginierte Machtkämpfe Feindbeziehungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen förderten, wurden Antagonismus und Misstrauen zur Tugend sozialer Interaktion erhoben. Diese Erkenntnis ist zentral, um zu verstehen, wie sich die Gewaltherrschaft reproduzieren konnte.
Wer in Syrien nach Schuld fragt, ist schnell dazu verleitet, diese in offensichtlichen Identitätskategorien zu verorten – etwa in der durch die Propaganda des Regimes postulierten Minderheitenherrschaft oder in der Selbstidentifikation der Assads als selbstermächtigtes Alawiten-Regime. Doch den baathistischen Totalitarismus und die Persistenz der Assad-Diktatur allein auf alawitische Dominanz abzuschieben, verkennt die größere Dynamik, die die Gesellschaft zur Selbstzerstörung trieb. Zwar spielten sektaristische Feindbilder – die scheinbar machtlose religiöse Vielfalt gegen einen monolithischen sunnitischen Fanatismus – eine zentrale Rolle in der Sozialisation zur Feindschaft, doch die Versicherheitlichung sozialer Verhältnisse reichte weiter. Ob Mann gegen Frau, Araber gegen Kurden, Stadt gegen Land oder soziale Klassen – der Baathismus mobilisierte identitäre Gegensätze, um die Gesellschaft trotz des offiziellen Bekenntnisses zur Einheit in ständiger Zerrissenheit zu halten.
Das Resultat war ein Zersetzungsregime, das durch ein kapillares Geheimdienstnetzwerk Verrat bis in die tiefsten Sphären der Privatheit trug. Dass »Wände Ohren« hatten, galt als unausgesprochenes Gesetz – selbst in den engsten Familienkreis. Jeder konnte durch den allgegenwärtigen Geheimdienst zum Komplizen gemacht worden sein. Sich im Lichte dieser Erkenntnis mit Schuld zu beschäftigen, bedeutet nicht nur, Verantwortung nicht einseitig einer Bevölkerungsgruppe zuzuschreiben, sondern auch zu verstehen, wie der Staat durch gezielte Erzählungen und Identitätszuschreibungen Menschen in Rollen innerhalb des Unrechtssystems drängte, in denen sie Gewaltbeziehungen legitimierten und reproduzierten. Konkret bedeutet das, zu hinterfragen, inwiefern sich die Schuld des Wärters in einer Geheimdienstzentrale oder eines Gefängnisses von der des Spitzels unterscheidet, der durch seine Berichte sowohl Nachbarn als auch Familienmitglieder in die Fänge des paranoiden Sicherheitsapparats trieb und sich dabei wirtschaftliche oder soziale Vorteile sicherte.
Gerade diese Vereinfachung birgt Risiken. Eine tiefere und unbequemere Auseinandersetzung ist erforderlich – nicht nur, um Vergeltung zu ermöglichen, ohne in einseitige Siegerjustiz zu verfallen
Nach 14 Jahren täglicher Konfrontation mit Leid und Gewalt ist es nachvollziehbar, die Verantwortung für die Gewaltmaschinerie auf sichtbare Akteure schieben zu wollen, um dieses dunkle Kapitel schnell und scheinbar erfolgreich abzuschließen. Doch gerade diese Vereinfachung birgt Risiken. Eine tiefere und unbequemere Auseinandersetzung ist erforderlich – nicht nur, um Vergeltung zu ermöglichen, ohne in einseitige Siegerjustiz zu verfallen, sondern auch, um zu verhindern, dass die vom Regime geschürte Polarisierung zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird und damit die Opfermythen der sozialen Konflikte von morgen begründet.
Um Übergangsjustiz als Grundlage einer integrativen Übereinkunft über eine gemeinsame Erzählung von Schuld und Verantwortung in Zeiten der Diktatur zu verankern, sind drei grundlegende Bedingungen erforderlich. Erstens bedarf es lebender Zeitzeugen – insbesondere jener Täter, die derzeit reihenweise von den neuen Sicherheitsbehörden an der syrischen Küste festgesetzt werden. Zentrale Gewaltfunktionäre des Regimes, wie Musa Ahmed Khalifa (alias »die Fledermaus«), der Leiter der Luftaufklärungsabteilung des Luftwaffengeheimdienstes, Issa Al-Sulaiman Abu Haidar Jawiya, oder nicht zuletzt Assads Innenminister Generalmajor Muhammad Al-Shaar müssen unter der Bedingung einer möglichst objektiven Beweisaufnahme und einer soliden forensischen Verfahrensweise in ordentliche Gerichtsprozesse eingebunden werden.
Ihre Aussagen könnten, ähnlich den Nürnberger Prozessen gegen die Nazi-Kader, die Grundlage für eine tiefgehende Aufarbeitung der Gewaltverstrickung bilden – nicht nur im Hinblick auf die begangenen Verbrechen, sondern auch auf die psychologischen, ideologischen und strukturellen Mechanismen, die Individuen in das Unterdrückungssystem eingebunden und ihre Beteiligung an Gewalttaten ermöglicht haben.
Für ein ordentliches und objektives Verfahren bedarf es zweitens einer staatlich angeordneten Restitution relevanter Dokumente – insbesondere jener, die während der Befreiung von Gefängnissen achtlos zurückgelassen oder in private Hände gefallen sind. Der Weg der Übergangsjustiz als langfristiger Befreiungsprozess erfordert deren systematische Archivierung, um die Reichweite des Gewaltsystems kartografieren und damit einseitigen Anschuldigungen gegenüber spezifischen Gruppen zuvorkommen zu können. Das nötige Know-how für die Organisation von Archiven und die Vorbereitung juristischer Prozesse könnte Syrien aus dem Ausland erhalten. Ein Netzwerk syrischer Nichtregierungsorganisationen sowie internationaler Akteure wie die deutsche Bundesgeneralstaatsanwaltschaft, die bereits Kriegsverbrecherprozesse in Koblenz, Hamburg und Frankfurt führt, könnten dabei Unterstützung leisten.
Ein Weg zur Befreiung bedarf damit einer universellen Justiz, die auch gegenüber jenen gilt, die sich jetzt als Sieger wähnen
Zu guter Letzt der dritte Punkt, der vom Willen der neuen Machthaber abhängt, Syrien tatsächlich in eine bessere Zukunft zu führen. Hayat Tahrir Al-Sham und ihre Verbündeten in der »Syrischen Nationalen Armee« (SNA) bleiben trotz ihres Imagewechsels Gewaltakteure, die selbst für massive Gräueltaten verantwortlich sind – darunter Massaker an religiösen Minderheiten, extralegale Hinrichtungen, Inhaftierungen, Folter sowie die Unterschlagung humanitärer Hilfe. Der Skandal um das Video aus dem Jahr 2015, das den amtierenden Justizminister Shadi Al-Waisi zeigt, wie er in einem Straßenfeldgericht in Idlib die Verurteilung von zwei Frauen zum Tode beaufsichtigt, oder gezielte Morde wie an der liberalen Revolutionsikone Raed Fares durch Al-Shar’as Todesschwadronen, dürfen im Rahmen eines aufrichtigen gesellschaftlichen Aussöhnungsprozesses nicht in Vergessenheit geraten.
Ein Weg zur Befreiung bedarf damit einer universellen Justiz, die auch gegenüber jenen gilt, die sich jetzt als Sieger wähnen. Eine Gerichtsbarkeit, die auch die eigenen Reihen erfasst, würde nicht nur aufklärende Gerechtigkeit für alle Syrerinnen und Syrer schaffen, sondern auch der durch die Gewaltherrschaft verwurzelten Vorstellung entgegenwirken, dass Vergeltung einzig durch das Prinzip der Vergeltung mit gleicher Münze zu erreichen ist.
Damit würde dem grundlegenden Phänomen autoritärer Stabilität, Gewalt mit mehr Gewalt zu bekämpfen, der Zahn gezogen. Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden, um einer Kultur des Vergebens aber nicht des Vergessens Platz zu machen und dadurch langfristigen sozialen Frieden zu ermöglichen. Denn Rache hält die Gesellschaft in der Vergangenheit gefangen, während Gerechtigkeit sie in der Gegenwart verankert und Vergebung den Weg in eine Zukunft ebnet, die nicht mehr von der Last des Vergangenen bestimmt wird.
Eine konsequente Übergangsjustiz könnte Syriens Suche nach stabilen Institutionen auf die Erkenntnis stützen, dass der Staat, wie der Philosoph Karl Jaspers es einmal formulierte, durch Gewalt gesichert, aber nicht bestimmt werden soll. Das bedeutet, die juristische Aufarbeitung nicht nur als Mittel zur gesellschaftlichen Reflexion zu begreifen, sondern auch die tief verankerte Denklogik der Gewaltherrschaft zu überwinden, um einen Staat zu formen, der nicht länger Werkzeug der Gewalt, sondern Garant des Rechts ist.
Dr. Sascha Ruppert-Karakas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische Theorie des Geschwister-Scholl-Instituts für Politikwissenschaft der Ludwigs-Maximilians-Universität in München.