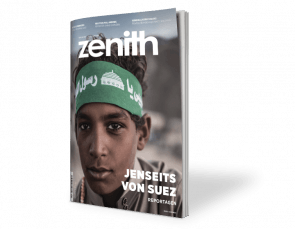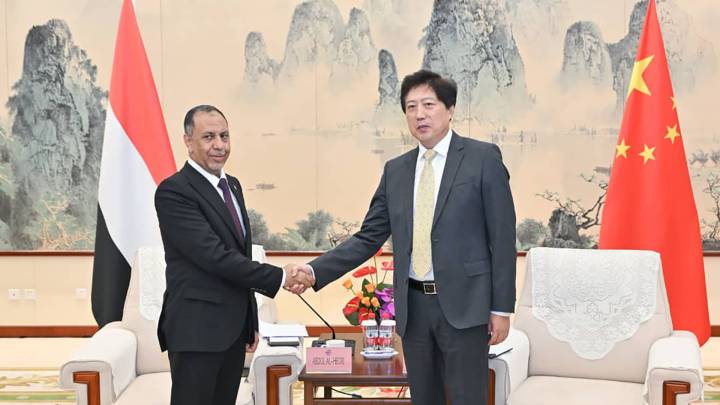Jemens wichtigster Hafen am Roten Meer ist ein Schlachtfeld. Zu Besuch in einer Stadt, die der Schlüssel sein kann: für Aufbau oder Untergang.
Es ist sechs Uhr morgens, an einem heißen Sommertag Ende Juli 2019 in Hodeida. Radi Fuad Abdul Rasul und seine Familie liegen noch in den Betten, als die Rakete einschlägt. »Danach erinnere ich mich nur noch an Staub und Rauch. Meine Frau schrie die Namen unserer Kinder.« Auf den ersten Einschlag folgt ein weiterer, der das Haus nebenan trifft. Ein Mann ist auf der Stelle tot. Die dritte Bombe schlägt in einem Geschäft gegenüber ein und verwundet drei Passanten. Radi schafft es, seine Kinder aus den Trümmern zu befreien.
Während er mit leichten Gesichtsverletzungen davonkommt, sind seine Kinder bis heute von den Folgen des Bombenangriffs gezeichnet. Nuseiba ist 14 Jahre alt, ihr Körper ist übersät von Schrapnellwunden. »Sogar am Hals und am Rücken«, merkt ihr Vater an. Ihr sechsjähriger Bruder Hamza liegt auf derselben Station, ein paar Betten weiter.
Das Krankenhaus liegt ein paar Hundert Meter vom Zuhause der Familie entfernt, das nun teilweise in Schutt und Asche liegt – wie immer mehr Straßenzüge und Häuserzeilen. »Der Waffenstillstand in Hodeida hält nicht – Sie sehen ja, was meinen Kindern widerfährt«, sagt Radi und streichelt Hamzas Haar. »Wir trauen niemandem mehr, die Menschen fliehen. Wer bleibt, wird sterben.«
Noch vor wenigen Jahren bestimmte das lebhafte Treiben auf den Märkten das Bild in Jemens viertgrößter Stadt. Hodeida liegt etwa hundert Kilometer westlich von Sana’a am Roten Meer. Ihre strategisch günstige Lage verhalf der Stadt insbesondere unter den Osmanen zum Aufstieg als Handelszentrum, nun wird sie ihr zum Verhängnis. Seit Ausbruch des Krieges im Jemen 2015 sind fast ein Drittel der vormals 600.000 Einwohner geflohen.
Die von Iran unterstützten Huthis kontrollieren mit Hodeida ein entscheidendes Glied ihrer Nachschubkette. Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition sieht in der Einnahme von Hodeida einen Schlüssel, um den über fünf Jahre währenden Abnutzungskrieg noch zu den eigenen Gunsten zu wenden.
Die Folgen der von Riad verhängten Blockade der Luft-, See- und Landwege spürt vor allem die Zivilbevölkerung – und das weit über Hodeida hinaus. Die Hafenstadt ist ein Nadelöhr für Nahrung, Treibstoff, Medikamente und Hilfsgüter, die in den Norden des Landes gelangen, in dem fast 80 Prozent der Jemeniten leben.
[[{"attributes":{},"fields":{}}]]
Als Ende 2018 der komplette Versorgungskollaps drohte, rangen sich beide Kriegsparteien zu einem Waffenstillstand durch – zumindest in der Schlacht um Hodeida. Das Abkommen von Stockholm sah eigentlich auch eine schrittweise Demilitarisierung der Stadt vor. Doch den UN-Beobachern blieb wenig anderes zu tun als die Übertretungen zu zählen.
Die Waffenruhe wurde bis Januar 2020 über tausend Mal gebrochen. Zivilisten geraten weiter ins Visier, Barrikaden aus Frachtcontainern und Gräben teilen die Straßen der Stadt, die Zufahrtstraße nach Sana’a ist immer noch blockiert. Der Krieg hat den Betrieb des Containerhafens nahezu zum Stillstand gebracht.
Auf eigene Faust kann man sich hier nicht bewegen. Ein Aufpasser der Huthis führt durch die Anlagen. »Die Lebensmittelsilos hier wurden beschossen«, sagt Omar Al-Jarbhouzi und zeigt auf die zerbombten Lagerbehälter. »Sogar die Hilfsgüter der Vereinten Nationen.« Auch die Kräne und Steuerkabinen liegen teilweise in Trümmern.
Nur wenige Güter sind von der Blockade ausgenommen: Mehl, Zucker, Treibstoff. Der Treibstoff füttert weniger die Autos, sondern vor allem die Generatoren – die wichtigste Stromquelle für Kühlschränke und damit essentiell für die Nahrungsversorgung. Um in den Hafen einzulaufen, benötigen Schiffe eine Genehmigung der international anerkannten Regierung von Abd Rabbo Mansur Hadi in Aden und der von Saudi-Arabien geführten Koalition.
[[{"attributes":{},"fields":{}}]]
Im September 2019 beklagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock das komplizierte Prozedere der jemenitischen Behörden für Treibstoffimporte, die die Engpässe verschärfen würden. So sei es keine Seltenheit, dass Versorgungsschiffe den Hafen anlaufen, aber ihre Ladung nicht löschen könnten und so wieder kehrtmachten. Allein im September 2019 passierte das mindestens zehn Mal.
Dass die Kräne in Hafen stillstehen und auf dem Gelände nur eine Handvoll Männer für Wartungsarbeiten unterwegs sind, ist das Ergebnis der Blockade – aber nicht nur. Die Huthis belegen die Waren, die ins Land kommen, mit zusätzlichen Abgaben. Zudem kontrollieren sie, an wen welche Güter ausgeliefert werden. Gerade Lebensmittel würden oft nicht an die wirklich Bedürftigen ausgegeben, kritisiert etwa das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), das aus diesem Grund seine Arbeit in den von den Huthis kontrollierten Gegenden mehrfach ausgesetzt hat. Im Januar 2020 meldete die UN-Agentur zudem, dass Milizen eines ihrer Lagerhäuser ausgeräumt hätten.
Der Krieg im Jemen hat Märkte und Institutionen, soziale Versorgungssysteme und Infrastruktur zerstört. Fast 90 Milliarden US-Dollar hat die jemenitische Volkswirtschaft seit 2015 eingebüßt, die Kaufkraft ist auf Werte wie zuletzt in den 1960er-Jahren gefallen. Im September 2019 stellte die Ständige Vertretung der Bundesrepublik im Rahmen der UN-Generalversammlung einen Bericht der Universität Denver im Auftrag der UN-Entwicklungsorganisation UNDP vor, der vor den nachhaltigen Schäden für Menschen und Wirtschaft im Jemen warnt: Sollte der Krieg bis 2022 weiterlaufen, drohten 75 Prozent der Jemeniten unter die Armutsgrenze zu fallen – damit wäre der Jemen gemäß UN-Kriterien das ärmste Land der Welt.
Der wirtschaftliche Schaden von Krieg und Blockade fällt in Hodeida besonders ins Auge. Neben der Logistikbranche muss vor allem der Fischereisektor existenzbedrohende Einbußen von geschätzt 5 Milliarden US-Dollar verkraften. Bis zu 10.000 Menschen verloren nach Angaben der Weltbank ihre Arbeit beziehungsweise können ihr aus Sicherheitsgründen nicht mehr nachgehen. Und selbst wer noch auf See fährt, kann kaum von dem leben, was ins Netz geht.
[[{"attributes":{},"fields":{}}]]
Seit dem frühen Morgen füllt sich der Fischmarkt von Hodeida. Doch niemand hier kann es sich leisten, etwas zu kaufen. Die Versteigerung des Fangs der letzten Nacht erscheint wie ein müdes Ritual der Resignation. »Erst habe meinen Job, dann meine Würde verloren.« Awad Abdullah war vor dem Krieg Ingenieur und arbeitete für die Regierung. Heute nimmt er für eine Handvoll Rial Fische aus. Seine Frau und seine Kinder sind aus Hodeida nach Sana’a geflohen. »Inzwischen bin ich nur ein armer Kerl«, sagt Awad. »Einer von vielen«, und zeigt in Richtung der Fischer, die gerade ihre Netze reinigen und sich für die nächste Fahrt bereitmachen.
Die meisten von ihnen wagen sich nur wenige Meter vom Ufer weg. »Wenn sie weiter rausfahren, könnten die Hubschrauber der Koalition sie wieder unter Beschuss nehmen. So sind hier schon einige ums Leben gekommen«, berichtet Awad. Nach Angaben der Weltbank haben über 40 Prozent aller jemenitischen Familien ihre Haupteinnahmequelle verloren und können sich kaum noch Medikamente, Lebensmittel und Treibstoff leisten. Die schlechte Versorgungslage treibt die Inflation in die Höhe und sorgt dafür, dass der Spritpreis auf dem Schwarzmarkt dreimal so hoch ist wie der offiziell angesetzte Kurs.
»Der Jemen stirbt leise«, sagt Tamer Kirolos von der Hilfsorganisation »Save the Children« über den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes. »Wenn die Angestellten im öffentlichen Dienst nicht bezahlt und die Lebenshaltungskosten nicht gesenkt werden, wird sich die Wirtschaft nicht stabilisieren können, und immer mehr Familien werden Schwierigkeiten haben, Nahrung aufzutreiben.«
65 Prozent der Jemeniten leben noch immer in Dörfern, verstreut und weit entfernt von urbanen Zentren, und mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf die Landwirtschaft als Einkommensquelle für ihre Familien angewiesen. In den letzten Jahren wurden Felder und Brunnen immer wieder gezielt von Kampfjets ins Visier genommen. Ein beträchtlicher Teil der jemenitischen Wirtschaft fiel so dem Krieg zum Opfer.
[[{"attributes":{},"fields":{}}]]
Laut einer Studie der London School of Economic (LSE) über die Auswirkungen des Krieges auf die Landwirtschaft in den ersten Jahren des Konflikts wurden landwirtschaftliche Nutzflächen in den Gouvernements Schabwa und Mahwit besonders häufig unter Beschuss genommen. Beide Provinzen liegen an wichtigen Zufahrtswegen nach Sana‘a, entsprechend heftig toben die Kämpfe um die Kontrolle der Transportwege.
Die Strategie der von Saudi-Arabien geführten Koalition zielt darauf ab, die Nahrungsmittelproduktion in von den Huthis kontrollierten Gebieten zu zerstören. Die Kontrolle der Nahrungsmittelimporte und die Schwächung der Landwirtschaft sollen die Bevölkerung aushungern.
Eine vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzte Expertengruppe bestätigte im September 2019 in einem Bericht diesen Vorwurf und prangert Kriegsverbrechen aller Parteien im Jemen-Konflikt an. Die UN-Experten schreiben, dass die jemenitische Regierung und die Koalition, die sie unterstützt, auf der einen Seite und die Huthi-Rebellen auf der anderen Seite seit Jahren humanitäre Hilfe blockieren und Hunger als Methode der Kriegführung nutzen. Der Bericht verurteilt zudem die Luftangriffe sowie die Anwendung von Folter und sexueller Gewalt im Jemen-Krieg.
Der Bericht listet auch Straftaten auf, bei denen verbündete Staaten – also die USA, Großbritannien, Iran oder Frankreich – als Komplizen für einige dieser Verbrechen ausgemacht werden können, indem sie »spezifischen Einfluss auf die Konfliktparteien« nehmen, etwa durch nachrichtendienstliche oder logistische Unterstützung und Waffenverkäufe.
[[{"attributes":{},"fields":{}}]]
Der Krieg wird in dem vollen Wissen geführt, dass die umgesetzten Strategien eine Hungersnot auslösen würden. Und das in einem Land, das bereits vor dem Krieg das ärmste in der Region war. Diese Strategie wird seit Jahren verfolgt und hat den Zusammenbruch des jemenitischen Rial und einen starken Anstieg der Inflation verursacht. Dies führte zu einer raschen Erschöpfung der Devisenreserven und damit zu erheblichen Ausgabenkürzungen bei der Zentralbank des Jemen, wie ein Bericht der World Peace Foundation vom September 2019 nachzeichnet.
»Wir verhungern«, sagt Ibrahim, der einmal einen Laden in guter Lage in Hodeida führte, das längst in Trümmern liegt. »Wer wie ich ein Geschäft hatte, kann es nicht wiederaufbauen. Und meine Ersparnisse sind nun aufgebraucht.«
Recherche im Jemen
Journalisten, die in Konfliktgebieten arbeiten, müssen mit Überwachung rechnen. Wer von der Front berichtet – egal ob eingebettet bei den regulären Streitkräften oder bei Rebellengruppen – setzt sich diesem Risiko aus. Es ist Teil der Arbeit in Gebieten, die von ernsthaften, langwierigen und ungelösten Konflikten heimgesucht werden. So war es auch im Jemen, einst ein Land des Handels und der Gewürze, mit seinen mondähnlichen Gebirgen und seinem unendlichen Horizont.
Jeder Krieg stellt Journalisten vor ein ethisches Dilemma. Wer Kriege aus der Ferne beobachtet, muss seine Zweifel abwägen, hat doch jede Konfliktpartei eine Agenda und betreibt Propaganda. In dieser Gemengelage müssen Journalisten vor Ort einen ehrlichen Weg finden, die Geschichte der in diesem Konflikt gefangenen Menschen und ihrer Schicksale zu erzählen. Eine Herausforderung, auf die es keine einfache Antwort gibt – schon gar nicht Überparteilichkeit, denn die gibt es nicht, wenn vor deinen Augen Kinder verhungern.
Die einzige Regel, die ich kenne, lautet: Hör nicht auf, Fragen zu stellen! An mich selbst und die Menschen, denen ich begegne. Im Jemen lautete die zentrale Frage: Wer lässt diese Kinder verhungern? Sind wir Journalisten mitschuldig? Wer als Journalist nicht überparteilich sein will und wohl auch nicht sein sollte, der kann stattdessen konkret und rational agieren; und mit klarem Kopf beschreibend das Schicksal der Kriegsopfer näher an die komfortablen Wohnzimmer seiner Leser herantragen.
Aus diesem Grund bedeutet Ehrlichkeit in einem komplexen Fall wie der Situation im Jemen, eine ausgewogene Mischung aus eigenen Beobachtungen und dem zu finden, was die Konfliktparteien dem Journalisten nicht zeigen wollen, was sie ihn nicht filmen oder fotografieren lassen.
In den Jemen bin ich über die Landesgrenze mit dem Oman eingereist. Weder ich noch Alessio Romenzi, der mich als Fotograf begleitete, hatten ein Journalistenvisum der offiziellen Regierung in Aden. Als Touristen getarnt und mit Hilfe eines Schmugglers erreichten wir die Vororte von Taiz, eine durch den Frontverlauf gespaltene Stadt. Dort trafen wir einen Vertreter der Huthis, der uns in die von ihnen kontrollierte Hauptstadt Sana’a brachte.
Dort erwartete uns ein gepanzertes Fahrzeug, der Fahrer, ein Fixer und ein Leibwächter, den uns das Informationsministerium für unseren gesamten Aufenthalt aufgezwungen hatte. Die Reise von der Grenze zu Oman bis in den Nordjemen dauerte vier Tage und erstreckte sich über 1.400 Kilometer entlang der Küste. Darunter immer wieder gefährliche Gebiete wie bei Mukalla, die unter der Kontrolle von Al-Qaida nahen Gruppen stehen. Wir trugen eine den gesamten Körper verdeckende Abaya, dazu schwarze Handschuhe.
Der Schmuggler, der uns begleitete, war vor dem Krieg ein Fremdenführer – bis auf einen Schlag die Touristen ausblieben. Keine Arbeit, kein Gehalt und 17 Menschen, die finanziell auf ihn angewiesen waren. Heute riskiert er eine Gefängnisstrafe, wenn er Journalisten ins Land bringt. Aber er hat keine Wahl, er muss Geld verdienen. Er hofft, dass seine Tochter einmal in der Lage sein wird, das Land zu verlassen, um im benachbarten Oman zu studieren. Dass sie nicht als Kämpferin rekrutiert wird, dass sie lesen und schreiben lernen kann.
In Sana’a wurde unsere Arbeit die nächsten zwei Wochen Tag und Nacht vom Informationsministerium überwacht. Niemals waren wir allein, niemals konnten wir Menschen ungestört befragen. Niemals eine Mahlzeit oder ein Aufwachen ohne diese wachsamen Augen und Ohren. Und natürlich waren auch unsere Gesprächspartner eingeschüchtert, so etwas passiert im Krieg.
Und doch war die Arbeit im Jemen eine ganz besondere Herausforderung mit einem grundlegenden ethischen Dilemma: Denn auf dem Schlachtfeld, zwischen der Propaganda beider Seiten, haben Tausende ihr Leben verloren und sind Millionen Kinder Opfer der brutalster aller Waffen geworden: Hunger.
Wir haben das Land auf einer makabren Route des Hungers durchquert, geführt von den Aufpassern der Huthis. Und mit jedem Tag wurde eine Frage in uns lauter, erst scheu und am Ende alles übertönend, während wir die skelettartigen Körper der Kinder dokumentierten: Werden wir gerade zu Komplizen der menschengemachten Hungersnot?