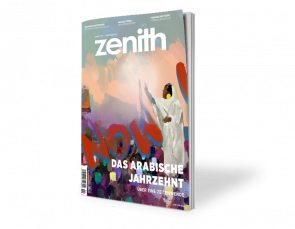Algeriens etablierte Medien haben den Aufstand gegen Bouteflikas Dauerherrschaft nicht kommen sehen. Wie ein merkwürdiger Mix aus Aktivisten und Influencern die Propagandamaschine des Regimes entlarvte.
Am 10. August 2020 verurteilte ein Gericht in Sidi M’Hamed in der Hauptstadt Algier den Journalisten Khaled Drarni zu drei Jahren Haft – dem 40-Jährigen Leiter der Website Casbah Tribune wurden »Anstiftung zu einer unbewaffneten Versammlung« und »Angriff auf die nationale Einheit« vorgeworfen. Es war die höchste Strafe, die jemals gegen einen Journalisten in Algerien ausgesprochen wurde – auch wenn die Haftzeit in der Berufung im September auf zwei Jahre gemindert wurde.
Das Urteil löste Aufruhr und Bestürzung aus. Drarni hatte gerade über eine Demonstration gegen die Regierung berichtet, als er im März 2020 festgenommen wurde. Eigentlich rechtfertigte nichts seine Verurteilung. Warum also wurde er so hart bestraft?
Drarni hat mehr als 100.000 Follower auf Twitter und gibt viel auf seine Unabhängigkeit. Dissidenten wie ihn juristisch zu verfolgen, steht sinnbildlich für die Strategie des Regimes, die Berichterstattung über die zweiwöchentlichen Großdemonstrationen einzuhegen.
Seit April sind die Proteste wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Die meisten algerischen Medien ignorierten sie aber schon viel länger – weit bevor Abdelmadjid Tebboune aus den umstrittenen Wahlen vom 12. Dezembers 2019 als neuer Präsident hervorging.
Mit Hilfe staatlicher Subventionen (und ihrem möglichen Entzug) nahm der Staat die Medien an die kurze Leine. Den Aufstand im Februar 2019, der das Ende der Herrschaft von Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika einläutete, sahen sie daher nicht kommen. Sie waren zu beschäftigt, die offiziellen Sprachregelungen wiederzugeben – fast einstimmig feierten sie den einschläfernden Diskurs, mit dem die staatlichen Stellen Bouteflikas fünfte Amtszeit vorbereiteten.
Der Niedergang der algerischen Presse hat handfeste Gründe: Sinkende Werbeeinnahmen und die gezielte Steuerung staatlicher Subventionen.
Der Niedergang der algerischen Presse hat handfeste Gründe: Sinkende Werbeeinnahmen und die gezielte Steuerung staatlicher Subventionen ließen die klassischen Medien seit gut einem Jahrzehnt verarmen. Einige Zeitungen mit Meinungsmacht wie Le Soir d’Algérie, El Watan, Liberté oder auch El Khabar verpassten daher den digitalen Turn.
Dadurch entstand ein Freiraum, den neue Akteure nutzten: »Nachrichten, die von staatlichen Sendern und etablierten privaten Zeitungen verheimlicht werden, kursieren im Internet. Das diskreditiert die klassischen Medien«, sagt Said Djaffar, der bereits seit 40 Jahren für algerische und ausländische Medien arbeitet. »Die Zahl derjenigen, die sich heute über gedruckte Zeitungen informieren, ist nicht besonders groß. Das ist nicht zu vergleichen mit den 1990er Jahren, als die Zeitungen den politischen Diskurs belebten.«
Das Regime versucht, gegen die digitale Gegenöffentlichkeit vorzugehen – unter anderem mit dem Strafrecht: Zahlreiche Aktivisten landeten wegen Facebook-Kommentaren im Gefängnis. Aber wie funktioniert diese Gegenöffentlichkeit? Wie konnte es ihr gelingen, eine Propagandamaschine herauszufordern, hinter der mehrere Fernsehsender und fast alle Zeitungen stehen?
Algeriens Gegenöffentlichkeit besteht aus einem bunten, untereinandernicht unbedingt vernetzten Haufen: Online-Zeitungen, die mit rudimentären Mitteln erstellt werden. Journalisten, Akademiker, Blogger, Aktivsten und sogar einfache Volksmusiker konkurrieren auf einem Markt, der informell, aber nichtsdestotrotz real ist – die Währung sind Klicks und Likes.
Informationen der anderen werden übernommen, manchmal verkürzt, teils seltsame Allianzen gebildet und wieder gekappt.
Viele produzieren im Ausland, manche werden von lokalen Quellen mit falschen oder richtigen Informationen versorgt, zum Teil sogar aus Kreisen der Sicherheitsbehörden. Informationen der anderen werden übernommen, manchmal verkürzt, teils seltsame Allianzen gebildet und wieder gekappt. Dennoch hat diese merkwürdige Guerillatruppe es vermocht, die Propagandamaschine des Regimes zum Entgleisen zu bringen.
»Die Algorithmen der sozialen Netzwerke funktionieren wie ein Vergrößerungsglas. Wer eine bestimmte Art von Inhalten anschaut, bekommt Ähnliches angeboten. Das kann zur einer Art Abkopplung von der Realität führen«, meint Riad Ait Aoudia, Chef der Kommunikationsagentur MediAlgeriA. »Das führt bei manchen zu Überreaktionen, sie lassen sich von der Blogosphäre blenden und tragen oft unwissentlich dazu bei, dass sich Inhalte viral verbreiten.«
Die Wirkungen dieser in den Sozialen Medien kursierenden »Informationen« muss also stets mitgedacht werden. Wie viele Personen werden erreicht? Wie hoch wird ihre Glaubwürdigkeit von den Rezipienten eingeschätzt? Verändert sich deren Wahrnehmung oder auch ihr Entscheidungsverhalten? Wie viele Menschen schauen sich die Inhalte einfach aus Freude an rhetorischen Gefechten oder aus Neugier auf Anzüglichkeiten an?
Aoudia hält es für wichtig, auf die Werkzeuge zu schauen, mit denen die Reichweite digitaler Informationen gemessen wird. »In dieser Hinsicht ist der algerische Markt unterentwickelt. Meiner Kenntnis nach verfügen nur die Sicherheitsbehörden und einige Marketingfirmen über die entsprechende Technologie, also die Möglichkeit, zu messen, welche Rendite ihnen ihre Aktionen bringen.«
Der Fangesang »La casa de Mouradia« nahm Bezug auf die populäre spanische Bankräuber-Serie »Haus des Geldes« und wurde zu einer der Hymnen des Aufstands 2019.
Auch wenn die Wirkmacht digitaler Information nur schwer einzuschätzen ist, hatten manche Inhalte zweifellos massiven Einfluss: Schließlich wurden die Demonstrationsaufrufe primär über die Sozialen Medien verbreitet.
Der Verlust des Informationsmonopols der klassischen Medien setzte jedoch früher ein. Gerüchte gab es schon immer. Weil es schwierig war, bestimmte Themen anzusprechen, haben die Algerier die Propaganda mit Graffiti an Hauswänden oder schlüpfrigen Witzen umgangen. Vor allem die Fußballstadien waren immer ein Ort der freien Meinungsäußerung, gepaart mit ein paar zünftigen Schimpfwörtern.
Als 1990 der damalige Präsident Chadli Benjedid dem algerischen Nationalteam den Pokal für den Sieg des Afrika-Cups überreichte, wurde er mit Slogans der islamistischen Heilsfront (FIS) empfangen. Und ab 2017 besangen die Ultras von USM Algier höhnisch die Verschwendungssucht des Regimes von Präsident Bouteflika. Der Fangesang »La casa de Mouradia« nahm Bezug auf die populäre spanische Bankräuber-Serie »La Casa de Papel« (»Haus des Geldes«) und wurde zu einer der Hymnen des Aufstands 2019.
Das mobile Internet beschleunigte den Bedeutungsverlust der alten Medien noch weiter, auch wenn 3G und 4G in Algerien eher spät Fuß gefasst haben. Was können Printmedien und Fernsehsender, die den offiziellen Diskurs in abgedroschenen Phrasen wiedergeben, gegen eine sich ständig erneuernde Technologie ausrichten, durch die im Dialekt, mit Memes, Codes, Bildern, Videos, GIFs und Emojis kommuniziert wird? Eine Szene, die Inhalte als Häppchen anbietet, mit bissigen Botschaften in immer kürzeren Abständen, manchmal in der Absicht, mit einer einzigen Pointe einen ausführlichen Diskurs zu zerstören?
Ganze Armeen von Internettrollen verpesten das Netz und bedrängen Dissidenten und all diejenigen, die der offiziellen Linie widersprechen.
Hat die staatliche Propaganda schlicht ihren Einfluss verloren, weil die Verantwortlichen die Mechanismen der Sozialen Medien nicht verstehen? »Die Jungen glauben nicht mehr an politische Dogmatik. Anders als viele Ältere haben sie organisierte Parteiarbeit im Untergrund nie kennengelernt«, analysiert Nacer Djabi und beobachtet die Entstehung einer neuen politischen Kultur. »Sie legen mehr Wert auf Pluralität, auf den Dialog. Sie haben weniger Angst, schon gar nicht vor der Repression des Regimes«, meint der Soziologe von der Universität Algier.
Es bleibt ein Paradox: Zum einen tut das Regime so, als hätten die sozialen Netzwerke keinerlei Relevanz, zum anderen zögert es nicht, die sozialen Netzwerke selbst zu nutzen, um Oppositionelle zu diskreditieren und interne Konflikte zu regeln. Ganze Armeen von Internettrollen verpesten das Netz und bedrängen Dissidenten und all diejenigen, die der offiziellen Linie widersprechen.
»Das Internet hat den Selbsterhaltungstrieb des Regimes noch gestärkt«, sagt Djaffar. So würden etwa immer häufiger zwielichtige Influencer auftauchen, die Regierungspositionen verteidigen. »Auch wenn das nicht seine Absicht ist, diskreditiert sich das Regime dadurch selber und untergräbt die Propaganda. Denn mit dem Versuch, zu spalten, begibt es sich auf dünnes Eis.«
Für Djaffar spiegeln die Auseinandersetzungen im Internet eine breite Unzufriedenheit wider. Das angstgetriebene Narrativ des Regimes von einer inneren und einer äußeren Bedrohung werde zunehmend abgelehnt. Auch wenn die meinungsstarken Multiplikatoren im Netz eine äußere Bedrohung nicht unbedingt infrage stellen, so zeigt ihr Aktivismus doch, was sie als das größere Problem ansehen: den Fortbestand des überholten Regimes. Aus dem Französischen von Moritz Behrendt
Lyas Hallas arbeitet als Investigativjournalist in Algier. Er ist Mitglied des Internationalen Netzwerks investigativer Journalisten (ICIJ). Er schreibt für die algerische Zeitung Le Soir sowie verschiedene internationale Medien.