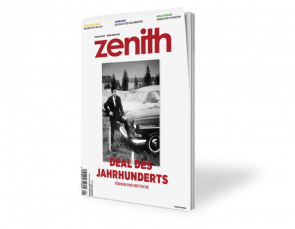Im Gespräch mit zenith warnt der Islamwissenschaftler und Kunstexperte Stefan Heidemann vor den Folgen von Raubgrabungen und großen Bauprojekten, die das Kulturerbe der islamischen Welt bedrohen.
zenith: Als Sie vor knapp sieben Jahren ein aus Afghanistan stammendes Marmorpaneel begutachten sollten, beschlich Sie ein mulmiges Gefühl. Was ging Ihnen durch den Kopf?
Stefan Heidemann: Mir wurde klar, dass ein Exponat von so hoher Qualität kein Einzelstück, sondern Teil einer größeren Palastausstattung sein musste. Kurz darauf sprach ich in New York mit meiner Kollegin Martina Rugiadi, die ihre Dissertation über ghaznawidische Marmorpaneele geschrieben hatte. Sie identifizierte das Paneel als Teil einer italienischen Grabung aus den 1960er Jahren. In den 1970er Jahren wurde es an das Museum in Ghazni übergeben. Seit 1979, nach dem sowjetischen Einmarsch nach Afghanistan, gab es keine Informationen mehr über dieses Stück.
Sie hatten also Raubkunst vor sich, ein brisanter Verdacht.
Mir wurde das Stück von Nora von Achenbach gezeigt, es sollte das neue Prunkstück der neu konzipierten Dauerausstellung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe werden und war kurz zuvor von einem Auktionator aus Paris angekauft worden. Ein tolles Beispiel für die Schönheit und die Ausdrucksfähigkeit der islamischen Kunst. An ihm ließ sich die Schönheit der Arabesken zeigen und die Blüte der islamischen Kultur bestens repräsentieren. Frau von Achenbach war nicht klar gewesen, dass ausgerechnet dieses Stück, das direkt am Eingang einer großartigen neuen und von ihr kuratierten Ausstellung stehen sollte, nach allem, was wir wissen, gestohlen war. Immerhin plante das Museum noch im September 2014 eine Ausstellung über Raubkunst. Ein Gespräch über diese geraubte Kunst mit der Museumsdirektorin hatte ich nur einen Tag, nachdem sie die Ausstellung über Raubkunst eröffnet hatte, die nicht nur jüdische Raubkunst in Museen, sondern auch solche aus dem Vorderen Orient anprangerte.
Wie reagierte das Museum?
Direktorin Sabine Schulze erkannte schnell, dass sich hier eine Möglichkeit ergab, ein Zeichen zu setzen und die Restitution in Gang zu bringen – auch wenn dieser Prozess über Jahre in den Mühlen der Hamburger Bürokratie steckenblieb. Das Museum hatte an sich korrekt gehandelt, aber zu kurz gedacht, denn das Paneel war nicht im Register vermisster Kulturgüter aufgeführt – in den Wirren des Krieges wurden solche Inventarlisten in Afghanistan über Jahrzehnte nicht aktualisiert. Allerdings hatte meine Kollegin Martina Rugiadi vom Metropolitan Museum das Pariser Auktionshaus Boisgirard-Antonini über die Provenienz des Paneels informiert – in diesem Punkt kann man das Auktionshaus im Übrigen rechtlich angehen. Denn es verschwieg eine wesentliche Eigenschaft des Objekts, nämlich dass es gestohlen ist. Nicht alle Auktionshäuser handeln so. Sotheby's und Christie's etwa gehen heute sehr verantwortlich mit solchen Dingen um.
»Im Bereich der Terrorfinanzierung ist der Anteil von Antikenhandel relativ klein«
Wie oft kommen Ihnen in Ihrer Gutachter-Tätigkeit solche Fälle wie der des Marmorpaneels aus Ghazni unter?
Bei den Anfragen von Landes- und Bundeskriminalamt geht es hauptsächlich um Objekte, die im Zoll aufgehalten worden sind und bei denen die Provenienz festgestellt werden soll, insbesondere wenn sie aus Syrien, Afghanistan oder dem Jemen stammen. Da gebe ich dann meine Expertise ab. Manchmal handelt es sich um Fälschungen, manchmal um antike Stücke, aber viele kosten auch nur fünf oder zehn Euro, sind aber eben 2.000 Jahre alt. Aber auf der Ebene großer Kunstobjekte war mir ein vergleichbarer Fall noch nicht untergekommen.
2016 trat das Kulturgutschutzgesetz in Kraft. Reichen die rechtlichen Rahmenbedingungen nun aus, um dem Antikenschmuggel Einhalt zu gebieten?
Kulturgutschutz in Deutschland hat sehr viel mit deutscher Innenpolitik zu tun, das sollte man getrennt betrachten vom Kulturgutschutz im Nahen Osten. Ein positiver Effekt der Diskussion in Deutschland ist, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass Kulturgut aus diesen Ländern illegal exportiert wird, dass es dafür einen Markt gibt, dass Architektur zerstört wird und dadurch auch Schätze der Menschheit verloren gehen.
Und damit auch als Quelle der Terrorfinanzierung dienen?
Damit wird von politisch interessierter Seite oft argumentiert. Im Bereich der Terrorfinanzierung ist der Anteil von Antikenhandel aber relativ klein, das Ölgeschäft etwa ist viel einträglicher. Selbst wenn ein Objekt mal 20.000 Euro einbringt, kostet allein ein Toyota Hilux deutlich mehr. Solche Aktivitäten lassen sich kaum mit Antiken finanzieren.
Wie wirken sich Raubgrabungen auf den Antikenmarkt aus?
Bei den Raubgrabungen müssen wir unterscheiden. Was es schon immer gab, ist, dass Menschen etwa nach einem Regenschauer ihre Furchen auf den Feldern ablaufen und nach Münzen und Metallschrott suchen. Dann gibt es kriminelle Raubgrabungen – auch die hat es immer schon gegeben, sie sind aber in den Gebieten, in denen der IS herrschte, intensiviert worden. Dennoch können wir auf dem Kunstmarkt keinen dramatischen Anstieg im Handel mit syrischen Kunstwerken feststellen. Ich würde daraus schließen, dass die Antiquitäten, die Terror-Organisationen oder die organisierte Kriminalität auf den Markt bringen, in der Masse nicht unbedingt auffallen.
»Wenn man Häuser baut, braucht man gut behauene Steine. Die findet man in den alten Ruinen«
Was gefährdet Kulturgüter mehr als Raubgrabungen?
Legale Baumaßnahmen, sekundäres Absuchen und dann der illegale Export leisten der Kulturzerstörung Vorschub. Das ist von Deutschland aus kaum zu kontrollieren. Besonders antike Münzen aus Silber oder Gold sind davon betroffen: Selbst wenn sie keinen Absatzmarkt finden, bleibt noch der Metallwert.
Was bedeutet das für Antiken aus Konfliktgebieten wie etwa Syrien?
Ich habe schon in den 1980er Jahren in Syrien erlebt, wie die vom Assad-Regime geplante Zerstörung des jüdischen Viertels Bahsita und sein Wiederaufbau in Aleppo den Fundus der Antiquitätenhändler auffüllte. Auch rund um die Konstruktion der Tabqa-Talsperre am Euphrat wurde in
einem Ausmaß planiert und gesprengt, dass Archäologen damals quasi vorhersagen konnten, dass bald viele kleine Artefakte aus dem Staudammgebiet auf den Markt kommen würden. Wenn in Syrien von den Planungsbehörden ein neues Viertel ausgelegt und ein aus dem Mittelalter stammendes Viertel abgerissen werden soll, wird die Antikenbehörde nicht gefragt und deren Bedenken beiseitegeschoben. Teilweise sind der Antikenbehörde auch die Hände gebunden, wenn das Gelände unter der Verwaltung der religiösen Stiftungen, der Awqaf, steht wie etwa im Fall der Umayyaden-Moscheen in Aleppo und Damaskus.
Welche Auswirkungen haben zehn Jahre Krieg auf den Antikenbestand in Syrien?
Dafür werden die nächsten Jahre entscheidend. Im Zuge des Wiederaufbaus von Syrien werden Kellerschächte gegraben, in Aleppo und Homs und früher oder später auch in Idlib werden ganze Stadtviertel gebaut werden und man wird sich nicht um die Antiken dort kümmern. Werden die alten Siedlungshügel nicht bewacht, werden sie abgeräumt. Nicht primär für die Antiken, mehr für den guten Lehm als Baumaterial. Und dabei findet sich alles Mögliche. Wenn man Häuser baut, braucht man gut behauene Steine. Die findet man in den alten Ruinen – etwa im Baal-Tempel in Palmyra. Zoll- und Kriminalbeamte müssen die internationalen Zollgesetze durchsetzen, aber Kulturgutschutz muss im Herkunftsland selber ansetzen. Wenn man Syrien in der Antikenpflege nicht unterstützt, wird es keinen Frauenkirchen-Effekt geben, also dass man Monumente irgendwann digital mit einigen Originalsteinen wieder zusammensetzen kann.
»Wir müssen nicht mehr jedes Objekt vor Ort haben«
Mit welchen Ländern funktioniert die Kooperation?
Ich habe zwischen 2012 und 2015 mit dem Nationalmuseum in Afghanistan zusammengearbeitet, um die Museumsbestände zu digitalisieren. Das heißt, wenn noch einmal die Taliban kommen und die Museen ausräumen, ist zumindest alles dokumentiert. Das war weder 1979 noch 2001 der Fall. Auch die Kunst in Afghanistan ist Teil einer Zivilisation von Erlösungsreligionen und gemeinsamem Erbe, das von Irland bis Afghanistan reicht. Wir sind in der glücklichen Lage, in der digitalen Welt zu leben. Das heißt, wir müssen nicht mehr jedes Objekt vor Ort haben. Wir können es einfacher reproduzieren und durch digitale Fotografie bis in alle Einzelheiten studieren. Das erleichtert die Provenienzforschung und ermöglicht es uns, etwa Objekte im Nationalmuseum in Kabul in Augenschein zu nehmen. Dafür ist eben die Kooperation unter den Museen wichtig.
Insbesondere die Golfstaaten bieten hier immer häufiger ihre Unterstützung an – nicht zuletzt auch, um die eigenen neuen Museen zu bestücken.
Nach einer relativ wilden Gründungsphase und Aufkaufzeit werden diese Museen immer mehr auch den internationalen Standards entsprechen. Allerdings hat sich Dubai zum Antiquitäten-Hub entwickelt. Viele Dinge, die früher direkt nach Europa oder Amerika importiert wurden, gehen erst einmal über Dubai, insbesondere Objekte aus Afghanistan, Iran, Nordindien und Pakistan, aber auch aus Syrien. Viele Händler decken sich inzwischen in Dubai ein. Das ist ein internationaler Handel in alle Richtungen: Ich konnte einige Objekte zurückverfolgen, die aus dem europäischen Markt über den Golf wieder in die Region gelangt sind, wahrscheinlich nicht in das Ursprungsland, aber in den Vorderen Orient. Und dann sind seit etwa zehn Jahren auch die Chinesen sehr stark am Markt, insbesondere bei Objekten, die mit dem kulturellen Erbe der Seidenstraße verbunden werden.
Wie steht es etwa in Afghanistan um das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung von Museen und Kulturgutschutz?
Ich kenne den früheren Direktor des Kabuler Nationalmuseums, Omar Massoudi, ganz gut. Bei den afghanischen Kollegen besteht so ein Bewusstsein. Aber auch der Wunsch, mit dem Museum Nationalgeschichte darzustellen. Man muss zwei Konzepte unterscheiden: das enzyklopädische und das Nationalmuseum. Ein Nationalmuseum soll zur Nationenbildung beitragen. Auch Deutschland hat da eine Rezeption von antiken Figuren erfahren, die auf einmal in der Hochzeit des Nationalismus eine Bedeutung erlangten, die sie möglicherweise noch nicht mal in ihrer Zeit hatten, aber danach für mehrere Jahrhunderte nicht mehr: Karl der Große, Widukind, Hermann der Cherusker. In deutschen Museen hat man diese Nationalfiguren inzwischen weitgehend historisch kontextualisiert und damit von der Aufgabe der Nationenbildung entbunden – das finde ich gut.
»Wenn die Münzen beim deutschen Zoll ankommen, ist der Schaden schon verursacht«
Sind Staaten die geeigneten Sachwalter von Kulturgut?
Nicht immer. Das zeigt ja etwa Deutschlands Umgang mit jüdischem Kulturgut im Nationalsozialismus, das Afghanistan der Taliban und die Buddhas von Bamiyan, der Umgang der Türkei mit Phasen ihrer Geschichte oder das frühe Israel mit Phasen der Geschichte von Palästina. Allerdings lässt sich auch berechtigterweise einwenden: Was ist die Alternative? Sind Privatleute bessere Sachwalter? Im Fall der Golfstaaten sieht man ein interessantes, noch punktuelles Umdenken. Es geht nicht mehr nur darum, als Sachwalter islamischer Kultur aufzutreten, sondern diese als Teil des Weltkulturerbes zu begreifen. Der Louvre Abu Dhabi sammelt auch europäische Gemälde, man denke an Leonardo Da Vincis »Salvator Mundi« – was ich sehr begrüße. Denn als ehemaliger Kurator des Metropolitan Museum weiß ich es zu schätzen, wenn man von einer ägyptischen Ausstellung direkt zum Jugendstil laufen kann, von der afrikanischen Kunst hinüber zu Picassos »Les Demoiselles d'Avignon«. So erkennt man, dass wir als Menschheit über ein großartiges Erbe verfügen, das aus gegenseitiger Beeinflussung entsteht und von daher auch immer lebendig ist.
Diese Beeinflussung ist aber auch Resultat von Herrschaftsverhältnissen.
Die Museen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, sollten auch eine Überlegenheit der westlichen Kultur zur Schau stellen. Das arbeiten wir in zahllosen Dissertationen, Habilitationen, wissenschaftlichen Werken eben auch auf. Aber das mindert letztlich nicht den Wert zu schauen, wie die Welt eigentlich ein sehr bewegendes, kulturelles Monument ist. Ein enzyklopädisches Museum zeigt, wie zusammengehörig diese Welt ist.
Wie wichtig ist der Fundkontext bei antiken Objekten?
Wir können viel mehr über unsere Vergangenheit als Menschheit in den verschiedenen Regionen erfahren, wenn wir wissen, wo bestimmte Dinge gefunden werden. Das ist nicht nur für die Stratigrafie des Ortes wichtig, also welche Schicht zu welcher Zeit gehört. Bei Münzfunden etwa interessiert uns, ob sie Sparguthaben oder tägliches Wechselgeld waren. Die Hunderttausenden von Objekten aus vergangenen Zeiten sind meist als Einzelobjekt todlangweilig. Wenn ein Objekt vom Fundkontext getrennt ist, ist es für den Historiker wertlos. Das heißt, wenn etwa Münzen hier beim Zoll ankommen, die möglicherweise in Afghanistan oder in Syrien gefunden worden sind, dann ist der Schaden schon verursacht.
Prof. Dr. Stefan Heidemann