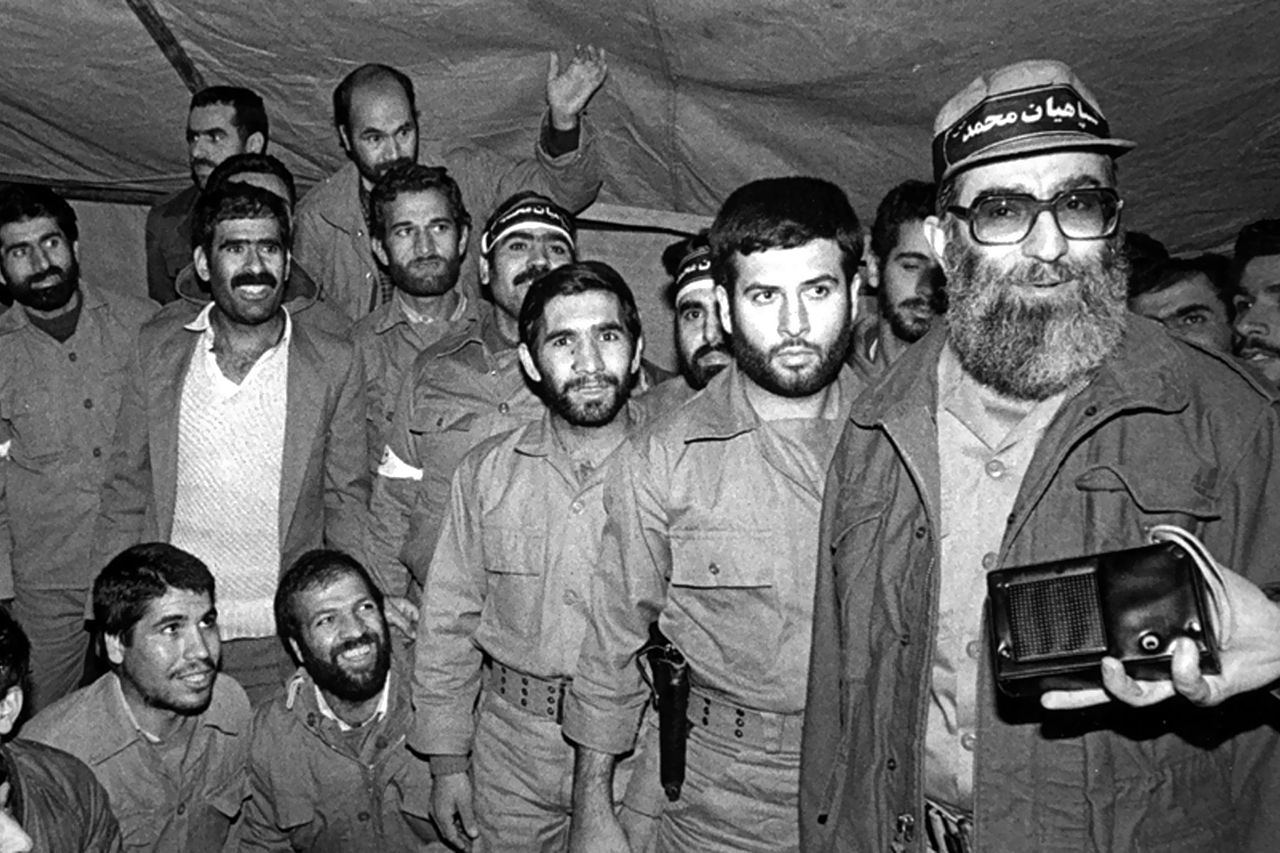Die Revolutionsgarden haben über Jahrzehnte ein ausgefeiltes Vasallensystem aufgebaut. Wie sich Iran auf den Schlachtfeldern der Region aufstellt – und was Teheran damit bezwecken will: Anatomie eines Geflechts von Kommandeuren und Kämpfern.
Die iranische Außen- und Regionalpolitik beruht gleichermaßen auf ideologischen und realpolitischen Grundsätzen. Der persisch-schiitische Iran rechtfertigt seine Rolle als Regionalmacht in der sunnitisch-arabisch geprägten Levante mit seinem Engagement für Palästina. Gleichzeitig geht Teheran davon aus, dass die säkularen pro-westlichen Eliten, die in der Regel dem Staat Israel gegenüber pragmatisch eingestellt sind, stürzen werden und islamisch orientierte Regierungen, also Gegner Israels, überall an die Macht kommen werden. Diese werden sich dann dem von Iran und Hizbullah geführten »islamischen Widerstand« gegen Israel anschließen. Daher spielt das Bündnis mit Syrien, das als Frontstaat gegen Israel gilt, eine zentrale Rolle. Allerdings lässt sich das Konzept des »islamischen Widerstandes« in seiner »Widerstandsachse« genannten Ausformung als Bündnis zwischen Iran, Syrien, der libanesischen Hizbullah und palästinensischen Gruppen wie der Hamas auch als gegen Saudi-Arabien gerichtet deuten. Aus Sicht Riads ist der Verlust Iraks als sunnitisch-arabischer Frontstaat gegen Iran eine strategische Katastrophe, die aufgrund der irakischen Demografie nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Iranische Gesprächspartner wiederum bestätigten dem irakischen Präsidenten Dschalal Talabani bereits 2008, dass sie nichts mehr als eine sunnitische Umzingelung durch die sunnitischen arabischen Staaten, Afghanistan und die Türkei fürchteten. Um dies zu verhindern, müsse das Assad-Regime unbedingt gehalten werden. Syrien musste damit zwangsläufig zum Kriegsschauplatz zwischen Iran und Saudi-Arabien werden. Dieser Antagonismus musste in weiterer Folge auch den Irak involvieren. Das Auftreten des »Islamischen Staates« (IS) 2014 im Irak und in Syrien unterbrach diesen Bogen iranischer Einflussnahme und stellte die gesamte Region vor neue Herausforderungen.
Iran verfolgt zwei Hauptziele im Irak: erstens, zu verhindern, dass aus diesem Land noch einmal eine militärische Gefahr für Iran hervorgehen könnte, und zweitens, dass mittelfristig die USA abziehen. Des Weiteren trachten die Iraner danach, die irakische Politik für den eigenen Standpunkt in Syrien zu gewinnen und das Assad-Regime zu stabilisieren, um eine Machtübernahme dschihadistischer Gruppen dort zu verhindern.
Eine der anspruchsvollsten Herausforderungen für Teheran besteht seit jeher darin, die Widersprüche der eigenen Ideologie mit den strategischen Realitäten im Irak in Einklang zu bringen. So lehnten die Iraner die Anwesenheit der USA in der Region zwar strikt ab, erlaubten ihrem Schützling, dem »Obersten Islamischen Rat im Irak« (SCIRI), jedoch seit den frühen 1990er Jahren, am vom Westen unterstützten Irakischen Nationalkongress (INC) teilzunehmen. Nach dem Sturz des Saddam-Regimes hatte Teheran an einem demokratischen Übergang im Irak großes Interesse, weil man damit rechnen konnte, dass schiitische Gruppen das Parlament dominieren würden. Dasselbe traf für den früheren militärischen Arm des SCIRI zu, die Badr-Brigaden, die mittlerweile als separate Partei und Miliz auftreten und nie offiziell gegen die amerikanischen Truppen im Irak vorgingen.
Damit waren zwei wichtige Elemente im politischen Prozess sowie im Sicherheitsapparat des Nachbarlandes installiert, die Zugang zur höchsten Führung in Iran hatten und mit Teheran ideologisch weitgehend übereinstimmten. Dennoch war den Iranern von Anfang an klar, dass das irakische Verständnis für Iran natürliche Grenzen hat und die Iraker letztendlich entsprechend ihren eigenen nationalen Interessen handeln würden. Irans Fähigkeit, im Windschatten der amerikanischen Invasion Iraks Vertrauensleute in allen relevanten Institutionen des Landes unterzubringen, ist für sich alleine genommen ein beeindruckender politischer Schachzug. Doch der iranische Einfluss erstreckt sich auch auf Sondergruppen, die während der US-Besatzung eine offen anti-amerikanische Agenda vertraten und auch militärisch Druck auf die USA ausübten. Mit großer Berechtigung warfen die USA daher Teheran vor, eine zweigleisige Politik zu fahren. Aus amerikanischer Sicht stand hinter allen gegen die Koalitionskräfte gerichteten Gewaltaktionen schiitischer Splittergruppen die Qods-Einheit der Revolutionsgarden unter Generalmajor Qasim Soleimani.
Der erste sichere Beleg über die Qods-Einheit stammt aus dem Jahr 1984, über ihre damalige Truppengliederung und ihr exaktes Einsatzgebiet ist nicht viel bekannt. Auszuschließen ist jedoch, dass die Qods-Einheit eine Rolle bei der Gründung der libanesischen Hizbullah gespielt hätten, denn deren Aufstellung war 1982 schon weitgehend abgeschlossen und wurde von einer anderen Gruppe der Revolutionsgarden betrieben.
Syrien musste zwangsläufig zum Kriegsschauplatz zwischen Iran und Saudi-Arabien werden. Dieser Antagonismus musste in weiterer Folge auch den Irak involvieren
Die Qods-Einheit erlangte rasch einen relativ hohen Bekanntheitsgrad und wurde von prominenten iranischen Generälen kommandiert wie dem momentanen Kommandanten der Revolutionsgarden, Mohammad Dschafari, ein Kermaner Landsmann Soleimanis und wie er ehemals Kommandant der 41. Panzer-Division, oder Ahmad Vahidi, Verteidigungsminister unter Mahmud Ahmadinedschad. Die Qods-Einheit ist zwar Teil der Revolutionsgarden, das betrifft aber in erster Linie die organisatorische Zugehörigkeit, auf hierarchischer Ebene berichtet sie unmittelbar dem Büro des Revolutionsführers und ist somit ein direktes Führungsinstrument. 2009 wurde die Qods-Einheit zur eigenen Teilstreitkraft der Revolutionsgarden erhoben.
Der Auftrag der Qods-Einheit lautet, überall auf der Welt ideologisch gefestigte, in der Bevölkerung verankerte Zellen aufzubauen und militärisch zu ertüchtigen. Das entspricht den Artikeln 152 bis 154 der iranischen Verfassung, wonach die militärische Unterstützung der »Unterdrückten« als Zweck der Islamischen Republik angegeben wird. Kulturelle Fähigkeiten und Sprachkenntnisse spielten bei der Qods-Einheit immer eine wichtige Rolle. Deshalb findet man Qods-Kräfte in sehr unterschiedlichen Regionen – auch außerhalb des Nahen Ostens: im bosnischen Bürgerkrieg aufseiten der Muslime und der Kroaten, in Afghanistan und im Libanon, vermutlich auch im Sudan. Unwahrscheinlich ist der Einsatz in Gebieten außerhalb der islamischen Kulturzone wie in den USA oder in Südamerika.
Der jetzige Kommandant der Qods-Einheit, Generalmajor Qasem Soleimani, muss bei Amtsantritt auch über Erfahrung im Bereich der internationalistischen Hizbullah-Bewegung verfügt haben, weil er seit Jahrzehnten mit Imad Mughniya, dem langjährigen Militär-Chef der libanesischen Hizbullah, befreundet war. Der 2008 unter ungeklärten Umständen in Damaskus ermordete Mughniyah lebte teils in Iran, teils in Syrien und im Libanon. Die Beziehungen der beiden Familien sind so eng, dass arabische Zeitungen ihnen sogar eine Verwandtschaft andichteten. Soleimani war daher mit dem engsten Zirkel der libanesischen Hizbullah vertraut. Als Soleimani 1998 zeitgleich mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan mit dem Kommando der Qods-Einheit betraut wurde, konnte er auf Fronterfahrung mit der 41. Panzer-Division und auf Jahre im Kampf gegen Schmugglerbanden verweisen. Diese Erfahrungen sowie die Tatsache, dass er aus einer Gebirgsregion stammt und mit Stammesgesellschaften und Nomaden umzugehen weiß, waren für seine Ernennung ausschlaggebend. In Kombination mit seiner intimen Kenntnis der schiitischen politischen Szene weltweit und im Irak war er seinen amerikanischen Gegenspielern gegenüber im Vorteil.
Soleimanis Verantwortung für die Irak-Politik ist aufgrund der prekären Sicherheitslage logisch, erleichtert wird der intergouvernmentale Ansatz der Iraner durch die Verwendung ehemaliger Qods-Offiziere im iranischen diplomatischen Dienst, etwa über Botschafterposten. Westliche Beobachter strickten aus seiner Rolle jedoch bald Legenden über die besonderen Fähigkeiten Soleimanis, des Mannes, der ihrer Ansicht nach im Irak wirklich das Sagen hat. In der Tat hatte Soleimanis Tätigkeit bis zur Krise 2013 mehr mit politisch-diplomatisch-nachrichtendienstlicher Koordination und Verhandlungsführung als mit militärischer Planung oder Kampfeinsätzen zu tun.
Von irakischer Seite wurden immer wieder trilaterale Gespräche zwischen Iran, Irak und den USA gefordert, denen die Amerikaner im Prinzip zustimmten. Die USA weigerten sich jedoch, Soleimani als Gesprächsführer zu akzeptieren, weil dies eine Aufwertung seiner Person und seiner Funktion bedeutet hätte und die USA Soleimani und die Qods-Einheit der Revolutionsgarden als Terrororganisation führen. Zwar kamen die Gespräche zustande, doch ohne Soleimani mangelte es den iranischen Gesprächspartnern an der nötigen Rückendeckung. Die USA forderten bei solchen Anlässen regelmäßig einen Stopp von Waffenlieferungen der Iraner an die Sondergruppen, die von der Qods-Einheit koordiniert wurden.
Viele Afghanen gingen nicht freiwillig nach Syrien, sondern wurden von den iranischen Behörden mit Drohungen und Versprechungen zum Eintritt in die »Fatemiyun«-Brigaden bewogen
Einmal, 2009, wandte sich der damalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Irak, David Petraeus, indirekt an Soleimani, indem er General Michael Barbero zu BadrChef Hadi Al-Amiri schickte. Damals stellten die amerikanischen Streitkräfte eine neue Eskalationsstufe der Angriffe seitens der Sondergruppen fest, die mit einer neuen Serie verbesserter und noch tödlicherer und effizienterer Wurfbomben ausgerüstet worden waren. Barbero ließ ausrichten, dass bei fortgesetzten Angriffen die USA noch energischer gegen alle Gruppen vorgehen und die von ihnen zum Zwecke der Abwehr iranischen Einflusses aufgebaute »Sondereinheit 17« der irakischen Polizei zum Einsatz bringen würden. Unmittelbar darauf gingen die Anschläge der Sondergruppen gegen amerikanische Ziele für ein Jahr lang merklich zurück.
Unter »Sondergruppen« verstehen die USA im weitesten Sinne alle Gruppen der »Mahdi-Armee«, die im Zeitraum 2003 bis 2011 gegen die Amerikaner kämpften, insbesondere aber jene, die sich 2008 nicht an das Einfrieren der militärischen Aktivitäten hielten, sondern ihre Angriffe auf die Koalitionskräfte und irakische Zivilisten fortsetzten. Ein weiteres verbindendes Merkmal ist ihre Abhängigkeit von der Führung in Teheran, deren strategische Interessen sie bedienen.
Badrund Qods-Elemente waren nach Ansicht der Amerikaner auch für Ausbildung und Waffenlieferungen aus Iran verantwortlich. Ein Teil der Sondergruppen soll außerdem in der Nähe Isfahans militärisch ausgebildet worden sein. General Petraeus betonte in diesem Zusammenhang Waffenlieferungen aus Syrien und die Rolle der libanesischen Hizbullah. Die Amerikaner vermuteten zudem eine zentrale Rolle der Hizbullah bei der Ausbildung der irakischen Schiiten. Dabei stützten sie sich auf ihnen zugänglich gemachte Aussagen gefangener Kämpfer von Sondergruppen, die von den Irakern und den Amerikanern in den Jahren 2006 bis 2008 verhört wurden. Demnach spielten die Libanesen vor allem als Ausbilder in iranischen Ausbildungslagern eine Rolle und waren in der Regel beliebter als die als arrogant empfundenen Iraner.
Die Libanesen spielen vor allem als Ausbilder in iranischen Ausbildungslagern eine Rolle und waren in der Regel beliebter als die als arrogant empfundenen Iraner
Weiter fortgeschrittene Kämpfer wurden direkt in den Libanon zur Ausbildung geschickt. Die Grundausbildung erfolgte jedoch stets im Irak. Talentiertere Kämpfer wurden dann legal oder illegal nach Iran geschickt, wo sie in verschiedenen militärischen Fächern wie Gefechtsformen, Grundlagen der Taktik, dem Einsatz spezieller Waffen wie Granatwerfer, improvisierte Sprengund Brandapparate, Wurfund Haftbomben sowie in Logistik und in Propaganda unterrichtet wurden. Diese Ebene schließt bereits mit einem Kurs ab, der aus den Absolventen Ausbilder macht. Bei weiterführenden Kursen werden die Herstellung und der Umgang mit Projektil bildenden Ladungen, Raketenund Werfertechnik, Taktik und Operation sowie Kleinkriegsführung unterrichtet. Auch von Kursen für den Einsatz der iranischen Strela-Raketen, Scharfschützenausbildung und Managementund Verwaltungskursen in Iran und im Libanon wird berichtet. Darüber hinaus legten die Iraner Waffenlager für die von ihnen unterstützten Gruppen an, die von den USA regelmäßig ausgehoben wurden. Und zu guter Letzt darf auch die politische Indoktrination nicht vergessen werden.
Diese Tätigkeiten entsprechen dem Auftrag, den Khamenei seinerzeit der Qods-Einheit gegeben hat, verlässliche Hizbullahi-Zellen aufzubauen: Die irakischen Freiwilligen werden von den Qods-Kräften und anderen Einheiten ausgebildet und zum selbstständigen Handeln angeleitet. Militärische Professionalisierung geht dabei mit ideologischer Festigung einher, sodass die Iraner sich auf die Fähigkeiten dieser von ihren eigenen Leuten geführten Gruppen auf dem Gefechtsfeld verlassen können.
Dass ausgerechnet das arabisch-sozialistische Syrien zum Schauplatz für einen konfessionellen Krieg werden konnte, kam für viele überraschend, war aber stets zu befürchten. Denn selbst zur Hochblüte des säkularen arabischen Nationalismus warfen sich die beiden verfeindeten baathistischen Schwesterparteien in Damaskus und Bagdad gegenseitig ihre Konfessionen vor. So sprach man in Bagdad vom »Alawitenklüngel, der unser muslimisches Volk bekämpft«, während Damaskus vor »der sunnitischen Tikriter Bande, die das große Unglück für unser schiitisch-muslimisches Volk ist«, warnte.
Von einer schiitischen Regionalpolitik der Syrer konnte selbst nach dem Ende des Iran-Irak-Krieges keine Rede sein, als das Bündnis mit Teheran in den Rahmen der Widerstandsachse gestellt wurde. Denn aus syrischer Sicht handelt es sich dabei um eine bilaterale Kooperation, bei der die für die Iraner so wichtige libanesische Hizbullah keinesfalls als gleichberechtigter Partner auftrat. Und die syrische Aussenpolitik blieb in ihren ideologischen Grundfesten arabisch-revolutionär und prinzipiell pragmatisch. Dennoch konnten auch die Syrer sich der Konfessionalisierung der machtpolitischen Konfrontationen im Nahen Osten nicht entziehen.
Der Beinahe-Zusammenbruch des Regimes 2015 veranlasste Russland zum militärischen Eingreifen. Seither hat sich das Blatt wieder zugunsten von Damaskus geändert. Mitverantwortlich dafür war massive militärische, wirtschaftliche und politische Unterstützung aus Teheran, aber auch aus dem Irak. Bagdad handelte jedoch nicht nur auf Anweisung Teherans, sondern wurde durch das Überschwappen des Krieges hineingezogen. Die Verknüpfung der beiden Kriegsschauplätze fand also schon vor dem Auftreten des IS statt. Die irakische Regierung unterstützte das Assad-Regime, indem sie den Iranern Überflugrechte für Waffenlieferungen nach Damaskus einräumte und gegen schiitische Freiwillige, die im Nachbarland kämpfen wollten, nichts unternahm. Vor allem die Duldung der iranischen Überflüge führte zu politischen Irritationen mit den Amerikanern, die bis heute ungelöst sind.
Iran unterstützt seinen strategischen Partner seit 2011 mit Militärberatern und Sonderkräften. Wie im Irak ist auch in Syrien General Soleimani für die Koordinierung zuständig, wobei ihm seine Vertrautheit mit der libanesischen Hizbullah zugutekommt. Die schiitischen Kämpfer aus dem Irak und aus anderen Ländern wurden von den Iranern und hierin wieder von der Qods-Einheit koordiniert. Teheran setzte vor allem auf den Einsatz vertrauenswürdiger schiitischer Milizen wie den Asaib Ahl Al-Haqq in Syrien. Schätzungen zufolge sollen um die 5.000 irakische Milizionäre bis 2014 in Syrien gekämpft haben. Die Verluste für die Iraker müssen schwer gewesen sein, einer Quelle zufolge sollen die Asaib 300 Mann im Kampf gegen die Nusra-Front verloren haben. Erst ab 2016 wurden Elemente der regulären iranischen Armee nach Syrien disloziert, nämlich von der 65. Luftlandedivision, die iranischen »Green Berets«, sowie Sondereinheiten der Revolutionsgarden.
Diese von Teheran aufgebaute schiitische Internationale half dem Assad-Regime Verluste auszugleichen, indem einzelne dieser Einheiten der syrischen Armee zur Verfügung gestellt wurden. Viele Beobachter gehen davon aus, dass die Iraner sich ihr Engagement nicht nur wirtschaftlich, sondern auch konfessionell entgelten lassen könnten. Gerüchten zufolge soll Baschar Al-Assad versprochen haben, die Bekehrung der Alawiten zur Zwölfer-Schia zuzulassen beziehungsweise zu fördern. Dass diese Gerüchte nicht unbegründet sind, beweist die historische Erfahrung: Die demografische Verteilung in einem Vorort von Damaskus hat sich aufgrund der schiitischen, insbesondere irakisch-schiitischen, Zuwanderung in den letzten Jahren tatsächlich stark verändert. Grund hierfür war die schiitische Infrastruktur des Sayyida-Zainab-Schreins.
Der gleichnamige Vorort Sayyida Zainab zählt ungefähr 150.000 Einwohner und befindet sich circa zehn Kilometer süd-östlich des Stadtzentrums von Damaskus in strategisch günstiger Lage auf dem Weg zum Flughafen. Syrische Einwohner von Damaskus besuchten den Ort selten und fanden die kulturelle schiitische Prägung durch die iranischen und irakischen Einwohner befremdlich. Die erste größere Ansiedlung tausender Iraker fand nach dem gescheiterten Aufstand gegen Saddam Hussein 1991 statt, eine zweite Welle folgte 2007. Nach dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs flohen die meisten ausländischen Schiiten, die sich in Syrien befanden, in das Viertel. Sayyida Zainab stand bald an vorderster Front gegen die syrische Opposition. Die Verteidigung wurde von der libanesischen Hizbullah und irakischen Kämpfern organisiert, aus denen die Abu-Fadl-Al-Abbas-Brigade hervorging. Dieser Widerstand verhinderte die Umzingelung der Stadt durch die oppositionellen Kräfte.
Die damit einhergehende schiitische Propaganda und die dementsprechende sunnitische Gegenpropaganda wahhabitischer und dschihadistischer Gruppen wurden als Beweis für die schiitische Natur der syrischen Außenpolitik herangezogen. Diese Entwicklung wurde von hochrangigen schiitischen Klerikern mit Sorge betrachtet. So warnte Großayatollah Ali Sistani in Nadschaf vor einer großen Gefahr für alle Schiiten in der Region, wenn noch mehr Glaubensbrüder nach Syrien in den Krieg zögen. Der irakische Prediger Muqtada Sadr forderte zwischenzeitlich gar Assads Rücktritt. Diese Stimmen konnten sich nicht durchsetzen, aber sie verstummten auch nicht mit der Aufstellung pro-iranischer schiitischer Milizen in Syrien. Das Zainabiyya-Heiligtum wurde zur Zentrale für eine »schiitische Internationale« der Milizen. Dabei fällt die landsmannschaftliche Zuordnung der Brigaden auf, die sich in arabische, afghanische und pakistanische Brigaden einteilen lassen.
Nach dem Ausbruch der Unruhen in Syrien wollten auch die Afghanen ihren Beitrag zum Schutz der Zainabiyya leisten. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Kämpfer hinzu, bis sie schließlich ein paar tausend zähl ten, die sich aus Afghanen aus Afghanistan, Iran und aus der kleinen afghanischen Gemeinde in Syrien zusammensetzten. Viele Afghanen gingen aber nicht freiwillig nach Syrien, sondern wurden von den iranischen Behörden mit Drohungen und Versprechungen zum Eintritt in die »Fatemiyun«-Brigaden bewogen. Die Afghanen scheinen große Anpassungsprobleme gehabt zu haben, vor allem, weil kaum einer von ihnen ausreichend Arabisch sprach. Ihre Verluste müssen sehr hoch sein, vor allem ihre Krankenversorgung muss vernachlässigt worden sein. Das erklärt jüngste Bemühungen, mit denen das iranische Regime betont, sich auch um die sozialen Anliegen der verwundeten Afghanen zu kümmern. Für die Hinterbliebenenfamilien macht sich besonders der gescheiterte iranische Präsidentschaftskandidat Ebrahim Raisi stark. Mithilfe großzügiger Wohnungsprojekte und Sozialeinrichtungen sollen diese in Maschhad angesiedelt werden. Offensichtlich plant Raisi, ein Klientelnetzwerk aufzubauen, vielleicht sogar nach dem Vorbild des Warlord-Modells.
Die »Fatemiyun« kämpfen mittlerweile auch im Irak und an der irakisch-syrischen Grenze, die sie offensichtlich von Bagdad aus Mitte Juni 2017 trotz Angriffen der Amerikaner erreicht hatten. Dort nahm sie Qasem Soleimani in Empfang. Mit dieser Operation sollte die Verbindung des irakischen zum syrischen IS unterbrochen werden. Auf iranischer Seite werden die Gefallenen der »Fatemiyun« (aus Afghanistan) und »Zainabiyun« (aus Pakistan) regelmässig öffentlich geehrt. Sofern Mitglieder der beiden Gruppen noch Verwandte in der Heimat haben, treten sie immer maskiert auf oder lassen ihre Gefallenen still beerdigen, um ihre Angehörigen nicht den Repressalien in der Heimat auszusetzen. Über sie wird nur gelegentlich in der einschlägigen iranischen Presse berichtet. Nur so viel steht fest: Sie betrachten den Kampf in Syrien und den Kampf gegen die Wahhabiten und andere sunnitische Eiferer in Pakistan als ein und dieselbe Auseinandersetzung.
Der Auftrag der Qods-Einheit lautet, überall auf der Welt ideologisch gefestigte, in der Bevölkerung verankerte Zellen aufzubauen und militärisch zu ertüchtigen
Die iranischen Behörden achteten genau darauf, dass bei den oben genannten Einheiten niemand mit iranischen Personaldokumenten dient. Iranische Freiwillige wurden genau beobachtet und in der Regel wurde nur erfahrenen Kriegsveteranen erlaubt, nach Syrien ins Gefecht zu ziehen. Freiwillige aus den Reihen der Bassidsch wurden im Rahmen der paramilitärischen Sondereinheit »Fatehin«, die eigentlich als Sicherungseinheit im Innern eingesetzt wird, nach Syrien geschickt. Im Oktober 2016 hatte diese Einheit bereits 30 Gefallene zu vermelden. Dasselbe gilt für die »Saberin«, die Sonderkräfte der Revolutionsgarden, die sowohl im Irak als auch in Syrien eingesetzt werden. Bei ihnen handelt es sich also um keine Freiwilligen im eigentlichen Sinne, sondern um reguläre Soldaten. Iranische Freiwillige findet man also nicht bei den schiitischen Milizen, sondern bei regulären Einheiten.
Dr. Walter Posch ist Historiker und Iranist. Seit Januar 2015 arbeitet er am Institut fuer Friedenssicherung und Konfliktmanagement (BLMVS) der Landesverteidigungsakademie in Wien.