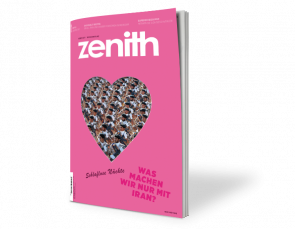Wer oder was ist eigentlich ein Libanese: Mehrere Hunderttausend Menschen im Libanon gelten als staatenlos. Sie dürfen nicht reisen, nicht legal arbeiten, nicht einmal ein Kraftfahrzeug anmelden. Was hat das mit Identität zu tun?
Der meistunterschätzte Besitz vieler Deutscher misst 88 mal 125 Millimeter und ist bordeauxrot-violett eingeschlagen. Der Reisepass, ein Büchlein im Viertelblatt-Format B7, dokumentiert unsere Herkunft und Identität, bezeugt Zugehörigkeit, gewährt Rechte, lässt Grenzen passieren, schützt vor staatlicher Willkür. Doch was uns selbstverständlich scheint, ist für viele Libanesen unerreichbarer Luxus.
»Manchmal möchte ich über meine Lage nicht mehr nachdenken.« Shadias trotziges Lächeln wirkt unsicher: »Das ist doch alles wie ein böser Traum.« Die gebürtige Libanesin ist Mutter eines kleinen Mädchens, und trotz ihrer kämpferischen Pose sitzt sie verzweifelt am Schreibtisch ihres Büros in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Denn die Tochter der Sekretärin ist quasi staatenlos, seit ihrem ausländischen Ehemann die Staatsbürgerschaft entzogen wurde.
Laut Vereinten Nationen ist ein Staatenloser eine Person, die »kein Staat aufgrund seines Rechtes als Staatsangehöriger ansieht«. Schuld an Shadias Situation ist ein juristisches Fossil aus Zeiten des Osmanischen Reichs, das im Libanon auch die französische Herrschaft überdauert hat. Denn während Nationalität üblicherweise qua Blutsverwandtschaft, Geburtsort oder einer Kombination aus beidem erlangt wird, regelt im Libanon ein Beschluss von 1925, dass die libanesische Staatsbürgerschaft nur vom Vater vererbt werden kann. Das Land ist damit eines von nur 27 weltweit und eines von zwölf in der MENA-Region, in denen Mütter ihre Nationalität nicht weitergeben können.
Shadia lernt ihren Mann im Libanon kennen, nach der Heirat in Beirut lassen sie ihre Ehe in seinem Heimatland registrieren. Woher ihr Mann stammt, will sie nicht veröffentlicht sehen, denn Jahre nach der Hochzeit wird ihr Mann wegen seiner politischen Arbeit ausgebürgert und ist bis heute zur Fahndung ausgeschrieben. Alle Versuche, der gemeinsamen Tochter einen Pass zu verschaffen, scheitern. »Die Beamten sagen, dass sie dann auch alle Palästinenser einbürgern müssen und dass das nicht geht«, schüttelt die Mutter ungläubig den Kopf. »Jetzt ist meine Tochter staatenlos und ich muss jedes Jahr eine Aufenthaltserlaubnis für sie beantragen. Dabei ist sie doch hier geboren.«
So tragisch Shadias Geschichte ist, das Schicksal ihrer Tochter ist kein Einzelfall. In Nordafrika und dem Nahen Osten leben laut Schätzung des UN-Flüchtlingswerks UNHCR rund 375.000 staatenlose Menschen; Palästinenser und staatenlose Flüchtlinge nicht eingerechnet. Für den Libanon gibt es keine genauen Zahlen, Schätzungen schwanken zwischen 80.000 und 200.000 Betroffenen.
Die Schwierigkeiten beginnen bereits mit der Gründung des Staates, in dem mehr als ein Dutzend anerkannte Religionsgemeinschaften miteinander leben. Bei der zweiten und bis heute letzten Volkszählung 1932 wurde unter französischer Aufsicht ein Drittel der Bevölkerung als maronitische Christen erfasst, 18 Prozent als sunnitische und 16 Prozent als schiitische Muslime. Seitdem stellen Libanesen maronitischen Glaubens zusammen mit armenischen, griechisch-orthodoxen, protestantischen und anderen Christen offiziell eine knappe Mehrheit. Der libanesische Nationalpakt von 1943 weist die wichtigsten Staatsämter dabei einzelnen Religionsgemeinschaften zu. So stellen Christen traditionell das Staatsoberhaupt, schiitische Muslime den Parlamentspräsidenten und sunnitische Muslime den Regierungschef.
Noch heute, 85 Jahre nach der letzten großen Volkszählung, wird die Macht auf Grundlage dieser Zahlen geteilt. Entsprechend groß ist die Angst, dass ein neuer Zensus die konfessionelle Machtverteilung infrage stellen könnte, und so reagiert das Establishment des Landes sensibel auf alle Entwicklungen, die das fragile Konstrukt aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass sich die konfessionelle Struktur des Landes seit 1932 drastisch verändert hat. So veröffentlichte der britische Economist im vergangenen Jahr Regierungsunterlagen, in denen der Anteil christlicher Wähler auf gerade einmal 37 Prozent geschätzt wird. Die Maroniten, einst größte Glaubensgemeinschaft des Landes, machen demnach noch 21 Prozent der Bevölkerung aus, während der Anteil von Schiiten (29 Prozent) und Sunniten (28 Prozent) deutlich gestiegen ist. Es überrascht dann auch nicht, dass der bislang letzte Versuch, den Status zahlreicher Staatenloser zu klären, bis heute heftig umstritten ist. In einer Ad-hoc-Initiative wurden 1994 bis zu 200.000 Menschen, überwiegend Kurden und Beduinen, eingebürgert. Kritiker sprechen von einer Manipulation der libanesischen Demografie; denn anders als im Zensus von 1932 wurden dieses Mal Muslime bevorzugt.
»Demographobie« lautet die Diagnose von Professor Nasser Yassin angesichts dieses Eiertanzes. Der Politologe von der American University in Beirut meint damit die Angst, dass Beduinen, Kurden, Palästinenser oder Syrer den Status quo untergraben. »Wir müssen dieses System der Machtverteilung dringend überdenken«, sagt er und rückt seine markante rote Brille zurecht. Der Forschungsdirekter guckt aus seinem Büro im obersten Stock des von Zaha Haddid entworfenen »Issam Fares Institut für Public Policy« auf das müde schwappende Mittelmeer. Es ist ein Gebäude, das mit seinem konsequenten Mangel an rechten Winkeln die Meinungen ähnlich spaltet wie Yassins politische Analyse: »Leider zeigt der Trend in die entgegengesetzte Richtung.«
Yassin sieht diese Überbetonung konfessioneller Aspekte in der gesamten Region auf dem Vormarsch: »Im Irak, in Syrien und zu einem gewissen Grad auch in Ägypten und im Jemen wird das libanesische Modell zunehmend populär«, seufzt Yassin. Diese Libanonisierung des Nahen Ostens bedeutet eine auf Identität zugespitzte Politik, die die Ausgrenzung vermeintlich oder tatsächlich fremder Menschen begünstigt. So entstehen Ressentiments, mit denen sich im Libanon Wahlen gewinnen lassen. Das gelang etwa dem Ende 2016 gewählten Staatschef Michel Aoun, der seinen Anhängern versprochen hatte, die syrischen Flüchtlinge möglichst schnell loszuwerden. So wird eine Ausgrenzung salonfähig, die ihre ultimative Zuspitzung in der hohen Zahl Staatenloser und von Staatenlosigkeit bedrohter Menschen in der Region erfährt. Mit gravierenden Folgen: Staatenlose dürfen im Libanon nicht arbeiten, sind nicht krankenversichert, können nicht auf staatliche Schulen gehen und nicht studieren, sie dürfen kein Auto registrieren und keinen Grund und Boden erwerben. »Als wir 2006 begannen, uns mit Staatenlosigkeit zu befassen, wussten viele Libanesen nicht einmal, was das ist«, fasst Samira Trad die frühen Jahre ihrer Arbeit zusammen.
Die Libanonisierung des Nahen Ostens bedeutet eine auf Identität zugespitzte Politik, die Ausgrenzung begünstigt
»Wir mussten Anwälte, Hebammen, Politiker, Ärzte und Gemeindevorsteher erst einmal aufklären.« Wohl niemand im Land kennt die juristischen Feinheiten und Fallstricke des Staatsbürgerrechts besser als Trad. Die Anwältin sitzt hinter ihrem Schreibtisch – Zigaretten, Handy und Autoschlüssel stets in Griffweite – und spricht mit der Robustheit eines Menschen, der in seinem Leben mehr als einen Kampf geführt hat. Die Aktivistin berät heute die libanesische NGO »Frontiers Rights«, die zu Migration und Staatenlosigkeit forscht, publiziert und in Einzelfällen auch juristische Unterstützung bietet.
Derartige Unterstützung vor Gericht sei durchaus erfolgversprechend, so Trad, etwa wenn Eltern die Registrierung ihres Kindes schlicht versäumt haben. Und es gibt viele solcher Fälle, denn beim Zensus von 1932 wurden viele im Land lebende Kurden übergangen, andere auf dem Staatsgebiet lebende Menschen lediglich als »Fremde« registriert und viele Beduinen im syrisch-libanesischen Grenzgebiet einfach übersehen. Einige nomadisch lebende Libanesen begriffen auch schlicht die fundamentale Bedeutung der Volkszählung nicht oder stellten sich in Opposition zu der als französisches Kolonialprojekt wahrgenommenen Zählung. All diese Faktoren führten dazu, dass insbesondere Menschen muslimischen Glaubens nicht erfasst wurden.
So ist bereits in der Gründung des modernen Libanon ein demografischer Konflikt angelegt, der durch mehrere Ereignisse verschärft wurde: die Gründung Israels 1948, den Sechstagekrieg 1967, den libanesischen Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 und den Beginn des Kriegs in Syrien 2011. Während der Zustrom hunderttausender palästinensischer Flüchtlinge infolge der ersten beiden Ereignisse die arabische Solidarität auf die Probe stellte, vergifteten anderthalb Jahrzehnte Krieg im eigenen Land das gesellschaftliche Klima im Libanon. »Viele Menschen machen die Palästinenser für den Bürgerkrieg verantwortlich«, resümiert Professor Yassin. »Das ist so natürlich Unfug, aber das muss man wissen, wenn man heute über die Flüchtlinge im Land spricht.« Und deren Lebensumstände sind hart, wie die palästinensischen Slums in Beirut und anderen Städten des Lands bezeugen.
Schatila ist das Zentrum der palästinensischen Parallelgesellschaft
Das Labyrinth aus Schatilas Gassen ist für Fremde undurchdringlich. Links, rechts, links. Zwei Ecken weiter mündet der Weg wieder in die Hauptstraße. Auf Boden und Wände des Stadtviertels im Westen Beiruts zeichnet die Mittagssonne versponnene Schatten. über den Köpfen seiner zehntausenden Bewohner verbinden verworrene Stromleitungen alles und nichts. An den Wänden hängen Märtyrer-Porträts von im Kampf gegen Israel gestorbenen Palästinensern, die den Alltag der Lebenden beobachten. Wer im Widerstand sein Leben lässt, findet hier Verehrung. Politik und Kampf sind gegenwärtig. Hamas, Fatah und andere Organisationen unterhalten hier Büros, vor den Türen wachen junge Männer mit Kalaschnikows.
Der unwirkliche Ort ist ein Zentrum der palästinensischen Parallelgesellschaft im Land und das Sinnbild einer libanesischen Malaise. Auch Mahmud Abbas, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, kapitulierte 2009 bei einem Staatsbesuch und erklärte entgegen jeder realistischen Erwartung, der Aufenthalt seiner Landsleute sei zeitlich begrenzt und man müsse sich deshalb auch nicht um libanesische Pässe bemühen. Libanesischen Politikern sprach er damals aus dem Herzen, denn die hatten den geflohenen Palästinensern und deren Kindern schon lange vor dem Bürgerkrieg sowohl die Staatsbürgerschaft als auch gleiche Rechte versagt, wie sie etwa das 1965 von der Arabischen Liga ausgehandelte und vom Libanon ratifizierte »Casablanca-Protokoll« vorsieht. In Schatila wird deutlich, dass Herkunft und Abstammung in dem kleinen Mittelmeeranrainer die entscheidenden politischen Währungen sind.
In diese ohnehin schwierige Situation stolperten vor wenigen Jahren dann hunderttausende flüchtende Syrer. Sie haben den kleinen Libanon mit seinen rund viereinhalb Millionen Einwohnern zum Land mit der höchsten Pro-Kopf-Quote an Flüchtlingen gemacht. Und obwohl die allermeisten Syrer im Libanon eine Staatbürgerschaft besitzen, sind viele der Flüchtlinge und vor allem ihre Kinder mittelfristig von Staatenlosigkeit bedroht, wenn sie ihre Herkunft entweder nicht mit gültigen Dokumenten belegen können oder ihre Geburt auf libanesischem Boden niemals registriert wurde.
Anas Tello kennt die Probleme der Geflüchteten aus eigener Erfahrung: »Bei der syrischen Botschaft haben sie mir erst nach stundenlangem Warten für 300 US-Dollar einen neuen, lediglich zwei Jahre gültigen Pass ausgehändigt«, berichtet der 28-jährige ehemalige Architekturstudent aus Damaskus, der im Libanon mittlerweile für »Women Now For Development« arbeitet. Die 2012 in Paris von einer im Exil lebenden syrischen Journalistin gegründete NGO versucht im Libanon und Syrien die Situation von Frauen zu verbessern. »Anders als ich haben viele Flüchtlinge aber Angst, zur Botschaft zu gehen. Die libanesische Armee hat überall Kontrollpunkte eingerichtet, und wenn die Soldaten dich ohne Aufenthaltsgenehmigung erwischen, weißt du nie, was passiert«, fasst er das Dilemma zusammen. »Viele Syrer haben alles verloren, insbesondere direkt an der Grenze, wo die ärmsten wohnen. Und wer keine Papiere hat, verlässt die Lager aus Angst vor Militärkontrollen nicht.«
Verlorene oder ungültige Pässe machen das Leben schwierig, noch problematischer wird es aber, wenn nicht einmal die Geburt eines Menschen registriert wird. Die libanesische Bürokratie sieht dafür einen komplexen mehrstufigen Prozess vor, der innerhalb eines Jahres nach Geburt abgeschlossen sein muss und an dem viele Flüchtlinge scheitern. So schätzt das UNHCR, dass rund 70 Prozent aller seit Kriegsbeginn im Libanon geborenen Kinder syrischer Flüchtlinge nicht registriert sind. »Wie sollen denn die Neugeborenen zurück nach Syrien kommen ohne Papiere?« Anas ist wütend über die verfahrene Situation. »In wenigen Jahren wird es eine ganze Generation ohne Dokumente geben. Sind das dann Syrer oder Libanesen?«
Wie viele Experten hält der junge Aktivist insbesondere die Voraussetzung der mit umgerechnet rund 200 US-Dollar je Person und Jahr enorm teuren Aufenthaltsgenehmigung für eines der größten Hindernisse bei der Registrierung. Doch zumindest hier scheint sich die libanesische Regierung zu bewegen. Am Ende, so berichten mit den Verhandlungen vertraute Personen, war eines der entscheidenden Argumente erstaunlich simpel: Wenn wir die Flüchtlinge irgendwann wieder loswerden wollen, müssen wir schon bei der Geburt ihre syrischen Wurzeln dokumentieren. Es ist bezeichnend, dass gerade dieses Argument verfing.
Doch ob selbst registrierte Kinder später von der syrischen Regierung anerkannt werden und einen Pass erhalten, steht in den Sternen. Denn auch nach syrischem Recht kann nur der Vater die Staatsbürgerschaft an seine Kinder weitergeben, und unbestätigten Gerüchten zufolge hat die syrische Regierung zehntausende Männer in Abwesenheit ausgebürgert; was ihre seitdem geborenen Kinder ebenfalls zu Staatenlosen machen würde. Drängender ist jedoch die Tatsache, dass mehr als 80 Prozent aller syrischen Flüchtlinge im Libanon entweder Kinder oder Frauen sind. Ihre Männer, Söhne und Brüder sind in Gefängnissen des Assad-Regimes verschwunden, im Krieg gefallen oder aus anderen Gründen von ihren Frauen getrennt worden.
»Für eine Mutter ist es fast besser, vom Tod ihres Kindes zu erfahren, als vermuten zu müssen, dass es in einer Zelle sitzt.« Amina Khalawni knetet ihre Hände, als die Erinnerungen an die Folterzentren des Assad-Regimes zurückkehren. Die Syrerin war selbst für einige Monate inhaftiert, später flüchtete sie aus ihrer Heimat. Heute ist Amina Teil der Kampagne »Families For Freedom«, mit der sie mit anderen Frauen für die Freilassung zehntausender inhaftierter Zivilisten, darunter sehr viele Männer, kämpft: »Wir wollen wissen, wer in welchem Gefängnis sitzt, wer noch lebt und wo sie die Toten vergraben haben. Und wenn wir das endlich wissen, dann wollen wir mit denen, die noch leben, sprechen und sie besuchen dürfen.«
Amina kennt viele schwangere Syrerinnen, die ohne Ehemann flüchten mussten. Das Leben der zerrissenen Familien im Exil ist hart, berichtet sie, denn zu der enormen psychologischen Belastung kommen zahlreiche andere Probleme. Viele der Frauen haben nie Geld verdient, sind nun auf sich allein gestellt und mit der libanesischen Bürokratie überfordert: »Wer keine Papiere hat, existiert nicht. Am schlimmsten ist aber, dass man ohne Papiere nicht legal arbeiten kann. Und wenn die Behörden dich ohne Ausweis erwischen, kommst du in Teufels Küche.« Ob die überwiegend nicht registrierten Kinder dieser alleinerziehenden Frauen irgendwann aufgrund ihrer Abstammung die syrische oder aufgrund ihres Geburtsorts die libanesische Staatsbürgerschaft erhalten, ist ungeklärt. Zehntausenden droht eine Existenz zwischen allen Stühlen, selbst wenn sie das momentane Elend irgendwie überstehen.
Zehntausenden syrischen Flüchtlingen droht eine Existenz zwischen allen Stühlen
Dabei ist die Diskriminierung alleinerziehender Frauen selbst nach libanesischem Recht unzulässig. Nicht nur regelt Artikel 7 der Verfassung die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz, auch der Beschluss zur Weitergabe der Nationalität kennt einen regelmäßig unterschlagenen Zusatz: Denn dort heißt es im Einklang mit dem Völkerrecht, dass der Geburtsort durchaus entscheidend ist. Nämlich dann, wenn das Kind ansonsten staatenlos wäre. »Viele Betroffene wissen aber nichts von dieser Regelung oder können sich keinen Anwalt leisten«, ist Aktivistin Samira Trad entrüstet. »An der juristischen Fakultät wird Staatsangehörigkeitsrecht überhaupt nicht gelehrt! In mehreren Gerichtsverfahren argumentieren wir jetzt mit dieser Klausel und hoffen, einen Präzedenzfall zu schaffen.«
Ohne derartige juristische Unterstützung bleibt es für viele Frauen und ihre Kinder aber ein großes Unglück, wenn die Väter nicht bekannt oder nicht anwesend sind, wenn sie keine Nationalität besitzen oder sie nicht nachweisen können. Frauen wie Amina, Samira und Shadia sind sich dieser Diskriminierung deutlich bewusst. Die Fälle einer libanesischen Frau mit ausgebürgertem Ehemann und die einer alleinerziehenden syrischen Mutter im Exil sind zwar nicht identisch, doch sie eint die Sorge um die Zukunft ihrer Kinder. Sie sind der Kollateralschaden der fragilen politischen Balance im Libanon und teilen dieses Schicksal mit vielen Kurden, Beduinen und Palästinensern; einige davon bereits im juristischen Limbus der Staatenlosigkeit, andere akut davon bedroht.
Aber sie teilen noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie bauen informelle Netzwerke auf, arbeiten in der Schattenwirtschaft, nutzen persönliche Kontakte, um ihre Kinder auf Umwegen in staatlichen Schulen Bildung zu ermöglichen, zahlen zwielichtigen Gestalten viel Geld in der Hoffnung auf einen ausländischen Pass und überqueren die Grenze bei Nacht, wenn das Krankenhaus im Nachbarland günstiger ist. Sie leben parallele Realitäten, bilden parallele Gesellschaften. Sie finden Wege.
Die Recherche zu dieser Reportage wurde finanziell vom Migration Media Award unterstützt, einem Projekt der Europäischen Union. Die hier genannten Einschätzungen sind die des Autors und spiegeln nicht die offizielle Haltung der EU und ihrer Mitglieder wider.