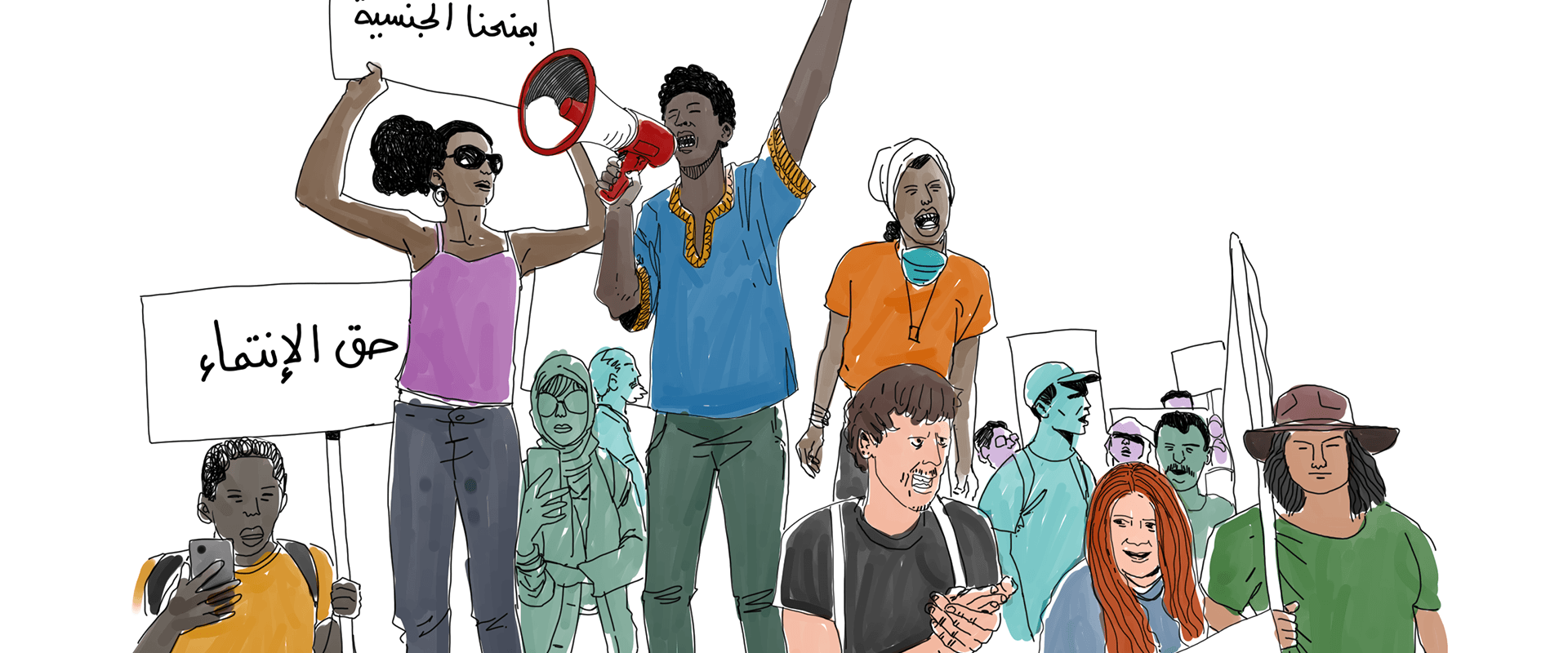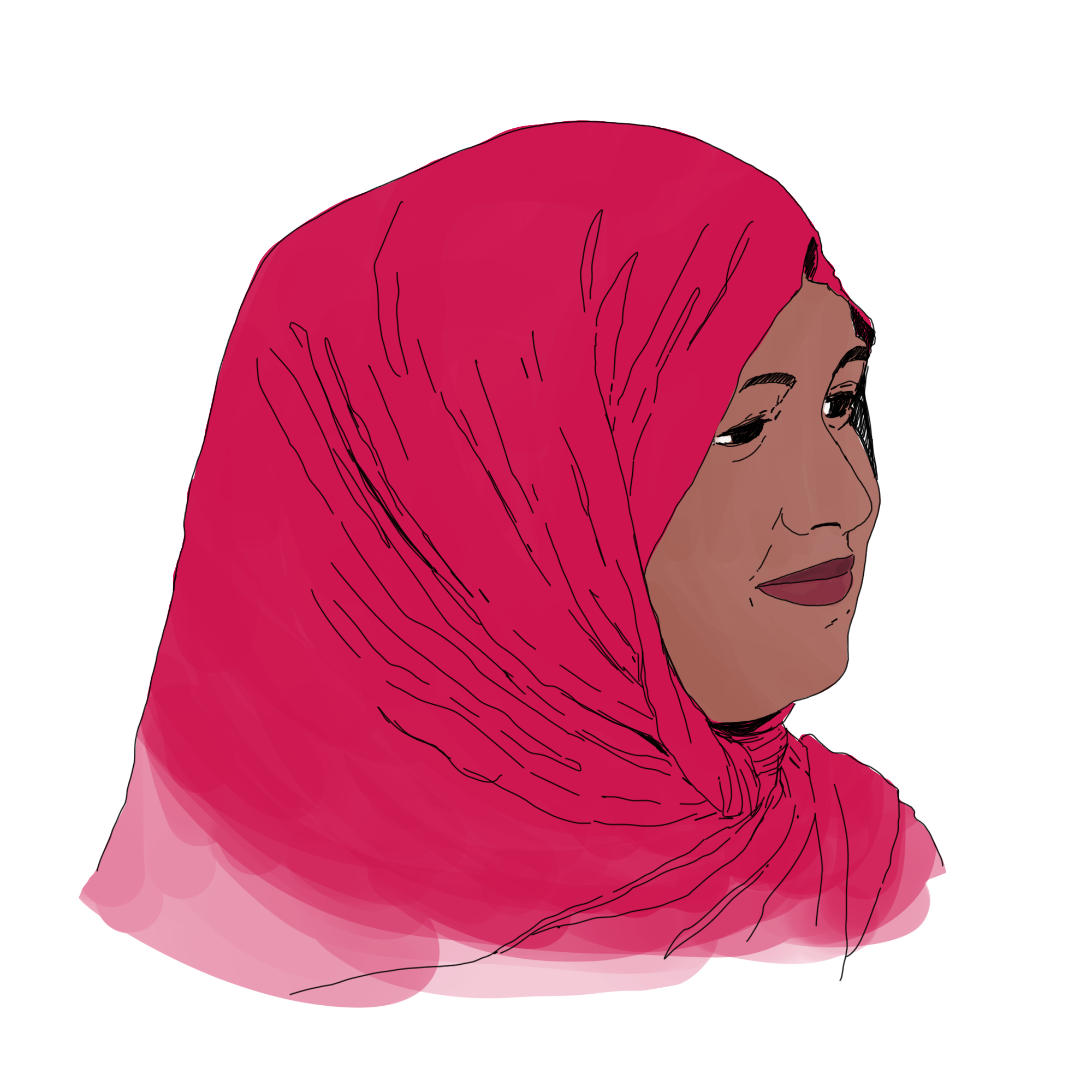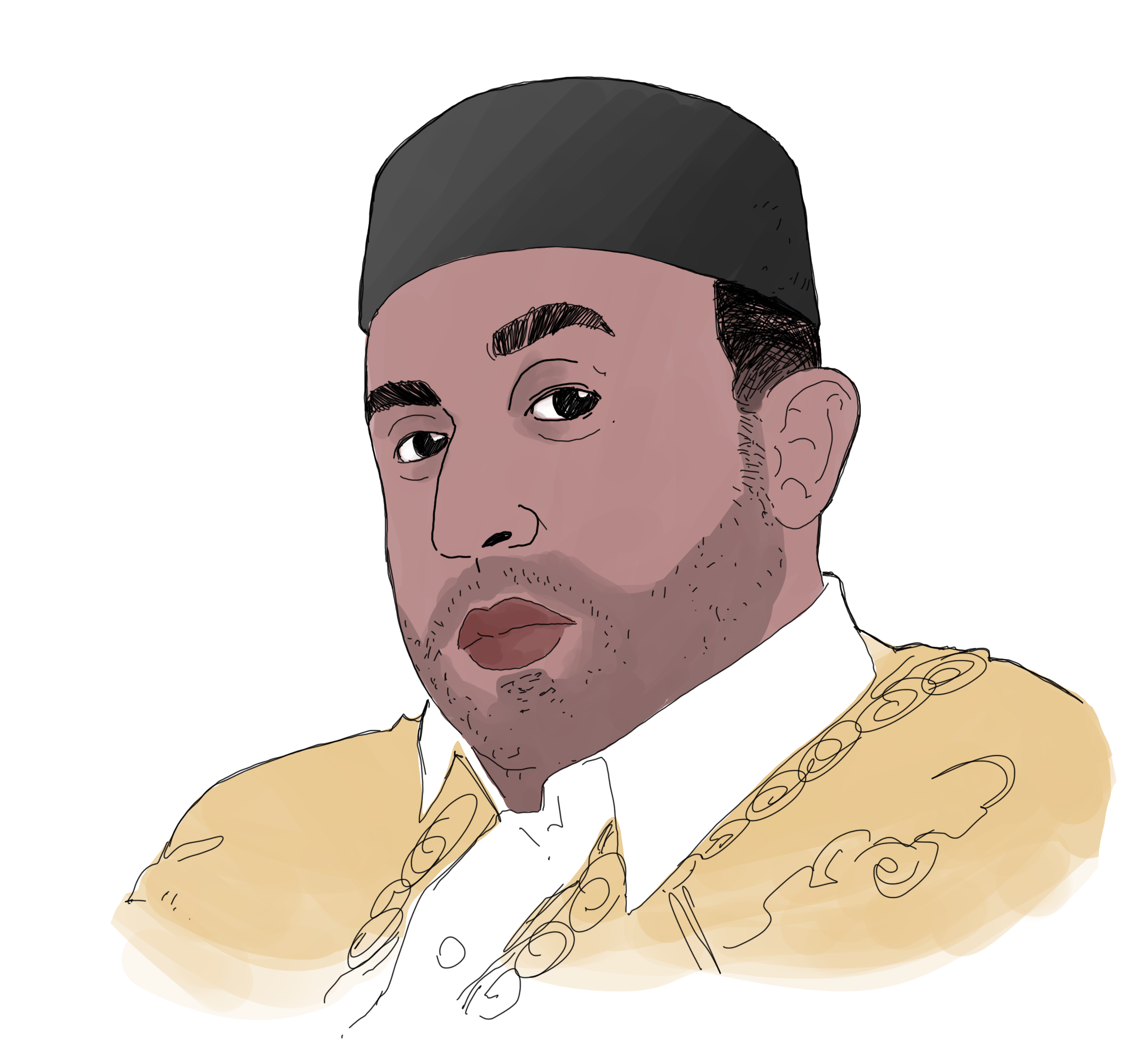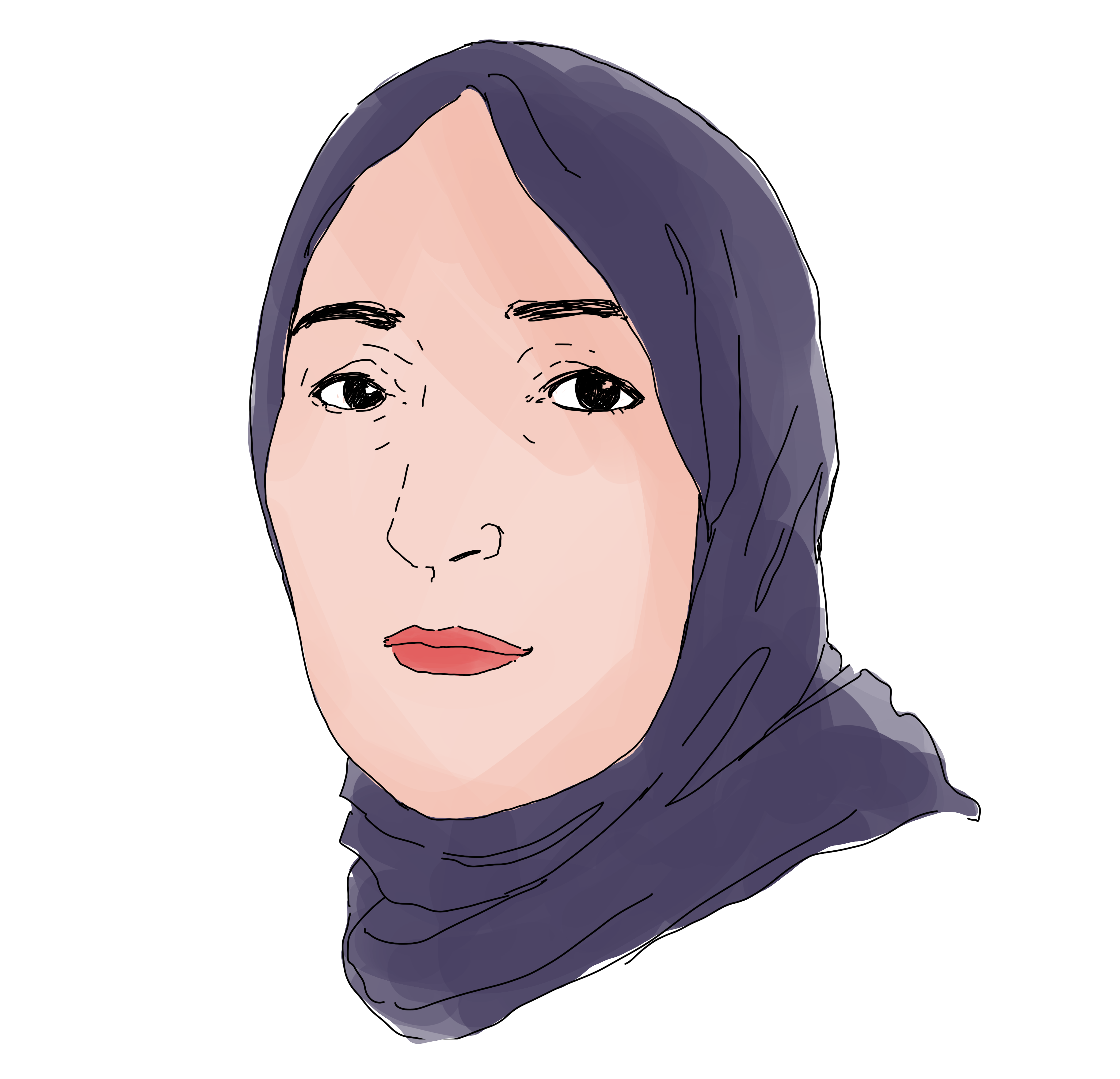In Libyen leben Zehntausende Staatenlose. Aufeinanderfolgende Regierungen stellen ihnen seit Jahrzehnten die Staatsbürgerschaft in Aussicht – und machen alles immer komplizierter.
Die Familie des 54-jährigen Lehrers Yousef Abdulkarim kommt ganz aus dem Süden Libyens. Hier, direkt an der Grenze zum Tschad, im Munizip Kufra, liegt die kleine Oase Worouy. Obwohl die Region offiziell innerhalb Libyens liegt, übergingen die Volkszählungen von 1954 und 1964 sie völlig. »Die Zensus-Komitees haben unsere Gegend nie erreicht, weshalb meine Familie schlicht nicht registriert wurde«, erzählt Abdulkarim.
Die Volkszähler erfassten zwar zentralere Regionen in Südlibyen, ignorierten jedoch weiter abgeschiedene Gegenden wie die südlichen Wadis in Kufra und Uweinat. Dass sie schlicht nicht wussten, ob tatsächlich Menschen in diesen Gebieten lebten und wo oder wie sie zu finden waren, erleichterte ihre Arbeit sicherlich nicht.
Nichtsdestotrotz gelang es Abdulkarims Familie im Jahr 1975, in das Bezirksregister von Kufra aufgenommen zu werden – nur ließ der Staatsanwalt dieses Verzeichnis zwei Jahre später auflösen, wodurch 43 Familien wieder staatenlos wurden. Und obwohl diese Entscheidung bereits eine Woche später widerrufen wurde, weigerte sich die lokale Zweigstelle der Zivilstandsbehörde, die Familien wieder in das Bürgerregister aufzunehmen.
»Die Volkszähler haben unsere Gegend einfach nie erreicht«
Aber Abdulkarim wollte nicht aufgeben. Er verklagte die Zivilstandsbehörde – und bekam Recht. Doch auch der Entscheidung des Gerichts begegneten die zuständigen Autoritäten mit Widerwillen. Abdulkarim kämpft weiter: »Ich werde nicht aufhören, für meine Rechte und die Gerechtigkeit einzutreten.«
Mehr als zehn Millionen Menschen rund um den Globus sind staatenlos, so die Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Einige Regierungen schließen sogar absichtlich Teile ihrer Bevölkerung von der Staatsbürgerschaft aus – mal aufgrund ethnischer oder religiöser Diskriminierung, mal wegen zwischenstaatlichen Konflikten oder Grenzverschiebungen, und mal wegen der Unfähigkeit, wirklich alle Bewohner des Landes zu erfassen.
Das betrifft auch viele Menschen in Libyen. Manche haben ihre Staatsbürgerschaft verloren, andere nie eine besessen. Und das, obwohl viele von ihnen schon immer in Libyen leben. Offizielle Zahlen zu Staatenlosen gibt es zwar nicht, aber Schätzungen gehen von zwischen 40.000 und 60.000 Betroffenen in Libyen aus.
Khadija Aendedy ist 35 Jahre alt. Sie ist Architektin und Frauenvertreterin im Obersten Rat der libyschen Tuareg – genießt aber nicht die vollen Rechte der libyschen Nationalität. Noch immer gilt sie als »vorübergehende Bürgerin«.
Im Jahr 1971 errichtete das Innenministerium gemäß Resolution 193 ein temporäres Bürgerregister als eine Art Warteliste für diejenigen, deren Status erst noch geprüft werden müsse. Manche nannten es das »Rückkehrregister«, denn eigentlich handelte es sich um eine Liste derer, die erst nach der Volkszählung nach Libyen zurückgekehrt waren, aber noch nicht die notwendigen bürokratischen Verfahren durchlaufen hatten, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen – so auch Aendedys Familie.
Dabei ist Aendedy in Libyen geboren und aufgewachsen. Sie versteht sich durch und durch als Libyerin und hat das Land noch kein einziges Mal verlassen. Es bricht ihr das Herz, dass sie immer noch nicht als vollwertige Bürgerin ihres Landes gilt: »Wir sind Libyer und sollten die gleichen Rechte wie alle anderen haben. Aber der Staat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse.« Wie auch die anderen Mitglieder ihrer Familie, die im temporären Bürgerregister vermerkt sind, hat sie noch nicht einmal eine nationale Identitätsnummer.
»Der Staat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse«
Stattdessen wurde ihr eine sogenannte »Verwaltungsnummer« zugeteilt – ein Parallel-System, das 2013 eingeführt wurde, nachdem eine Tuareg-Gruppe aus Protest das Al-Sharara-Ölfeld im Südwesten des Landes stillgelegt hatte. Sie forderten die Klärung ihres rechtlichen Status und wollten endlich offiziell libysche Bürger werden.
Als Reaktion vergab die Regierung erst einmal vorläufige Verwaltungsnummern. Die sollten vorübergehend einfache Prozesse wie die Zahlung von Gehältern ermöglichen. Diese Nummern sind aber eben keine nationalen Identitätsnummern – grundlegende Bürgerrechte werden ihren Trägern weiterhin verwehrt.
Sie dürfen nicht reisen, keine staatlichen Schulen besuchen, können sich nicht in öffentlichen Krankenhäusern behandeln lassen und Banken verweigern ihnen die Eröffnung eines Kontos. Aendedy hält daher wenig von den Verwaltungsnummern: »Sie haben uns diese Nummern nur gegeben, um uns zum Schweigen zu bringen«.
Dabei kann sie nicht nur eine Familienregistrierungsnummer vorweisen, sondern auch alle Papiere, die nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz erforderlich sind, um libysche Bürgerin zu werden – wie so viele andere Tuareg, die immer noch im temporären Bürgerregister stehen. Doch schon seit Muammar Al-Gaddafis Tagen wird Aendedys Akte von einer Regierung an die nächste weitergereicht – genau wie die leeren Versprechen einer baldigen Staatsbürgerschaft.
Aendedy ist überzeugt, dass dieses Aufschieben hauptsächlich im Rassismus gegen Tuareg und Tubu begründet liegt. Und daran, dass die jungen Männer aus diesen Volksgruppen für militärische Zwecke ausgenutzt werden sollen: »Arbeiten dürfen sie ohne eine nationale Identitätsnummer nicht. Aber um an der Front zu kämpfen, brauchen sie die nicht.«
Gaddafi versprach jungen Tuareg die Staatsbürgerschaft. Dadurch gelang es ihm, viele von ihnen für seine Brigaden zu rekrutieren. Sein Versprechen löste er allerdings nicht ein. Am Ende bekam nur ein kleiner Kreis von Kämpfern in der Khamis-Brigade, angeführt und benannt nach Gaddafis jüngstem Sohn, auch wirklich die libysche Nationalität zugesprochen.
Auch nach dem Sturz des Regimes im Jahr 2011 wurden die jungen Tuareg weiter militärisch ausgebeutet. Verschiedene Bürgerkriegsfraktionen versuchten sie anzuwerben. Aendedy beobachtet das mit Sorge: »Sie locken unsere Jugend mit Geld. Sie fragen die jungen Männer, was sie denn überhaupt mit der Staatsbürgerschaft wollen. Kämpft doch mit uns und nehmt lieber das Geld, heißt es dann immer.«
Das System der Verwaltungsnummern hätte den Betroffenen eigentlich helfen sollen. Aber in Wirklichkeit verschlechterte sich die Situation nur weiter, insbesondere nach 2014. Selbst im temporären Bürgerregister konnten nicht einmal mehr Geburten oder Todesfälle eingetragen werden. Wer heiratete, konnte keine eigene Familie mehr registrieren lassen. Alle Neugeborenen von Eltern, die nur im temporären Verzeichnis stehen, kommen dadurch staatenlos auf die Welt.
Im August 2018 wandte sich Mohammed Beltamer, der Direktor der Zivilstandsbehörde, mit einem Brief an die Leiter der lokalen Zweigstellen: Er forderte sie auf, ihm eine Übersicht der im temporären Bürgerregister verzeichneten Familienakten zur Verfügung zu stellen. In seinem Schreiben gab er zu, dass sich das »Rückkehrregister« von einer Zwischenlösung für Menschen, die ihre »libysche Herkunft« nachweisen wollten, unbeabsichtigt in eine dauerhafte Alternative zum Zivilstandsregister verwandelt habe.
Bemerkenswerterweise verwendet Beltamer den Begriff »libysche Herkunft«. Diese Formulierung findet sich nicht im Staatsangehörigkeitsgesetz des Landes von 2010. Dort heißt es in Artikel 2:
»Eine Person gilt als libysch […], wenn sie am 10. Juli 1951 regulär in Libyen ansässig war und keine fremde Staatsbürgerschaft besaß, sofern sie eine der folgenden Bedingungen erfüllte: (a) Sie wurde in Libyen geboren. (b) Sie wurde außerhalb Libyens geboren, aber einer ihrer Elternteile wurde in Libyen geboren. (c) Sie wurde außerhalb Libyens geboren, war aber vor dem 10. Juli 1951 für mindestens zehn aufeinanderfolgende Jahre in Libyen ansässig.«
Das Gesetz macht unmissverständlich deutlich, dass alle, die vor 1951, dem Jahr der Unabhängigkeit, in Libyen lebten und keine andere Staatsangehörigkeit besaßen, Libyer sind. Viele der Menschen, deren Status immer noch in der Schwebe hängt, haben demnach ein zweifelsfreies Recht auf die libysche Nationalität. Der Begriff von einer »libyschen Herkunft« hingegen entzieht sich diesem Verständnis und eröffnet einen weiten Interpretationsspielraum.
Beltamer willigte zwar für ein Interview mit zenith ein, um persönlich Stellung zu diversen Anschuldigungen gegen seine Behörde und zu seinem Begriff der »libyschen Herkunft« zu nehmen, meldete sich daraufhin allerdings mehrere Monate lang nicht mehr.
»Wir können die Staatsbürgerschaft nicht einfach willkürlich vergeben«
Unabhängig davon kontaktierte zenith auch den Ausschuss der libyschen Zivilstandsbehörde, der für das System der Verwaltungsnummern verantwortlich zeichnet. Auf Fragen nach der Wirksamkeit des Systems und seines Nutzens für Betroffene antwortete der Ausschussvorsitzender Tareq Qweder kurz angebunden.
Er betont vor allem die schwierigen Umstände seiner Arbeit: Er habe kaum Handlungsspielraum und sehe sich vielen Schwierigkeiten und sogar ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt; es fehle ihm an Unterstützung und finanziellen Mitteln seitens der Regierung; alle Bemühungen würden auf seiner eigenen Initiative beruhen; er habe nicht einmal Anspruch auf Unterbringungs- oder Gefahrenzulagen für seine Arbeit im Süden.
Außerdem fügt er hinzu, das ganze Chaos sei von denjenigen ausgelöst worden, die in mehreren Zweigstellen gleichzeitig Anträge gestellt und damit die Fallbelastung unnötig aufgebläht hätten. Das habe die Arbeit des Ausschusses zusätzlich erschwert. »Die Zivilstandsbehörde hat keinerlei Absicht, den Prozess zu behindern«, erklärt Qweder.
Er argumentiert, es handle sich hierbei um eine »Angelegenheit der nationale Sicherheit und territorialen Integrität. Daher können weder die Zivilstandsbehörde, noch der Ausschuss für Verwaltungsnummern allein auf die Aussagen der Betroffenen vertrauen oder die Staatsangehörigkeit willkürlich vergeben.« Schlussendlich räumt er jedoch ein, dass der fehlende politische Wille und die fehlende Verfassungsgesetzgebung das Problem verschärfen und eine dauerhafte Lösung erschweren.
Elf Jahre lang, zwischen 1978 und 1987, kämpften Libyen und der Tschad um den sogenannten Aouzou-Streifen entlang des gemeinsamen Grenzgebiets. Um den Konflikt beizulegen, riefen die beiden Länder schließlich den Internationalen Gerichtshof an – der gab 1994 dem Tschad Recht. Libyen befolgte das Urteil.
Zwei Jahre später verkündete das Generalsekretariat des libyschen Allgemeinen Volkskongresses jedoch im Rundschreiben Nummer 13, dass alle Geburtenregister des Aouzou-Streifen abgeschafft und alle Bewohner, ehemalige und gegenwärtige, von nun an als Ausländer angesehen werden. Die meisten der Menschen, die so ihre libysche Staatsbürgerschaft verloren, waren Tubu.
Zu ihnen gehört auch der Rentner Mohammed Issa. Nach dem Krieg, im Jahr 1987, verließ er Aouzou. Er ließ sich mit seiner Familie im Kufra-Becken im Südosten Libyens nieder. Durch das Rundschreiben Nummer 13 wurde er vom Libyer zum Staatenlosen. »Obwohl ich mich als Libyer verstehe, gelte ich als Fremder, der einer Staatsbürgerschaft nicht würdig ist«, klagt Issa.
»Ich gelte als Fremder, der einer Staatsbürgerschaft nicht würdig ist«
Issa versuchte mehrmals vor Gericht, seine Staatsbürgerschaft zurückzuerhalten. Doch der Richter in Kufra teilte ihm mündlich mit, dass sein Gericht nicht zuständig sei – er weigerte sich jedoch, ein schriftliches Dokument oder Beweise für diese Behauptung vorzulegen. Issa konstatiert: »Die Politik behandelt uns Tubu und ganz besonders die Menschen aus Aouzou wie Feinde«.
Erst seit dem Sturz Gaddafis haben Issa und seine Familie die Chance, wieder Reisepässe und nationale Identitätsnummern ausgehändigt zu bekommen. Der Generalsekretär des Volkskongresses verkündete im Mai 2011 offiziell, dass der Beschluss, den Bewohnern des Aouzou-Streifens die Staatsangehörigkeit zu entziehen, aufgehoben sei. Aber bis heute sind die zuständigen Behörden dem nicht nachgekommen.
In Libyen kursiert das Gerücht, die Einwohner von Aouzou hätten ein Referendum abgehalten und darin mehrheitlich dem Tschad ihre Loyalität zugesagt. Dafür gibt es zwar keinerlei Beweise, befeuert aber dennoch Stigmatisierung und Rassismus gegenüber den Tubu.
Genau genommen gibt es sogar Beweise, die diese böswillige Verleumdung widerlegen. Am 31. Mai 1994 schickte der libysche Militärkommandeur der Region Aouzou einen Bericht an den Kommandeur von West-Aouzou, in dem er bestätigte, dass bis auf eine Person alle libyschen Einwohner das in den Tschad transferierte Gebiet verlassen hatten und in benachbarte Regionen innerhalb Libyens umgezogen waren. Er schrieb, diese Menschen seien schlicht nicht gewillt gewesen, unter tschadischer Autorität zu leben.
Obwohl der libysche Staat zahlreiche Entscheidungen zugunsten der Menschen getroffen hat, die in Aouzou geboren wurden, und die meisten von ihnen noch immer die Familienbücher und Zivilstandsnummern besitzen, die ihnen vor 1996 zugeteilt wurden, bleibt ihre Situation prekär. Bis heute kämpfen sie darum, als libysche Bürger anerkannt zu werden. Kaum etwas deutet darauf hin, dass den Versprechen des Staates auch wirklich Taten folgen werden.
Auch die Tuareg gehören zu den am stärksten von Staatenlosigkeit betroffenen Gruppen Libyens – ein Symptom der rassistischen Diskriminierung und politischen Ausbeutung, der sie sich in Libyen ausgesetzt sehen. Einige von ihnen kehrten aus dem Exil zurück und landeten deshalb im »Rückkehrregister«, andere sind Wüstenbewohner oder Nomaden, die von den Volkszählern einfach übersehen wurden.
Gaddafi versprach allen Tuareg die libysche Staatsbürgerschaft
»Unter Gaddafis Regime versuchten die libyschen Behörden, uns Tuareg für die Kriege und militärischen Abenteuer des Präsidenten auszunutzen. Im Gegenzug versprachen sie uns die libysche Staatsbürgerschaft«, berichtet der Tuareg-Aktivist Abubakar Kahty im Gespräch mit zenith. 1972 gründete Gaddafi dann die Islamische Legion, als Instrument für Interventionen in Ländern wie Ruanda, dem Tschad oder Libanon. »Dafür stachelte er die Tuareg an und drängte sie, Teil der Großen Revolutionären Bewegungen der Sahara-Regionen zu werden.«
In seinen Reden proklamierte Gaddafi das Recht aller Tuareg innerhalb und außerhalb Libyens auf die libysche Staatsangehörigkeit. Im Jahr 1980 rief der selbsternannte Bruder-Führer während einer Rede in Awbari den Tuareg entgegen: »Dieses Land – Libyen – ist das Mutterland aller Tuareg-Sultanate. Die Ursprünge der Tuareg gehen zurück auf libysches Territorium. Und wir, die Araber, sind ihre Gäste«.
Das befeuerte den Wunsch vieler, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Aber wer sich wirklich nach Libyen aufmachte, erlebte dort einen ganz anderen Ton seitens Behörden: Mit dem Hinweis auf undurchsichtige »Sicherheitskriterien« wurde den meisten die Nationalität verweigert.
Gaddafis Strategie der falschen Versprechungen verschärfte das Staatenlosigkeitsproblem der Tuareg. Ein beträchtlicher Teil der Sahara-Bevölkerung aus Algerien, Mali und anderen Ländern kam nach Libyen – in der Hoffnung, dort libysche Papiere und Stabilität zu finden. Für die meisten blieb dieser Wunsch bis heute ein ferner Traum.
Zusätzlich zu den in diesem Artikel angesprochenen Bevölkerungsgruppen gibt es noch mehr Staatenlose in Libyen. Einige Bewohner der Sahara glauben schlicht nicht an Nationalitäten und menschengemachte Grenzen. Sie berufen sich stattdessen auf uralte Wurzeln und lehnen die Trennung der Sahara-Bewohner grundsätzlich ab. Durch familiäre Beziehungen in unterschiedliche Länder wie den Sudan, den Tschad oder Niger bleiben auch sie bis heute ohne eine libysche oder irgendeine sonstige Staatsbürgerschaft.
Auch die Tubu wurden Opfer des Rassismus in der libyschen Gesellschaft. Unter der Repression des Gaddafi-Regimes litten sie in besonderem Maße. Hassan Kadano ist Menschenrechtsaktivist und selbst Tubu. Mit zenith sprach er in Tunis über die komplizierte Situation verschiedener staatenloser Tubu-Gruppen im Kampf um die libysche Staatsbürgerschaft.
Nicht nur diejenigen, die im Aouzou-Streifen geboren wurden seien mit dem Dilemma konfrontiert. »Nachdem Libyen seinen Krieg gegen den Tschad 1987 verloren hatte, wurde willkürlich 70 Tubu-Familien die libysche Staatsbürgerschaft entzogen«. Kadano ist überzeugt, dass das mit Verratsvorwürfen gegen die Söhne dieser Familien zu tun hatte. »Sie kämpften in der libyschen Armee, wurden aber aufgrund ihrer tschadischen Wurzeln des Verrats bezichtigt.«
Auch nach dem Kufra-Aufstand vom November 2008 wurde einer Vielzahl von Tubu die Staatsbürgerschaft entzogen. Die Menschen waren auf die Straße gegangen, um grundlegende Rechte einzufordern. Sie wollten beispielsweise endlich ihre Kinder einschulen oder offizielle Dokumente erneuern lassen. Während der Proteste wurden mehr als 150 Menschen getötet oder verwundet.
»Die Botschaften haben uns Juden nie wie Libyer behandelt«
Raphael Luzon, Präsident der Vereinigung Libyscher Juden, erzählt im Gespräch mit zenith, dass auch libysche Juden auf viele Hindernisse stoßen, wenn sie versuchen, ihre Bürgerrechte einzufordern. Die jüdische Bevölkerung wurde unter Mohammed Al-Senussi während des Sechstage-Krieges mit Israel aus dem Libyschen Königreich vertrieben. »Wir sind Libyer und haben für mehr als 2.000 Jahre hier gelebt. Und trotzdem verwehren uns die libyschen Regierungen weiterhin unsere Rechte. Wir werden immer nur hingehalten«, beklagt sich Luzon.
Selbst Juden, die Libyen mit einem Reisepass des Libyschen Königreichs, einer Geburtsurkunde oder anderen offiziellen Papieren verließen, konnten diese nach Ablauf der Gültigkeit nicht erneuern. »Es gab nie eine offizielle Entscheidung, den libyschen Juden die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Aber die Botschaften haben uns nie wie Libyer behandelt.«
Luzons Versuche, eine nationale Identitätsnummer oder Identifikationspapiere zu erhalten, schlugen fehl – obwohl ihm seit 2011 mehrere Regierungen hintereinander Hoffnungen machten. Aber der Tenor blieb all die Jahre über derselbe: Es brauche Zeit, denn die jüdisch-libysche Frage sei eine heikle Angelegenheit und das Land nach wie vor instabil.
Luzon gibt sich kämpferisch: »Wenn sie uns bis zu den Wahlen noch keine Staatsbürgerrechte gewähren, werden wir eine Beschwerde wegen rassistischer Diskriminierung und der Verweigerung des Rechts auf politische Partizipation bei den Vereinten Nationen einreichen.«
Eine der vehementesten Unterstützerinnen der Opfer von Staatenlosigkeit in Libyen ist die Anwältin Ghaliya Bouras. Mehr als 1.600 Menschen haben ihr bereits ihre Verteidigung vor libyschen Gerichten anvertraut – im Kampf um das, was Bouras als das »magisches Dokument« bezeichnet.
Während sich die Zahl der Staatenlosen vervielfachte, bleiben nennenswerten Fortschritte im Vorgehen der Behörden aus. Stattdessen wird die Staatenlosigkeit nun schon an die nächste Generation weitervererbt.
Bouras meint, auch das System der Verwaltungsnummern ermöglicht kaum mehr als die Sicherstellung von Lohnzahlungen und den Abschluss von Eheverträgen. Fundamentale Bürgerrechte und politische Freiheiten werden den Betroffenen weiterhin verwehrt. Bouras behauptet sogar, Mohammed Beltamer, der Direktor der Zivilstandsbehörde höchstpersönlich, verursache Verzögerungen bei der Bearbeitung der Fälle. Deshalb reichte sie beim Generalsekretär des Volkskongresses Beschwerde über Beltamer ein.
Die Ausreden der zuständigen Behörden, Fälschungen oder Mehrfachregistrierungen seien für die Verzögerungen verantwortlich, hält sie für untragbar. Ihrer Meinung nach fehlt schlicht der Wille, das Problem wirklich anzugehen. »Die provisorische Lösungen machen alles nur noch komplizierter.«
Diese Reportage wurde durch den Candid Journalism Grant gefördert.