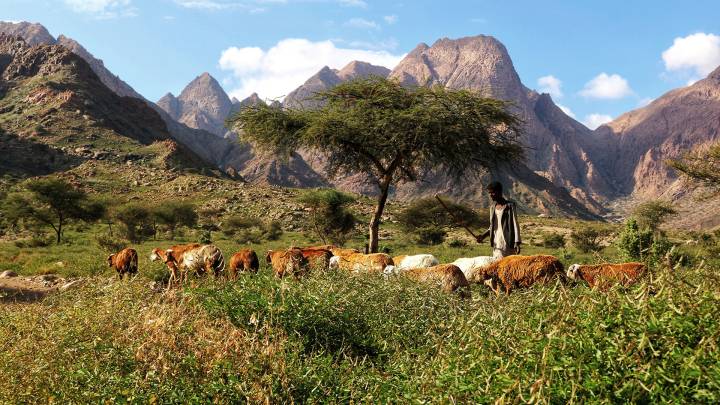Seit dem 16. Juni erheben sich Studenten, Journalisten, Anwälte und religiöse Autoritäten im Sudan. Sie fordern billigeren Zucker und Benzin, Bürgerrechte, ein Ende der sudanesischen Kriege – und den Sturz des Regimes.
»Um 10 Uhr Morgen früh geht es los. Wir wissen nicht, wie viele wir sein werden, aber die sudanesische Regierung wird wissen, dass wir uns nicht mehr unterdrücken lassen«, erklärt der sudanesische Flüchtling und Aktivist Amr vor der ersten Demonstration vor der sudanesischen Botschaft – eine halbe Meile entfernt von Tahrir-Platz im Mai 2011. Rund 150 sudanesische Demonstranten aus dem Südsudan, den Nuba-Bergen, Nubien, Darfur und Kordofan protestieren mit Gesang und Tanz gegen das Regime Omar al-Baschirs: »Er muss nach Den Haag.«
Im Anschluss treffen sich die Organisatoren in einem Teehaus in der Innenstadt Kairos. »Im Sudan wird man von dieser Demonstration hören.« »Die Demonstranten sind ein paar anormale Leute«, erklärt Omar al-Baschir, sudanesischer Herrscher und Gebieter von Militärs und pseudo-islamischen Gnaden Anfang vergangener Woche in einer Ansprache im Parlament. Als Reaktion auf al-Baschirs Herablassung wurde den Demonstrationen gegen das Regime der Name »Freitag der Anormalen« verliehen.
Er folgt dem »Freitag des Ellenbogenleckens«, Antwort auf Nafi Ali Nafi, Vizepräsident der regierenden »Nationalen Kongresspartei« und Berater des Präsidenten, der den Demonstranten erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit das Regime zu stürzen so groß sei, wie wenn sie versuchen würden, ihre eigenen Ellenbogen zu lecken. Dem ging der »Freitag des Sandsturms« voraus – der erste Freitag der Proteste, ausgehend von der Universität Khartum, der sich für die Sicherheitsapparate unkontrollierbar in kleinen Gruppen durch Khartum ausbreitete.
Die Slogans verfingen unter den Massen. Eine wachsende Zahl an Menschen in den Straßen der Hauptstadt verkünden: »Ich bin stolz, anormal zu sein. Ich bin frei.« Die Abschaffung von Benzin und Zuckersubventionen, zu denen sich das Regime von Omar al-Baschir nach Monaten des immer größer klaffenden Haushaltsloches von mittlerweile 2,4 Milliarden US-Dollar gezwungen sah, veranlasste Studenten der Universität Khartum am 16. Juni zu ersten Demonstrationen.
Seitdem ziehen mehrere Gruppen von hundert bis tausend Demonstranten fast täglich auf die Straßen Khartums, Omdurmans, al-Ubayeds, Sinars, und Port Sudans. Juristen, Imame, Journalisten und auch immer mehr Tagelöhner aus den Slumvierteln der Großstädte haben sich angeschlossen. Zu ihnen könnten auch bald ehemalige Beamte der Regierung stoßen – um das Haushaltsdefizit zu stopfen, streicht die Regierung derzeit Regierungsposten. Mit der Unabhängigkeitserklärung Südsudans verlor der Norden rund 75 Prozent seiner Gasvorkommen.
Im Mai 2011 brachen in den Nuba-Bergen zwischen Khartum und dem Südsudan Kämpfe aus. Die afrikanischen Nuba-Stämme fochten seit den 1980er Jahren Seite an Seite mit der Widerstandsbewegung im Süden gegen das vorwiegend arabische Regime Omar al-Baschirs. Die neuen Grenzen im »Comprehensive Peace Agreement« von 2005 wurden jedoch südlich der Nuba-Berge gezogen. Khartum hat eine vollständige Medienblockade verhängt, Internet- und Telefonverbindungen wurden weitestgehend getrennt.
Das darfurische »Justice and Equality Movement« (JEM) erklärte seine Solidarität mit den Rebellen in den Nuba-Bergen, auch bekannt als SPLA-North. Die Small Arms Survey, berichtet, dass die südsudanesische Regierung die Rebellen in den Nuba-Bergen und in Darfur im Hintergrund militärisch unterstützt.
»Die verdienen kaum Geld, trotzdem schlagen sie auf uns ein«
Die ungeklärte Zugehörigkeit des erdgasreichen Abiyeis führt zu weiteren Grenzkämpfen und veranlasste die südsudanesische Regierung im Januar 2012, die Gaslieferungen in den Norden völlig zu unterbrechen. Damit versiegt die Haupteinnahmequelle des Baschir-Regimes, und somit die Gelder, um den Rentierstaat sowie die aufgeblähten Militär- und Sicherheitsapparate zu finanzieren. Von Regierungsseite wurde den ersten Demonstrationen kaum Bedeutung gezollt.
Die Studenten, unter ihnen viele Frauen, der Universität Khartum, wurden von anderen Bevölkerungsgruppen anfänglich mit Skepsis registriert. Am zweiten Freitag, den 22. Juni, begannen Nachrichten von Protesten in verschiedenen Provinzregionen einzutreffen. Landarbeiter und Büroangestellte blockierten Straßen, Aufstände in Slums flammen immer wieder auf, Juristen demonstrieren vor Gerichten und erklärten ihre Solidarität mit den Demonstrationen.
Omneya studiert an der Universität Khartum und nimmt seit dem 16. Juni an den Freitagsdemonstrationen teil. Seit ihrem Studium steht sie den Kommunisten nahe und protestiert gegen die steigenden Preise, die einseitig ausgerichtete Wirtschaftspolitik des Regimes und die Gewalt gegen Demonstranten. Wirtschaftliche Reformen und der Sturz des Regimes sind ihre Hauptziele. »Wir brauchen eine nationale Übergangsregierung. Ein Jahr später finden dann faire Wahlen statt. Ich gehe auf die Straße, um zu zeigen, dass ich das Regime und seine Politik nicht länger akzeptiere. Ich will Demokratie und mehr Freiheiten und kämpfe gegen die Kriege im Sudan. Der geteilte Sudan soll wieder eins werden.«
Nach gut erprobter repressiver Manier geht das Regime hart gegen die Demonstranten vor. Die Universität Khartum wird von Polizei und Al-Rabate-Milizen (umgangssprachlich »Räuber« genannt, ähnlich der syrischen »Schabiha« und der ägyptischen »Baltageya«) gestürmt. Studentenwohnheime werden in Brand gesetzt und mindestens ein Dutzend Studenten in Gewahrsam genommen. Einige werden schwer verletzt.
Die Al-Rabate bilden den verlängerten Arm des Regimes. Sie werden in Wagen ohne Nummernschilder der Staatssicherheit angekarrt, und mit Tränengas, Macheten und Metallstangen auf Demonstranten losgelassen. Das erspart der Polizei die Arbeit, das Volk niederzuknüppeln, und erlaubt es dem Regime weiterhin zu behaupten, dass es die Meinungsfreiheit respektiert. Gewinnen die Demonstranten in den Straßenschlachten die Oberhand, rücken die bis dahin untätig beobachtenden Polizisten ein und verteidigen die »Räuber«, die dann als Pro-Baschir-Demonstranten dargestellt werden. Omneya empört sich über das brutale Vorgehen der Polizei und Al-Rabata-Milizen: »Die verdienen kaum Geld, trotzdem schlagen sie auf uns ein.«
Regimekritische Imame werden vorsorglich ausgetauscht
Die Demonstranten, die die Proteste organisieren und zu großen oppositionellen Parteien gehören, werden regelmäßig von Geheimdiensten festgenommen. Wohin sie gebracht werden, ist unklar. Auf Facebook berichten zeitweilig Inhaftierte, dass sie gefoltert wurden. Videos dokumentieren, wie Demonstranten von Omar al-Baschirs »islamischen« Gerichten zu 100 Rutenhieben verurteilt werden. Neben der Universität sind Moscheen Ausgangspunkte der Proteste. Vergangenen Freitag wurde die Wadnubawi-Moschee in Omdurman von Sicherheitskräften mit Tränengas beschossen, nachdem der Imam trotz Regierungsverbot die Betenden zum Protest aufgerufen hatte. Andere regimekritische Imame wurden vorsorglich ausgetauscht. Die Bewegung »Girifna – Wir haben die Schnauze voll«, formuliert sechzehn Forderungen: darunter freie Wahlen, Garantie der Freiheiten, die vom Regime beschnitten wurden, die Aufhebung der Kürzungen, ein Ende des Krieges in den Nuba-Bergen und in Darfur, eine radikale Reform des Sicherheitsapparates, ein Ende der politischen Instrumentalisierung von Religion, Untersuchungen der Korruptionsfälle und das Ende des ethnischen Machtmonopols – will sagen, das Ende der Herrschaft einiger arabischer Stämme über Afrikaner und andere Volksgruppen. Die Ziele des JEM aus Darfur, der SPLA, und der Kommunisten ähneln denen Girifnas, gehen jedoch darüber hinaus, indem sie den Sturz des Regimes fordern. Eingehend auf Befürchtungen der Bevölkerung Khartums, dass im Falle eines Regimesturzes die Rebellen aus dem Süden und dem Westen gewaltsam in die Hauptstadt eindringen werden, haben JEM und SPLA-North bereits während der ersten Woche der Proteste verkündet, einen einseitigen, flächendeckenden Waffenstillstand auszurufen. Auf den Straßen Khartums erklingt der aus der Region bekannte rhythmische Slogan: »Das Volk fordert den Sturz des Regimes.«
Über 2.000 Demonstranten wurden bereits verhaftet
Die chronische Unmöglichkeit einer akkuraten Berichterstattung führt zu Unsicherheit. Journalisten werden eingeschüchtert. Eine ägyptische Reporterin des amerikanischen Senders Bloomberg wurde zu Beginn der Demonstrationen festgenommen und nach einigen Tagen ausgewiesen. Anstatt gegen die Beschneidung der journalistischen Freiheiten und die willkürliche Verhaftung seiner Staatsbürgerin zu protestieren, empfahl der ägyptische Botschafter in Khartum Journalisten, sich streng »an die Gesetze des Sudans« zu halten.
Das Büro von AFP in Khartum wurde in der vergangenenWoche gestürmt und ein sudanesischer Mitarbeiter verhaftet. Über die letzten Jahre hinweg wurden zahlreiche sudanesische Zeitungen geschlossen. Journalisten werden von Offiziellen telefonisch eingeschüchtert. Tauchen sie doch bei Demonstrationen auf, droht ihnen Verhaftung. Ausländische Medien sind nur spärlich vor Ort vertreten.
Zu AFP und Bloomberg gesellt sich noch Reuters, der latent Baschir-kritische emiratisch-saudische Kanal Al-Arabiya und vereinzelte Reporter ägyptischer Medien. Die Abwesenheit des katarischen Senders Al-Jazeera, Unterstützer der Revolutionen in Ägypten, Libyen und Syrien, lässt vermuten, dass Katar seinen Einfluss im Sudan, den es innerhalb der letzten Jahre durch Vermittlungen im Darfur-Konflikt erlangt hat, nicht durch negative Berichterstattung unterminieren will.
Studenten berichten, dass diejenigen, die sich innerhalb der letzten Wochen die Mühe gemacht haben, Zahlen über Verhaftete, Verletzte oder Tote zu sammeln, meist bald selbst verschwinden. Nachdem das Hacker-Kollektiv Anonymous in der ersten Woche der Demonstrationen die Website der sudanesischen Regierung lahm gelegt hatte, hat das sudanesische Regime mittlerweile selbst eine Einheit eingerichtet, um Aktivisten und Journalisten im Internet auszuspähen.
Damit werden Facebook und Twitter anfälliger für Überwachung, und das Risiko, Nachrichten intern oder ins Ausland zu vermitteln, steigt. Schätzungen der Demonstranten zufolge sollen bisher rund 2000 Menschen verhaftet worden sein. Indes zogen Amr und andere sudanesische Flüchtlinge auch an diesem »Freitag der Anormalen« wieder vor die sudanesische Botschaft in Kairo, mit der Hoffnung, eines Tages ohne Angst vor Verfolgung in ihr Land zurückkehren zu können. Und auch im Sudan demonstrierten am Sonntag mehrere hundert Studenten an der Universität Khartum gegen das Regime.