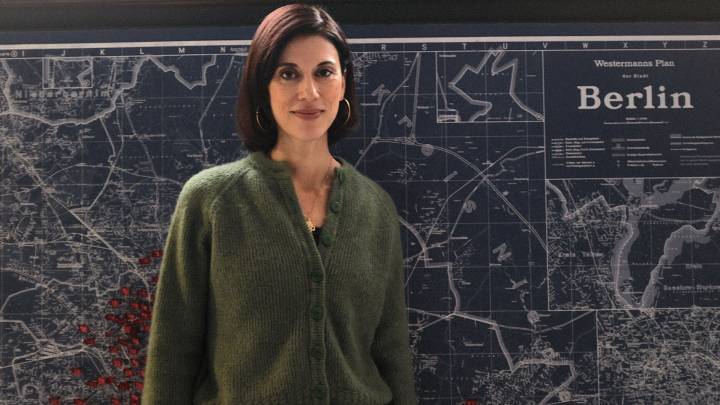Filme aus und zu Palästina sorgten zuletzt für Furore und Kontroversen. Wie Krieg und Genozid in Gaza den Blick auf und die Filme selbst verändert haben.
»Dieser Film betont das Recht jedes Kindes, in Frieden zu leben und zu träumen, ohne Belagerung, ohne Angst und ohne Krieg«, sagte der palästinensische Regisseur Baher Agbariya während seiner Dankesrede bei der diesjährigen Verleihung der »Ophir Awards«, dem wichtigsten Filmpreis Israels. Sein gemeinsam mit dem Israeli Shai Carmeli-Pollak produzierter Film »Hayam« (zu Deutsch: »Das Meer«) ist bei der diesjährigen Verleihung in Tel Aviv als bester Film ausgezeichnet worden. Der Spielfilm begleitet einen palästinensischen Jungen aus dem Westjordanland, der einmal in seinem Leben das Meer sehen will – und dafür eine gefährliche Reise zwischen Checkpoints, Soldaten und Siedlern auf sich nimmt. Für die Darstellung des Protagonisten Khalid erhielt der 13-jährige Muhammad Ghazzawi die Auszeichnung als »Bester Schauspieler« – als bisher jüngster Preisträger in dieser Kategorie.
Zwar hat nicht zum ersten Mal ein palästinensischer Film bei den »Ophir Awards« triumphiert. 2016 räumte das arabischsprachige Familiendrama »Sand Storm« über eine beduinische Gemeinde zuletzt den Hauptpreis ab. Und bereits 2009 gewann der in Jaffa spielende Film »Ajami« bei den »Ophir Awards«. Aber eine derart weitreichende innerpolitische Kontroverse wie »Das Meer« hatte keine dieser Filme ausgelöst. Denn nur einen Tag nach der Verleihung am 16. September kündigte der rechtsradikale israelische Kulturminister Miki Zohar an, die staatliche Finanzierung der »Ophir Awards« ab 2026 einzustellen. »Das Meer« würde »israelische Soldaten diffamieren«.
Angesichts der Tatsache, dass immer wieder Aufnahmen kursieren, in denen sich israelische Soldaten bei der Verübung ihrer Verbrechen filmen oder sich derer brüsten, bestätigt die Reaktion der Regierung die Kritik statt ihr den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ohnehin sind Versuche, Aufmerksamkeit für den Film und sein Thema in Grenzen zu halten, zum Scheitern verurteilt. Denn als Gewinner der »Ophir Awards« ist »Das Meer« automatisch Israels offizieller Beitrag für die Kategorie »Bester internationaler Film« bei den Oscars im kommenden Frühjahr.
Am 28. Juli 2025 erschoss ein Siedler den palästinensischen Aktivisten Awdah Hathleen, der an der Produktion von »No Other Land« mitgewirkt hatte
Als Netflix Ende 2022 das Drama »Farha« über das Schicksal einer 14-jährigen Palästinenserin während der Nakba veröffentlichte, brandmarkte der damalige Finanzminister Avigdor Liebermann den Streifen zwar als »Lüge«, doch es blieb bei wütenden Worten. Dass die rechtsradikale israelische Regierung bereit ist, die eigene Kunst- und Kulturszene zu sabotieren, zeugt von der Wirkungskraft solcher Filme – gerade vor dem Hintergrund von Krieg und Genozid in Gaza.
Tatsächlich standen in früheren Produktionen in erster Linie gesellschaftliche Probleme im Vordergrund – politische Missstände hingegen werden eher unterschwellig beleuchtet: Israelis und Palästinenser gehen Beziehungen ein, untereinander spricht man Arabisch, mit den jüdischen Freunden Hebräisch. Solche Filme, die den Fokus auf das Zwischenmenschliche legen, erfreuen sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Der neuste Vertreter aus diesem Genre ist »Happy Holidays, der im September auch in den deutschen Kinos anlief. Während die einzelnen Familienmitglieder versuchen, ein selbstbestimmtes Leben fernab gesellschaftlicher Konventionen zu führen, erhält der Zuschauer auch einen Einblick in das streng reglementierte israelische Erziehungswesen – anders als in Filmen, die ebenfalls gesellschaftliche Tabus aufgreifen und auf zahlreichen internationalen Filmefestspielen gezeigt wurden, wie beispielsweise »In Between« aus dem Jahre 2016: Ein Erzählung über drei Palästinenserinnen in Tel Aviv, die von gleichgeschlechtlicher Liebe bis hin zu exzessiven Drogen die Grenzen des Verbotenen austesten.
Internationale Aufmerksamkeit für die Realität der Militärbesatzung schuf hingegen vor allem der Dokumentarfilms »No Other Land« von Basel Adra und Yuval Abraham, der als erster palästinensische Film einen Oscar gewann. Nicht zuletzt führte »No Other Land« vor Augen, wie sehr Film und Alltag der Produzenten miteinander verwoben sind und dass auch ein Oscar nicht vor der tagtäglichen Repression schützt: Am 13. September griffen Siedler aus der illegal errichteten Siedlung Havat Ma’on Basel Adras Heimatdorf At-Tuwani in Masafer Yatta an – sein Bruder wurde dabei schwerverletzt. Auch der palästinensische Co-Regisseur Hamdan Ballal wurde im März diesen Jahres von einem aggressiven Mob israelischer Siedler angriffen und am 28. Juli 2025 erschoss ein Siedler den palästinensischen Aktivisten Awdah Hathleen, der an der Produktion von »No Other Land« mitgewirkt hatte.
Palästinensische Filme werden nicht nur ernster genommen. Auch die Bedingungen, unter denen sie entstehen, stehen nun im Fokus
Der anhaltende Genozid in Gaza fügte dem palästinensischen Film eine weitere Dimension hinzu, die jene Verbrechen und Einzelschicksale filmisch aufarbeitet. Beispielsweise die aus 22 Kurzfilmen bestehende Anthologie »The Ground Zero« aus dem Jahre 2024 von Rashid Masharawi, der einen Einblick in den Alltag zwischen Aushungerung und Bombardierung gibt. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die im Juli ausgestrahlte Al-Jazeera-Dokumentation »The Last Doctor Standing« über den Kinderarzt Hussam Abu Safiya.
Das wohl größte Echo löste aber zuletzt »The Voice of Hind Rajab« der tunesischen Regisseurin Kaouther Ben Hania aus. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines sechsjährigen Mädchens aus Gaza. Der Film zeichnet eindringlich die letzten Stunden im Leben des Kindes am 29. Januar 2024 nach, ebenso wie die verzweifelten – und vergeblichen – Rettungsversuche: Sowohl Hind Rajab als auch die Sanitäter des Roten Halbmonds, die sie bergen wollten, fallen letzten dem israelischen Beschuss zum Opfer.
»The Voice of Hind Rajab« erhielt bei der Uraufführung in Venedig am 3. September 2025 mit über 23 Minuten die bislang längsten stehenden Ovationen in der Geschichte des renommierten Festivals. Diese Aufmerksamkeit zeigt, dass fast zwei Jahre Krieg und der anhaltende Genozid nicht spurlos an der internationalen Filmszene vorbeigehen: Denn nur zwei Tage nach der Premiere hatten über 1.800 Persönlichkeiten aus der US-amerikanischen Filmbranche einen Appel unterzeichnet, in Zukunft nicht mehr mit israelischen Institutionen zusammenzuarbeiten, die sich des Genozids mitschuldig machen.
Sowohl solche Boykottaufrufe, denen sich auch bekannte Schauspieler wie Javier Bardem oder Mark Ruffalo anschlossen, als auch der Einstieg von Hollywood-Größen wie Brad Pitt und Joaquin Phoenix als Ko-Produzenten von »The Voice of Hind Rajab« verdeutlichen eine Kehrtwende: Palästinensische Filme werden nicht nur ernster genommen. Auch die Bedingungen, unter denen sie entstehen, stehen nun im Fokus.